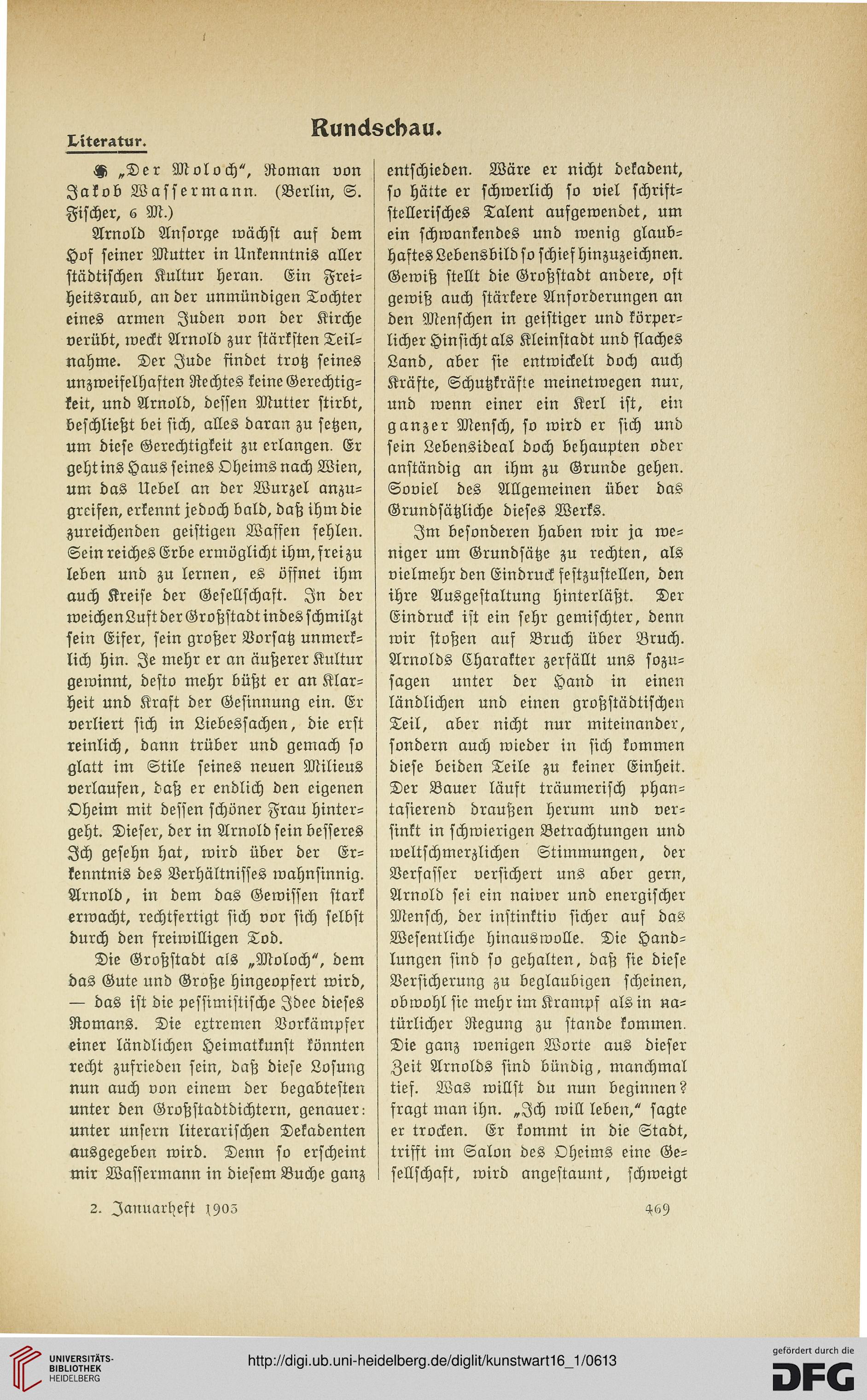kilerstur.
Kunclsckau
G „Der Moloch", Roman von
Iakob Wassermann. (Berlin, S.
Fischer, 6 M.)
Arnold Ansorge wächst auf dem
Hof seiner Mutter in Unkenntnis aller
städtischen Kultur heran. Ein Frei-
heitsraub, an der unmündigen Tochter
eines armen Juden von der Kirche
verübt, weckt Arnold zur stärksten Teil-
nahme. Der Jude findet trotz seines
unzweifelhaften Rechtes keine Gerechtig-
keit, und Arnold, dessen Mutter stirbt,
beschlietzt bei sich, alles daran zu setzen,
um diese Gerechtigkeit zu erlangen. Er
gehtins Haus seines Oheims nach Wien,
um das Uebel an der Wurzel anzu-
greisen, erkennt jedoch bald, daß ihmdie
zureichenden geistigen Waffen sehlen.
Sein reiches Erbe ermöglicht ihm, sreizu
leben und zu lernen, es öffnet ihm
auch Kreise der Gesellschaft. Jn der
weichenLuft der Großstadt indes s chmilzt
sein Eifer, sein grotzer Vorsatz unmerk-
lich hin. Ie mehr er an äutzerer Kultur
gewinnt, desto mehr bützt er an Klar-
heit und Kraft der Gesinnung ein. Er
oerliert sich in Liebessachen, die erst
reinlich, dann trüber und gemach so
glatt im Stile seines neuen Milieus
verlaufen, datz er endlich den eigenen
Oheim mit dessen schöner Frau hinter-
geht. Dieser, der in Arnold sein besseres
Jch gesehn hat, wird über der Er-
kenntnis des Verhältnisses wahnsinnig.
Arnold, in dem das Gewissen stark
erwacht, rechtfertigt sich vor sich selbst
durch den freiwilligen Tod.
Die Grotzstadt als „Moloch", dem
das Gute und Grotze hingeopfert wird,
— das ist die pessimistische Jdee dieses
Romans. Die extremen Vorkämpser
einer ländlichen Heimatkunst könnten
recht zufrieden sein, daß diese Losung
nun auch von einem der begabtesten
unter den Großstadtdichtern, genauer:
unter unsern literarischen Dekadenten
ausgegeben wird. Denn so erscheint
mir Wassermann in diesem Buche ganz
entschieden. Wäre er nicht dekadent,
so hätte er schwerlich so oiel schrift-
stellerisches Talent aufgewendet, um
ein schwankendes und wenig glaub-
haftes Lebensbild so schief hinzuzeichnen.
Gewitz stellt die Grotzstadt andere, ost
gewitz auch stärkere Anforderungen an
den Menschen in geistiger und körper-
licher Hinsicht als Kleinstadt und flaches
Land, aber sie entwickelt doch auch
Kräfte, Schutzkräfte meinetwegen nur,
und wenn einer ein Kerl ist, ein
ganzer Mensch, so wird er sich und
sein Lebensideal doch behaupten oder
anständig an ihm zu Grunde gehen.
Soviel des Allgemeinen über das
Grundsätzliche dieses Werks.
Jm besonderen haben wir ja we-
niger um Grundsätze zu rechten, als
vielmehr den Eindruck festzustellen, den
ihre Ausgestaltung hinterlätzt. Der
Eindruck ist ein sehr gemischter, denn
wir stoßen auf Bruch über Bruch.
Arnolds Charakter zerfällt uns sozu-
sagen unter der Hand in einen
ländlichen und einen grotzstädtischen
Teil, aber nicht nur miteinander,
sondern auch wieder in sich kommen
diese beiden Teile zu keiner Einheit.
Der Bauer läuft trüumerisch phan-
tasierend drautzen herum und ver-
sinkt in schwierigen Betrachtungen und
weltschmerzlichen Stimmungen, der
Versasser versichert uns aber gern,
Arnold sei ein naiver und energischer
Mensch, der instinktiv sicher auf das
Wesentliche hinauswolle. Die Hand-
lungen sind so gehalten, daß sie diese
Versicherung zu beglaubigen scheinen,
obwohl sic mehr im Krampf alsin na-
türlicher Regung zu stande kommen.
Die ganz wenigen Worte aus dieser
Zeit Arnolds sind bündig, manchmal
ties. Was willst du nun beginnen?
fragt man ihn. „Jch will leben," sagte
er trocken. Er kommt in die Stadt,
trifft im Salon des Oheims eine Ge-
sellschaft, wird angestaunt, schweigt
H69
2. Ianuarheft t90Z
Kunclsckau
G „Der Moloch", Roman von
Iakob Wassermann. (Berlin, S.
Fischer, 6 M.)
Arnold Ansorge wächst auf dem
Hof seiner Mutter in Unkenntnis aller
städtischen Kultur heran. Ein Frei-
heitsraub, an der unmündigen Tochter
eines armen Juden von der Kirche
verübt, weckt Arnold zur stärksten Teil-
nahme. Der Jude findet trotz seines
unzweifelhaften Rechtes keine Gerechtig-
keit, und Arnold, dessen Mutter stirbt,
beschlietzt bei sich, alles daran zu setzen,
um diese Gerechtigkeit zu erlangen. Er
gehtins Haus seines Oheims nach Wien,
um das Uebel an der Wurzel anzu-
greisen, erkennt jedoch bald, daß ihmdie
zureichenden geistigen Waffen sehlen.
Sein reiches Erbe ermöglicht ihm, sreizu
leben und zu lernen, es öffnet ihm
auch Kreise der Gesellschaft. Jn der
weichenLuft der Großstadt indes s chmilzt
sein Eifer, sein grotzer Vorsatz unmerk-
lich hin. Ie mehr er an äutzerer Kultur
gewinnt, desto mehr bützt er an Klar-
heit und Kraft der Gesinnung ein. Er
oerliert sich in Liebessachen, die erst
reinlich, dann trüber und gemach so
glatt im Stile seines neuen Milieus
verlaufen, datz er endlich den eigenen
Oheim mit dessen schöner Frau hinter-
geht. Dieser, der in Arnold sein besseres
Jch gesehn hat, wird über der Er-
kenntnis des Verhältnisses wahnsinnig.
Arnold, in dem das Gewissen stark
erwacht, rechtfertigt sich vor sich selbst
durch den freiwilligen Tod.
Die Grotzstadt als „Moloch", dem
das Gute und Grotze hingeopfert wird,
— das ist die pessimistische Jdee dieses
Romans. Die extremen Vorkämpser
einer ländlichen Heimatkunst könnten
recht zufrieden sein, daß diese Losung
nun auch von einem der begabtesten
unter den Großstadtdichtern, genauer:
unter unsern literarischen Dekadenten
ausgegeben wird. Denn so erscheint
mir Wassermann in diesem Buche ganz
entschieden. Wäre er nicht dekadent,
so hätte er schwerlich so oiel schrift-
stellerisches Talent aufgewendet, um
ein schwankendes und wenig glaub-
haftes Lebensbild so schief hinzuzeichnen.
Gewitz stellt die Grotzstadt andere, ost
gewitz auch stärkere Anforderungen an
den Menschen in geistiger und körper-
licher Hinsicht als Kleinstadt und flaches
Land, aber sie entwickelt doch auch
Kräfte, Schutzkräfte meinetwegen nur,
und wenn einer ein Kerl ist, ein
ganzer Mensch, so wird er sich und
sein Lebensideal doch behaupten oder
anständig an ihm zu Grunde gehen.
Soviel des Allgemeinen über das
Grundsätzliche dieses Werks.
Jm besonderen haben wir ja we-
niger um Grundsätze zu rechten, als
vielmehr den Eindruck festzustellen, den
ihre Ausgestaltung hinterlätzt. Der
Eindruck ist ein sehr gemischter, denn
wir stoßen auf Bruch über Bruch.
Arnolds Charakter zerfällt uns sozu-
sagen unter der Hand in einen
ländlichen und einen grotzstädtischen
Teil, aber nicht nur miteinander,
sondern auch wieder in sich kommen
diese beiden Teile zu keiner Einheit.
Der Bauer läuft trüumerisch phan-
tasierend drautzen herum und ver-
sinkt in schwierigen Betrachtungen und
weltschmerzlichen Stimmungen, der
Versasser versichert uns aber gern,
Arnold sei ein naiver und energischer
Mensch, der instinktiv sicher auf das
Wesentliche hinauswolle. Die Hand-
lungen sind so gehalten, daß sie diese
Versicherung zu beglaubigen scheinen,
obwohl sic mehr im Krampf alsin na-
türlicher Regung zu stande kommen.
Die ganz wenigen Worte aus dieser
Zeit Arnolds sind bündig, manchmal
ties. Was willst du nun beginnen?
fragt man ihn. „Jch will leben," sagte
er trocken. Er kommt in die Stadt,
trifft im Salon des Oheims eine Ge-
sellschaft, wird angestaunt, schweigt
H69
2. Ianuarheft t90Z