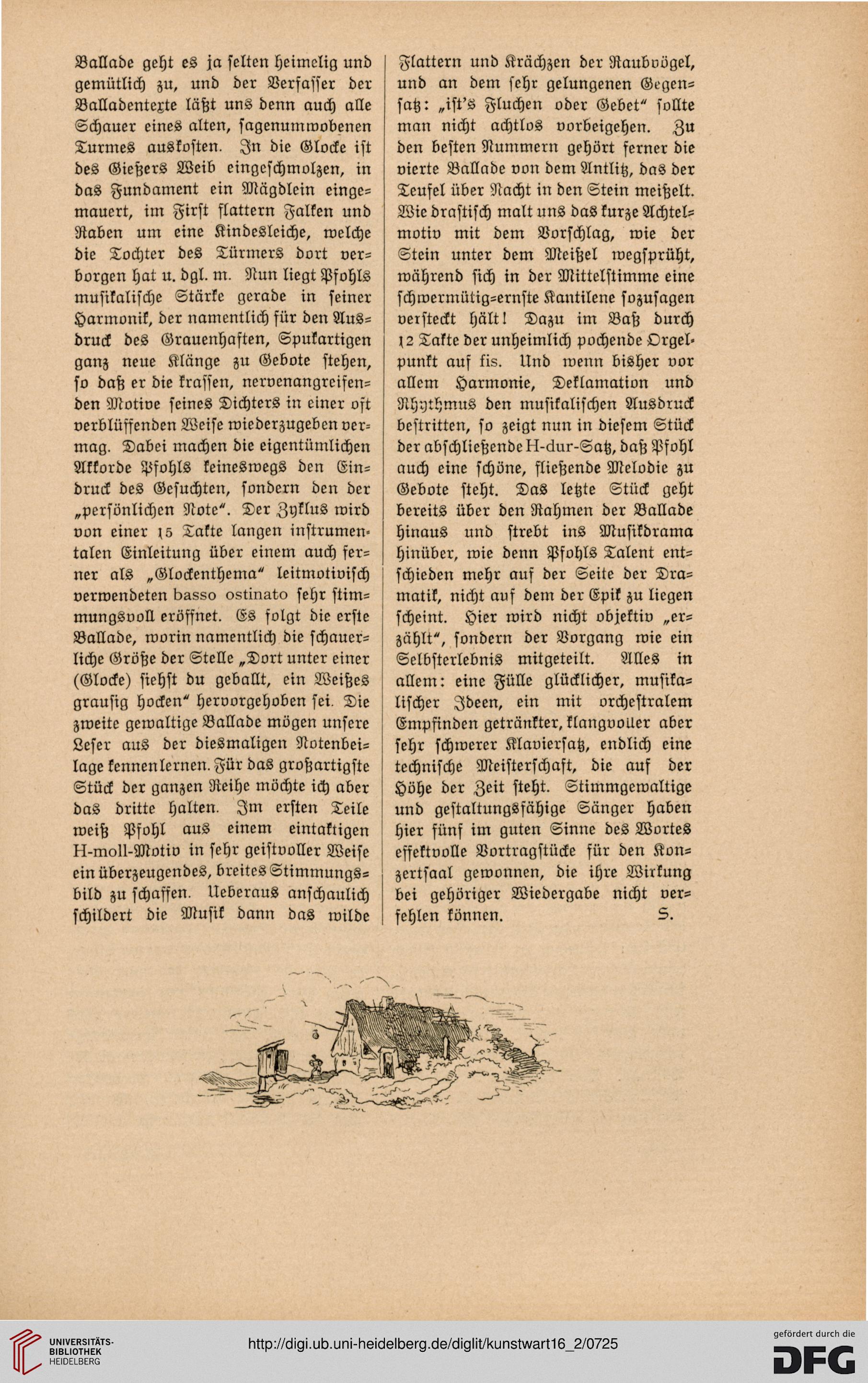Ballade geht es ja selten heimelig und
gemütlich zu, und der Verfasser der
Balladentexte lätzt uns denn auch alle
Schauer eines alten, sagenumwobenen
Turmes auskosten. Jn die Glocke ist
des Giehers Weib eingeschmolzen, in
das Fundament ein Mägdlein einge-
mauert, im First flattern Falken und
Raben um eine Kindesleiche, welche
die Tochter des Türmers dort ver-
borgen hat u. dgl. m. Nun liegt Pfohls
musikalische Stärke gerade in seiner
Harmonik, der namentlich für den Aus-
druck des Grauenhaften, Spukartigen
ganz neue Klänge zu Gebote stehen,
so dah er die krassen, nervenangreifen-
den Motive seines Dichters in einer oft
verblüffenden Weise wiederzugeben ver-
mag. Dabei machen die eigentümlichen
Mkorde Pfohls keineswegs den Ein-
druck des Gesuchten, sondern den der
„persönlichen Note". Der Zyklus wird
von einer ,s Takte langen instrumen-
talen Einleitung über einem auch fer-
ner als „Glockenthema" leitmotivisch
verwendeten bssso ostinato sehr stim-
mungsvoll eröffnet. Es solgt die erste
Ballade, worin namentlich die schauer-
liche Grötze der Stelle „Dort unter einer
(Glocke) siehst du geballt, ein Weihes
grausig hocken" hervorgehoben sei. Die
zweite gewaltige Ballade mügen unsere
Leser aus der diesmaligen Notenbei-
lage kennenlernen. Für das großartigste
Stück der ganzen Reihe möchte ich aber
das dritte halten. Jm ersten Teile
weitz Pfohl aus einem eintakligen
H-moll-Motio in sehr geistvoller Weise
ein überzeugendes, breitcsStimmungs-
bild zu schaffen. Ueberaus anschaulich
schildert die Musik dann das wilde
Flattern und Krächzen der Raubvögel,
und an dem sehr gelungenen Gegen-
satz: „ist's Fluchen oder Gebet" sollte
man nicht achtlos vorbeigehen. Zu
den besten Nummern gehört ferner die
vierts Ballade von dem Antlitz, das der
Teufel über Nacht in den Stein meitzelt.
Wie drastisch malt uns das kurze Achtel-
motiv mit dem Vorschlag, wie der
Stein unter dem Meitzel wegsprüht,
während sich in der Mittelstimme eine
schwermütig-ernste Kantilene sozusagen
veisteckt hält! Dazu im Batz durch
12 Takte der unheimlich pochende Orgel-
punkt auf lis. Und wenn bisher vor
allem Harmonie, Deklamation und
Nhythmus den musikalischen Ausdruck
bestritten, so zeigt nun in diesem Stück
der abschlietzende ll-ckur-Satz, daß Pfohl
auch eine schöne, fließende Melodie zu
Gebote steht. Das letzte Stück geht
bereits über den Rahmen der Ballade
hinaus und strebt ins Musikdrama
hinüber, wie denn Pfohls Talent ent-
schieden mehr auf der Seite der Dra-
matik, nicht auf dem der Epik zu liegen
scheint. Hier wird nicht objektiv „er-
zählt^, sondern der Vorgang wie ein
Selbsterlebnis mitgeteilt. Alles in
allem: eine Füllc glücklicher, musika-
lischer Jdeen, ein mit orchestralem
Empfinden getränkter, klangvouer aber
sehr schwerer Klaviersatz, endlich eine
technische Meisterschaft, die auf der
Höhe der Zeit steht. Stimmgewaltige
und gestaltungsfähige Sänger haben
hier fünf im guten Sinne des Wortes
effektvolle Vortragstücke für den Kon-
zertsaal gewonnen, die ihre Wirkung
bei gehöriger Wiedergabe nicht ver-
fehlen können. S.
gemütlich zu, und der Verfasser der
Balladentexte lätzt uns denn auch alle
Schauer eines alten, sagenumwobenen
Turmes auskosten. Jn die Glocke ist
des Giehers Weib eingeschmolzen, in
das Fundament ein Mägdlein einge-
mauert, im First flattern Falken und
Raben um eine Kindesleiche, welche
die Tochter des Türmers dort ver-
borgen hat u. dgl. m. Nun liegt Pfohls
musikalische Stärke gerade in seiner
Harmonik, der namentlich für den Aus-
druck des Grauenhaften, Spukartigen
ganz neue Klänge zu Gebote stehen,
so dah er die krassen, nervenangreifen-
den Motive seines Dichters in einer oft
verblüffenden Weise wiederzugeben ver-
mag. Dabei machen die eigentümlichen
Mkorde Pfohls keineswegs den Ein-
druck des Gesuchten, sondern den der
„persönlichen Note". Der Zyklus wird
von einer ,s Takte langen instrumen-
talen Einleitung über einem auch fer-
ner als „Glockenthema" leitmotivisch
verwendeten bssso ostinato sehr stim-
mungsvoll eröffnet. Es solgt die erste
Ballade, worin namentlich die schauer-
liche Grötze der Stelle „Dort unter einer
(Glocke) siehst du geballt, ein Weihes
grausig hocken" hervorgehoben sei. Die
zweite gewaltige Ballade mügen unsere
Leser aus der diesmaligen Notenbei-
lage kennenlernen. Für das großartigste
Stück der ganzen Reihe möchte ich aber
das dritte halten. Jm ersten Teile
weitz Pfohl aus einem eintakligen
H-moll-Motio in sehr geistvoller Weise
ein überzeugendes, breitcsStimmungs-
bild zu schaffen. Ueberaus anschaulich
schildert die Musik dann das wilde
Flattern und Krächzen der Raubvögel,
und an dem sehr gelungenen Gegen-
satz: „ist's Fluchen oder Gebet" sollte
man nicht achtlos vorbeigehen. Zu
den besten Nummern gehört ferner die
vierts Ballade von dem Antlitz, das der
Teufel über Nacht in den Stein meitzelt.
Wie drastisch malt uns das kurze Achtel-
motiv mit dem Vorschlag, wie der
Stein unter dem Meitzel wegsprüht,
während sich in der Mittelstimme eine
schwermütig-ernste Kantilene sozusagen
veisteckt hält! Dazu im Batz durch
12 Takte der unheimlich pochende Orgel-
punkt auf lis. Und wenn bisher vor
allem Harmonie, Deklamation und
Nhythmus den musikalischen Ausdruck
bestritten, so zeigt nun in diesem Stück
der abschlietzende ll-ckur-Satz, daß Pfohl
auch eine schöne, fließende Melodie zu
Gebote steht. Das letzte Stück geht
bereits über den Rahmen der Ballade
hinaus und strebt ins Musikdrama
hinüber, wie denn Pfohls Talent ent-
schieden mehr auf der Seite der Dra-
matik, nicht auf dem der Epik zu liegen
scheint. Hier wird nicht objektiv „er-
zählt^, sondern der Vorgang wie ein
Selbsterlebnis mitgeteilt. Alles in
allem: eine Füllc glücklicher, musika-
lischer Jdeen, ein mit orchestralem
Empfinden getränkter, klangvouer aber
sehr schwerer Klaviersatz, endlich eine
technische Meisterschaft, die auf der
Höhe der Zeit steht. Stimmgewaltige
und gestaltungsfähige Sänger haben
hier fünf im guten Sinne des Wortes
effektvolle Vortragstücke für den Kon-
zertsaal gewonnen, die ihre Wirkung
bei gehöriger Wiedergabe nicht ver-
fehlen können. S.