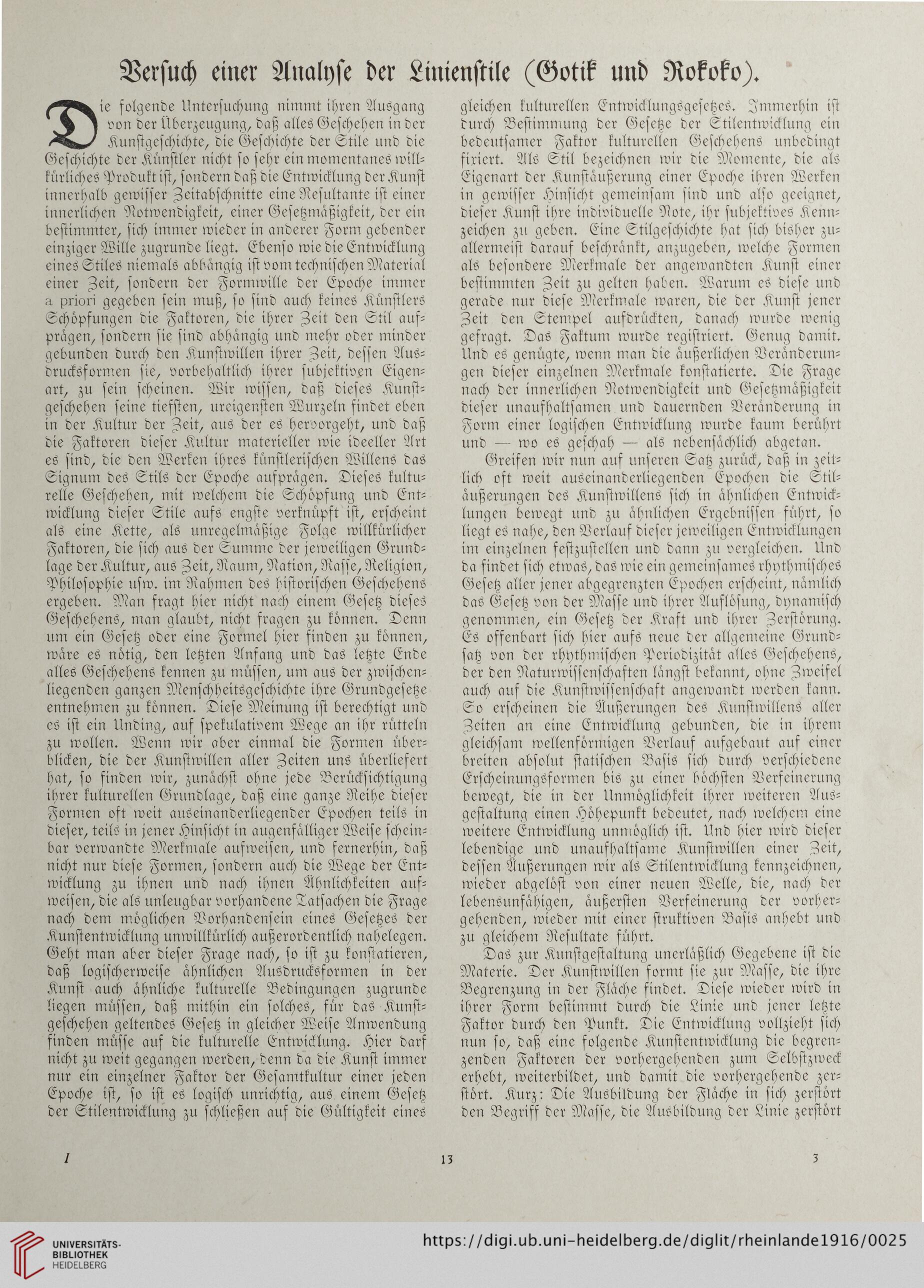Versuch einer Analyse der Linienstile (Gotik und Rokoko).
ie folgende Untersuchung nimmt ihren Ausgang
von der Überzeugung, daß alles Geschehen in der
Kunstgeschichte, die Geschichte der Stile und die
Geschichte der Künstler nicht so sehr ein momentanes will-
kürliches Produkt ist, sondern daß die Entwicklung der Kunst
innerhalb gewisser Zeitabschnitte eine Resultante ist einer
innerlichen Notwendigkeit, einer Gesetzmäßigkeit, der ein
bestimmter, sich immer wieder in anderer Form gebender
einziger Wille zugrunde liegt. Ebenso wie die Entwicklung
eines Stiles niemals abhängig ist vom technischen Material
einer Zeit, sondern der Formwille der Epoche immer
n priori gegeben sein muß, so sind auch keines Künstlers
Schöpfungen die Faktoren, die ihrer Zeit den Stil auf-
pragen, sondern sie sind abhängig und mehr oder minder
gebunden durch den Kunstwillen ihrer Zeit, dessen Aus-
drucksformen sie, vorbehaltlich ihrer subjektiven Eigen-
art, zu sein scheinen. Wir wissen, daß dieses Kunst-
geschehen seine tiefsten, ureigensten Wurzeln findet eben
in der Kultur der Zeit, aus der es hervorgeht, und daß
die Faktoren dieser Kultur materieller wie ideeller Art
es sind, die den Werken ihres künstlerischen Willens das
Signum des Stils der Epoche aufprägen. Dieses kultu-
relle Geschehen, mit welchem die Schöpfung und Ent-
wicklung dieser Stile aufs engste verknüpft ist, erscheint
als eine Kette, als unregelmäßige Folge willkürlicher
Faktoren, die sich aus der Summe der jeweiligen Grund-
lage der Kultur, aus Zeit, Raum, Nation, Nasse, Religion,
Philosophie usw. im Nahmen des historischen Geschehens
ergeben. Man fragt hier nicht nach einem Gesetz dieses
Geschehens, man glaubt, nicht fragen zu können. Denn
um ein Gesetz oder eine Formel hier finden zu können,
wäre es nötig, den letzten Anfang und das letzte Ende
alles Geschehens kennen zu müssen, um aus der zwischen-
liegenden ganzen Menschheitsgeschichte ihre Grundgesetze
entnehmen zu können. Diese Meinung ist berechtigt und
cs ist ein Unding, auf spekulativem Wege an ihr rütteln
zu wollen. Wenn wir aber einmal die Formen über-
blicken, die der Kunstwillen aller Zeiten uns überliefert
hat, so finden wir, zunächst ohne jede Berücksichtigung
ihrer kulturellen Grundlage, daß eine ganze Reihe dieser
Formen oft weit auseinanderliegender Epochen teils in
dieser, teils in jener Hinsicht in augenfälliger Weise schein-
bar verwandte Merkmale aufweisen, und fernerhin, daß
nicht nur diese Formen, sondern auch die Wege der Ent-
wicklung zu ihnen und nach ihnen Ähnlichkeiten auf-
weisen, die als unleugbar vorhandene Tatsachen die Frage
nach dem möglichen Vorhandensein eines Gesetzes der
Kunstentwicklung unwillkürlich außerordentlich nahelegen.
Geht man aber dieser Frage nach, so ist zu konstatieren,
daß logischerweise ähnlichen Ausdrucksformen in der
Kunst auch ähnliche kulturelle Bedingungen zugrunde
liegen müssen, daß mithin ein solches, für das Kunst-
geschehen geltendes Gesetz in gleicher Weise Anwendung
finden müsse auf die kulturelle Entwicklung. Hier darf
nicht zu weit gegangen werden, denn da die Kunst immer
nur ein einzelner Faktor der Gesamtkultur einer jeden
Epoche ist, so ist es logiscb unrichtig, aus einein Gesetz
der Stilentwicklung zu schließen auf die Gültigkeit eines
gleichen kulturellen Entwicklungsgesetzes. Immerhin ist
durch Bestimmung der Gesetze der Ctilentwicklung ein
bedeutsamer Faktor kulturellen Geschehens unbedingt
fixiert. Als Stil bezeichnen wir die Momente, die als
Eigenart der Kunstäußerung einer Epoche ihren Werken
in gewisser Hinsicht gemeinsam sind und also geeignet,
dieser Kunst ihre individuelle Note, ihr subjektives Kenn-
zeichen zu geben. Eine Ctilgeschichte hat sich bisher zu-
allermeist darauf beschränkt, anzugeben, welche Formen
als besondere Merkmale der angewandten Kunst einer
bestimmten Zeit zu gelten haben. Warum es diese und
gerade nur diese Merkmale waren, die der Kunst jener
Zeit den Stempel aufdrückten, danach wurde wenig
gefragt. Das Faktuni wurde registriert. Genug damit.
Und es genügte, wenn man die äußerlichen Veränderun-
gen dieser einzelnen Merkmale konstatierte. Die Frage
nach der innerlichen Notwendigkeit und Gesetzmäßigkeit
dieser unaufhaltsamen und dauernden Veränderung in
Form einer logischen Entwicklung wurde kaum berührt
und — wo es geschah — als nebensächlich abgetan.
Greifen wir nun auf unseren Satz zurück, daß in zeit-
lich oft weit auseinanderliegenden Epochen die Stil-
äußerungen des Kunstwillens sich in ähnlichen Entwick-
lungen bewegt und zu ähnlichen Ergebnissen führt, so
liegt es nahe, den Verlauf dieser jeweiligen Entwicklungen
im einzelnen festzustcllen und dann zu vergleichen. Und
da findet sich etwas, das wie ein gemeinsames rhythmisches
Gesetz aller jener abgegrenzten Epochen erscheint, nämlich
das Gesetz von der Masse und ihrer Auflösung, dynamisch
genommen, ein Gesetz der Kraft und ihrer Zerstörung.
Es offenbart sich hier aufs neue der allgemeine Grund-
satz von der rhythmischen Periodizität alles Geschehens,
der den Naturwissenschaften längst bekannt, ohne Zweifel
auch auf die Kunstwissenschaft angewandt werden kann.
So erscheinen die Äußerungen des Kunstwillens aller
Zeiten an eine Entwicklung gebunden, die in ihrem
gleichsam wellenförmigen Verlauf aufgebaut auf einer
breiten absolut statischen Basis sich durch verschiedene
Erscheinungsformen bis zu einer höchsten Verfeinerung
bewegt, die in der Unmöglichkeit ihrer weiteren Aus-
gestaltung einen Höhepunkt bedeutet, nach welchem eine
weitere Entwicklung unmöglich ist. Und hier wird dieser
lebendige und unaufhaltsame Kunstwillen einer Zeit,
dessen Äußerungen wir als Stilentwicklung kennzeichnen,
wieder abgelöst von einer neuen Welle, die, nach der
lebensunfähigen, äußersten Verfeinerung der vorher-
gehenden, wieder mit einer struktiven Basis anhebt und
zu gleichem Resultate führt.
Das zur Kunstgestaltung unerläßlich Gegebene ist die
Materie. Der Kunstwillen formt sie zur Masse, die ihre
Begrenzung in der Fläche findet. Diese wieder wird in
ihrer Form bestimmt durch die Linie und jener letzte
Faktor durch den Punkt. Die Entwicklung vollzieht sich
nun so, daß eine folgende Kunstentwicklung die begren-
zenden Faktoren der vorhergehenden zum Selbstzweck
erhebt, weiterbildet, und damit die vorhergehende zer-
stört. Kurz: Die Ausbildung der Fläche in sich zerstört
den Begriff der Masse, die Ausbildung der Linie zerstört
ie folgende Untersuchung nimmt ihren Ausgang
von der Überzeugung, daß alles Geschehen in der
Kunstgeschichte, die Geschichte der Stile und die
Geschichte der Künstler nicht so sehr ein momentanes will-
kürliches Produkt ist, sondern daß die Entwicklung der Kunst
innerhalb gewisser Zeitabschnitte eine Resultante ist einer
innerlichen Notwendigkeit, einer Gesetzmäßigkeit, der ein
bestimmter, sich immer wieder in anderer Form gebender
einziger Wille zugrunde liegt. Ebenso wie die Entwicklung
eines Stiles niemals abhängig ist vom technischen Material
einer Zeit, sondern der Formwille der Epoche immer
n priori gegeben sein muß, so sind auch keines Künstlers
Schöpfungen die Faktoren, die ihrer Zeit den Stil auf-
pragen, sondern sie sind abhängig und mehr oder minder
gebunden durch den Kunstwillen ihrer Zeit, dessen Aus-
drucksformen sie, vorbehaltlich ihrer subjektiven Eigen-
art, zu sein scheinen. Wir wissen, daß dieses Kunst-
geschehen seine tiefsten, ureigensten Wurzeln findet eben
in der Kultur der Zeit, aus der es hervorgeht, und daß
die Faktoren dieser Kultur materieller wie ideeller Art
es sind, die den Werken ihres künstlerischen Willens das
Signum des Stils der Epoche aufprägen. Dieses kultu-
relle Geschehen, mit welchem die Schöpfung und Ent-
wicklung dieser Stile aufs engste verknüpft ist, erscheint
als eine Kette, als unregelmäßige Folge willkürlicher
Faktoren, die sich aus der Summe der jeweiligen Grund-
lage der Kultur, aus Zeit, Raum, Nation, Nasse, Religion,
Philosophie usw. im Nahmen des historischen Geschehens
ergeben. Man fragt hier nicht nach einem Gesetz dieses
Geschehens, man glaubt, nicht fragen zu können. Denn
um ein Gesetz oder eine Formel hier finden zu können,
wäre es nötig, den letzten Anfang und das letzte Ende
alles Geschehens kennen zu müssen, um aus der zwischen-
liegenden ganzen Menschheitsgeschichte ihre Grundgesetze
entnehmen zu können. Diese Meinung ist berechtigt und
cs ist ein Unding, auf spekulativem Wege an ihr rütteln
zu wollen. Wenn wir aber einmal die Formen über-
blicken, die der Kunstwillen aller Zeiten uns überliefert
hat, so finden wir, zunächst ohne jede Berücksichtigung
ihrer kulturellen Grundlage, daß eine ganze Reihe dieser
Formen oft weit auseinanderliegender Epochen teils in
dieser, teils in jener Hinsicht in augenfälliger Weise schein-
bar verwandte Merkmale aufweisen, und fernerhin, daß
nicht nur diese Formen, sondern auch die Wege der Ent-
wicklung zu ihnen und nach ihnen Ähnlichkeiten auf-
weisen, die als unleugbar vorhandene Tatsachen die Frage
nach dem möglichen Vorhandensein eines Gesetzes der
Kunstentwicklung unwillkürlich außerordentlich nahelegen.
Geht man aber dieser Frage nach, so ist zu konstatieren,
daß logischerweise ähnlichen Ausdrucksformen in der
Kunst auch ähnliche kulturelle Bedingungen zugrunde
liegen müssen, daß mithin ein solches, für das Kunst-
geschehen geltendes Gesetz in gleicher Weise Anwendung
finden müsse auf die kulturelle Entwicklung. Hier darf
nicht zu weit gegangen werden, denn da die Kunst immer
nur ein einzelner Faktor der Gesamtkultur einer jeden
Epoche ist, so ist es logiscb unrichtig, aus einein Gesetz
der Stilentwicklung zu schließen auf die Gültigkeit eines
gleichen kulturellen Entwicklungsgesetzes. Immerhin ist
durch Bestimmung der Gesetze der Ctilentwicklung ein
bedeutsamer Faktor kulturellen Geschehens unbedingt
fixiert. Als Stil bezeichnen wir die Momente, die als
Eigenart der Kunstäußerung einer Epoche ihren Werken
in gewisser Hinsicht gemeinsam sind und also geeignet,
dieser Kunst ihre individuelle Note, ihr subjektives Kenn-
zeichen zu geben. Eine Ctilgeschichte hat sich bisher zu-
allermeist darauf beschränkt, anzugeben, welche Formen
als besondere Merkmale der angewandten Kunst einer
bestimmten Zeit zu gelten haben. Warum es diese und
gerade nur diese Merkmale waren, die der Kunst jener
Zeit den Stempel aufdrückten, danach wurde wenig
gefragt. Das Faktuni wurde registriert. Genug damit.
Und es genügte, wenn man die äußerlichen Veränderun-
gen dieser einzelnen Merkmale konstatierte. Die Frage
nach der innerlichen Notwendigkeit und Gesetzmäßigkeit
dieser unaufhaltsamen und dauernden Veränderung in
Form einer logischen Entwicklung wurde kaum berührt
und — wo es geschah — als nebensächlich abgetan.
Greifen wir nun auf unseren Satz zurück, daß in zeit-
lich oft weit auseinanderliegenden Epochen die Stil-
äußerungen des Kunstwillens sich in ähnlichen Entwick-
lungen bewegt und zu ähnlichen Ergebnissen führt, so
liegt es nahe, den Verlauf dieser jeweiligen Entwicklungen
im einzelnen festzustcllen und dann zu vergleichen. Und
da findet sich etwas, das wie ein gemeinsames rhythmisches
Gesetz aller jener abgegrenzten Epochen erscheint, nämlich
das Gesetz von der Masse und ihrer Auflösung, dynamisch
genommen, ein Gesetz der Kraft und ihrer Zerstörung.
Es offenbart sich hier aufs neue der allgemeine Grund-
satz von der rhythmischen Periodizität alles Geschehens,
der den Naturwissenschaften längst bekannt, ohne Zweifel
auch auf die Kunstwissenschaft angewandt werden kann.
So erscheinen die Äußerungen des Kunstwillens aller
Zeiten an eine Entwicklung gebunden, die in ihrem
gleichsam wellenförmigen Verlauf aufgebaut auf einer
breiten absolut statischen Basis sich durch verschiedene
Erscheinungsformen bis zu einer höchsten Verfeinerung
bewegt, die in der Unmöglichkeit ihrer weiteren Aus-
gestaltung einen Höhepunkt bedeutet, nach welchem eine
weitere Entwicklung unmöglich ist. Und hier wird dieser
lebendige und unaufhaltsame Kunstwillen einer Zeit,
dessen Äußerungen wir als Stilentwicklung kennzeichnen,
wieder abgelöst von einer neuen Welle, die, nach der
lebensunfähigen, äußersten Verfeinerung der vorher-
gehenden, wieder mit einer struktiven Basis anhebt und
zu gleichem Resultate führt.
Das zur Kunstgestaltung unerläßlich Gegebene ist die
Materie. Der Kunstwillen formt sie zur Masse, die ihre
Begrenzung in der Fläche findet. Diese wieder wird in
ihrer Form bestimmt durch die Linie und jener letzte
Faktor durch den Punkt. Die Entwicklung vollzieht sich
nun so, daß eine folgende Kunstentwicklung die begren-
zenden Faktoren der vorhergehenden zum Selbstzweck
erhebt, weiterbildet, und damit die vorhergehende zer-
stört. Kurz: Die Ausbildung der Fläche in sich zerstört
den Begriff der Masse, die Ausbildung der Linie zerstört