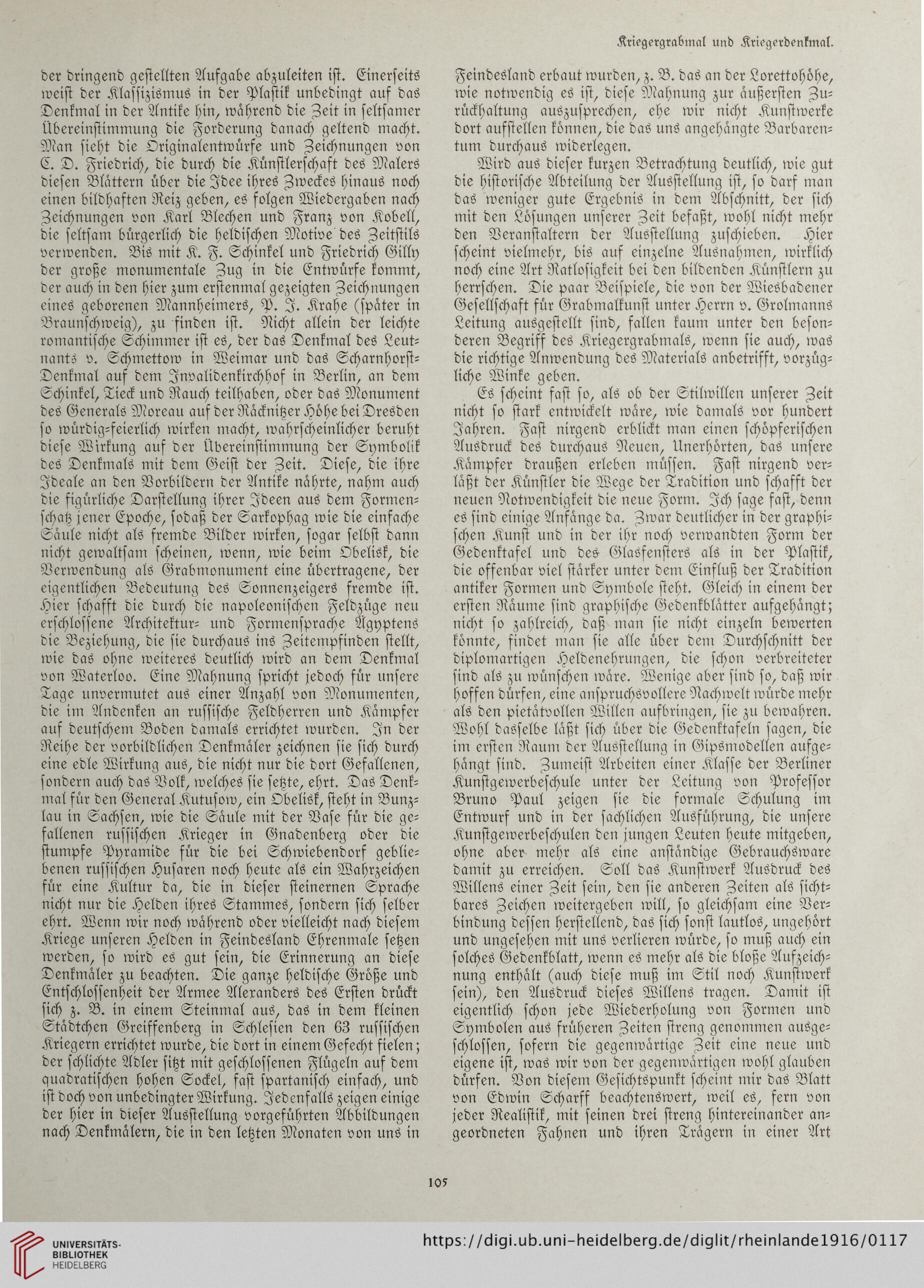Kriegergrabmal und Kriegerdenkmal.
der dringend gestellten Aufgabe abzuleiten ist. Einerseits
weist der Klassizismus in der Plastik unbedingt auf das
Denkmal in der Antike hin, während die Zeit in seltsamer
Übereinstimmung die Forderung danach geltend macht.
Man sieht die Originalentwürfe und Zeichnungen von
C. D. Friedrich, die durch die Künstlerschaft des Malers
diesen Blattern über die Idee ihres Zweckes hinaus noch
einen bildhaften Reiz geben, es folgen Wiedergaben nach
Zeichnungen von Karl Blechen und Franz von Kobell,
die seltsam bürgerlich die heldischen Motive des Zeitstils
verwenden. Bis mit K. F. Schinkel und Friedrich Gilly
der große monumentale Zug in die Entwürfe kommt,
der auch in den hier zum erstenmal gezeigten Zeichnungen
eines geborenen Mannheimers, P. I. Krähe (später in
Braunschweig), zu finden ist. Nicht allein der leichte
romantische Schimmer ist es, der das Denkmal des Leut-
nants v. Schmettow in Weimar und das Scharnhorst-
Denkmal auf dem Jnvalidenkirchhof in Berlin, an dem
Schinkel, Tieck und Rauch teilhaben, oder das Monument
des Generals Moreau auf der Räcknitzer Höhe bei Dresden
so würdig-feierlich wirken macht, wahrscheinlicher beruht
diese Wirkung auf der Übereinstimmung der Symbolik
des Denkmals mit dem Geist der Zeit. Diese, die ihre
Ideale an den Vorbildern der Antike nährte, nahm auch
die figürliche Darstellung ihrer Ideen aus dem Formen-
schatz jener Epoche, sodaß der Sarkophag wie die einfache
Säule nicht als fremde Bilder wirken, sogar selbst dann
nicht gewaltsam scheinen, wenn, wie beim Obelisk, die
Verwendung als Grabmonument eine übertragene, der
eigentlichen Bedeutung des Sonnenzeigers fremde ist.
Hier schafft die durch die napoleonischen Feldzüge neu
erschlossene Architektur- und Formensprache Ägyptens
die Beziehung, die sie durchaus ins Zeitempfinden stellt,
wie das ohne weiteres deutlich wird an dem Denkmal
von Waterloo. Eine Mahnung spricht jedoch für unsere
Tage unvermutet aus einer Anzahl von Monumenten,
die im Andenken an russische Feldherren und Kämpfer
auf deutschen! Boden damals errichtet wurden. In der
Reihe der vorbildlichen Denkmäler zeichnen sie sich durch
eine edle Wirkung aus, die nicht nur die dort Gefallenen,
sondern auch das Volk, welches sie setzte, ehrt. Das Denk-
mal für den General Kutusow, ein Obelisk, steht in Bunz-
lau in Sachsen, wie die Säule mit der Vase für die ge-
fallenen russischen Krieger in Gnadenberg oder die
stumpfe Pyramide für die bei Schwiebendorf geblie-
benen russischen Husaren noch heute als ein Wahrzeichen
für eine Kultur da, die in dieser steinernen Sprache
nicht nur die Helden ihres Stammes, sondern sich selber
ehrt. Wenn wir noch während oder vielleicht nach diesem
Kriege unseren Helden in Feindesland Ehrenmale setzen
werden, so wird es gut sein, die Erinnerung an diese
Denkmäler zu beachten. Die ganze heldische Größe und
Entschlossenheit der Armee Alexanders des Ersten drückt
sich z. B. in einem Steinmal aus, das in dem kleinen
Städtchen Greiffenberg in Schlesien den 63 russischen
Kriegern errichtet wurde, die dort in einem Gefecht fielen;
der schlichte Adler sitzt mit geschlossenen Flügeln auf dem
quadratischen hohen Sockel, fast spartanisch einfach, und
ist doch von unbedingter Wirkung. Jedenfalls zeigen einige
der hier in dieser Ausstellung vorgeführten Abbildungen
nach Denkmälern, die in den letzten Monaten von uns in
Feindesland erbaut wurden, z. B. das an der Lorettohöhe,
wie notwendig es ist, diese Mahnung zur äußersten Zu-
rückhaltung auszusprechen, ehe wir nicht Kunstwerke
dort aufstellen können, die das uns angehängte Barbaren-
tum durchaus widerlegen.
Wird aus dieser kurzen Betrachtung deutlich, wie gut
die historische Abteilung der Ausstellung ist, so darf man
das weniger gute Ergebnis in dem Abschnitt, der sich
mit den Lösungen unserer Zeit befaßt, wohl nicht mehr
den Veranstaltern der Ausstellung zuschieben. Hier
scheint vielmehr, bis auf einzelne Ausnahmen, wirklich
noch eine Art Ratlosigkeit bei den bildenden Künstlern zu
herrschen. Die paar Beispiele, die von der Wiesbadener
Gesellschaft für Grabmalkunst unter Herrn v. Grolmanns
Leitung ausgestellt sind, fallen kaum unter den beson-
deren Begriff des Kriegergrabmals, wenn sie auch, was
die richtige Anwendung des Materials anbetrifft, vorzüg-
liche Winke geben.
Es scheint fast so, als ob der Stilwillen unserer Zeit
nicht so stark entwickelt wäre, wie damals vor hundert
Jahren. Fast nirgend erblickt man einen schöpferischen
Ausdruck des durchaus Neuen, Unerhörten, das unsere
Kämpfer draußen erleben müssen. Fast nirgend ver-
läßt der Künstler die Wege der Tradition und schafft der
neuen Notwendigkeit die neue Form. Ich sage fast, denn
es sind einige Anfänge da. Zwar deutlicher in der graphi-
schen Kunst und in der ihr noch verwandten Form der
Gedenktafel und des- Glasfensters als in der Plastik,
die offenbar viel stärker unter dem Einfluß der Tradition
antiker Formen und Symbole steht. Gleich in einem der
ersten Räume sind graphische Gedenkblätter aufgehängt;
nicht so zahlreich, daß man sie nicht einzeln bewerten
könnte, findet man sie alle über dem Durchschnitt der
diplomartigen Heldenehrungen, die schon verbreiteter
sind als zu wünschen wäre. Wenige aber sind so, daß wir
hoffen dürfen, eine anspruchsvollere Nachwelt würde mehr
als den pietätvollen Willen aufbringen, sie zu bewahren.
Wohl dasselbe läßt sich über die Gedenktafeln sagen, die
im ersten Raum der Ausstellung in Gipsmodellen aufge-
hängt sind. Zumeist Arbeiten einer Klasse der Berliner
Kunstgewerbeschule unter der Leitung von Professor
Bruno Paul zeigen sie die formale Schulung im
Entwurf und in der sachlichen Ausführung, die unsere
Kunstgewerbeschulen den jungen Leuten heute mitgeben,
ohne aber mehr als eine anständige Gebrauchsware
damit zu erreichen. Soll das Kunstwerk Ausdruck des
Willens einer Zeit sein, den sie anderen Zeiten als sicht-
bares Zeichen weitergeben will, so gleichsam eine Ver-
bindung dessen herstellend, das sich sonst lautlos, ungehört
und ungesehen mit uns verlieren würde, so muß auch ein
solches Gedenkblatt, wenn es mehr als die bloße Aufzeich-
nung enthält (auch diese muß im Stil noch Kunstwerk
sein), den Ausdruck dieses Willens tragen. Damit ist
eigentlich schon jede Wiederholung von Formen und
Symbolen aus früheren Zeiten streng genommen ausge-
schlossen, sofern die gegenwärtige Zeit eine neue und
eigene ist, was wir von der gegenwärtigen wohl glauben
dürfen. Von diesen! Gesichtspunkt scheint mir das Blatt
von Edwin Scharff beachtenswert, weil es, fern von
jeder Realistik, mit seinen drei streng hintereinander an-
geordneten Fahnen und ihren Trägern in einer Art
105
der dringend gestellten Aufgabe abzuleiten ist. Einerseits
weist der Klassizismus in der Plastik unbedingt auf das
Denkmal in der Antike hin, während die Zeit in seltsamer
Übereinstimmung die Forderung danach geltend macht.
Man sieht die Originalentwürfe und Zeichnungen von
C. D. Friedrich, die durch die Künstlerschaft des Malers
diesen Blattern über die Idee ihres Zweckes hinaus noch
einen bildhaften Reiz geben, es folgen Wiedergaben nach
Zeichnungen von Karl Blechen und Franz von Kobell,
die seltsam bürgerlich die heldischen Motive des Zeitstils
verwenden. Bis mit K. F. Schinkel und Friedrich Gilly
der große monumentale Zug in die Entwürfe kommt,
der auch in den hier zum erstenmal gezeigten Zeichnungen
eines geborenen Mannheimers, P. I. Krähe (später in
Braunschweig), zu finden ist. Nicht allein der leichte
romantische Schimmer ist es, der das Denkmal des Leut-
nants v. Schmettow in Weimar und das Scharnhorst-
Denkmal auf dem Jnvalidenkirchhof in Berlin, an dem
Schinkel, Tieck und Rauch teilhaben, oder das Monument
des Generals Moreau auf der Räcknitzer Höhe bei Dresden
so würdig-feierlich wirken macht, wahrscheinlicher beruht
diese Wirkung auf der Übereinstimmung der Symbolik
des Denkmals mit dem Geist der Zeit. Diese, die ihre
Ideale an den Vorbildern der Antike nährte, nahm auch
die figürliche Darstellung ihrer Ideen aus dem Formen-
schatz jener Epoche, sodaß der Sarkophag wie die einfache
Säule nicht als fremde Bilder wirken, sogar selbst dann
nicht gewaltsam scheinen, wenn, wie beim Obelisk, die
Verwendung als Grabmonument eine übertragene, der
eigentlichen Bedeutung des Sonnenzeigers fremde ist.
Hier schafft die durch die napoleonischen Feldzüge neu
erschlossene Architektur- und Formensprache Ägyptens
die Beziehung, die sie durchaus ins Zeitempfinden stellt,
wie das ohne weiteres deutlich wird an dem Denkmal
von Waterloo. Eine Mahnung spricht jedoch für unsere
Tage unvermutet aus einer Anzahl von Monumenten,
die im Andenken an russische Feldherren und Kämpfer
auf deutschen! Boden damals errichtet wurden. In der
Reihe der vorbildlichen Denkmäler zeichnen sie sich durch
eine edle Wirkung aus, die nicht nur die dort Gefallenen,
sondern auch das Volk, welches sie setzte, ehrt. Das Denk-
mal für den General Kutusow, ein Obelisk, steht in Bunz-
lau in Sachsen, wie die Säule mit der Vase für die ge-
fallenen russischen Krieger in Gnadenberg oder die
stumpfe Pyramide für die bei Schwiebendorf geblie-
benen russischen Husaren noch heute als ein Wahrzeichen
für eine Kultur da, die in dieser steinernen Sprache
nicht nur die Helden ihres Stammes, sondern sich selber
ehrt. Wenn wir noch während oder vielleicht nach diesem
Kriege unseren Helden in Feindesland Ehrenmale setzen
werden, so wird es gut sein, die Erinnerung an diese
Denkmäler zu beachten. Die ganze heldische Größe und
Entschlossenheit der Armee Alexanders des Ersten drückt
sich z. B. in einem Steinmal aus, das in dem kleinen
Städtchen Greiffenberg in Schlesien den 63 russischen
Kriegern errichtet wurde, die dort in einem Gefecht fielen;
der schlichte Adler sitzt mit geschlossenen Flügeln auf dem
quadratischen hohen Sockel, fast spartanisch einfach, und
ist doch von unbedingter Wirkung. Jedenfalls zeigen einige
der hier in dieser Ausstellung vorgeführten Abbildungen
nach Denkmälern, die in den letzten Monaten von uns in
Feindesland erbaut wurden, z. B. das an der Lorettohöhe,
wie notwendig es ist, diese Mahnung zur äußersten Zu-
rückhaltung auszusprechen, ehe wir nicht Kunstwerke
dort aufstellen können, die das uns angehängte Barbaren-
tum durchaus widerlegen.
Wird aus dieser kurzen Betrachtung deutlich, wie gut
die historische Abteilung der Ausstellung ist, so darf man
das weniger gute Ergebnis in dem Abschnitt, der sich
mit den Lösungen unserer Zeit befaßt, wohl nicht mehr
den Veranstaltern der Ausstellung zuschieben. Hier
scheint vielmehr, bis auf einzelne Ausnahmen, wirklich
noch eine Art Ratlosigkeit bei den bildenden Künstlern zu
herrschen. Die paar Beispiele, die von der Wiesbadener
Gesellschaft für Grabmalkunst unter Herrn v. Grolmanns
Leitung ausgestellt sind, fallen kaum unter den beson-
deren Begriff des Kriegergrabmals, wenn sie auch, was
die richtige Anwendung des Materials anbetrifft, vorzüg-
liche Winke geben.
Es scheint fast so, als ob der Stilwillen unserer Zeit
nicht so stark entwickelt wäre, wie damals vor hundert
Jahren. Fast nirgend erblickt man einen schöpferischen
Ausdruck des durchaus Neuen, Unerhörten, das unsere
Kämpfer draußen erleben müssen. Fast nirgend ver-
läßt der Künstler die Wege der Tradition und schafft der
neuen Notwendigkeit die neue Form. Ich sage fast, denn
es sind einige Anfänge da. Zwar deutlicher in der graphi-
schen Kunst und in der ihr noch verwandten Form der
Gedenktafel und des- Glasfensters als in der Plastik,
die offenbar viel stärker unter dem Einfluß der Tradition
antiker Formen und Symbole steht. Gleich in einem der
ersten Räume sind graphische Gedenkblätter aufgehängt;
nicht so zahlreich, daß man sie nicht einzeln bewerten
könnte, findet man sie alle über dem Durchschnitt der
diplomartigen Heldenehrungen, die schon verbreiteter
sind als zu wünschen wäre. Wenige aber sind so, daß wir
hoffen dürfen, eine anspruchsvollere Nachwelt würde mehr
als den pietätvollen Willen aufbringen, sie zu bewahren.
Wohl dasselbe läßt sich über die Gedenktafeln sagen, die
im ersten Raum der Ausstellung in Gipsmodellen aufge-
hängt sind. Zumeist Arbeiten einer Klasse der Berliner
Kunstgewerbeschule unter der Leitung von Professor
Bruno Paul zeigen sie die formale Schulung im
Entwurf und in der sachlichen Ausführung, die unsere
Kunstgewerbeschulen den jungen Leuten heute mitgeben,
ohne aber mehr als eine anständige Gebrauchsware
damit zu erreichen. Soll das Kunstwerk Ausdruck des
Willens einer Zeit sein, den sie anderen Zeiten als sicht-
bares Zeichen weitergeben will, so gleichsam eine Ver-
bindung dessen herstellend, das sich sonst lautlos, ungehört
und ungesehen mit uns verlieren würde, so muß auch ein
solches Gedenkblatt, wenn es mehr als die bloße Aufzeich-
nung enthält (auch diese muß im Stil noch Kunstwerk
sein), den Ausdruck dieses Willens tragen. Damit ist
eigentlich schon jede Wiederholung von Formen und
Symbolen aus früheren Zeiten streng genommen ausge-
schlossen, sofern die gegenwärtige Zeit eine neue und
eigene ist, was wir von der gegenwärtigen wohl glauben
dürfen. Von diesen! Gesichtspunkt scheint mir das Blatt
von Edwin Scharff beachtenswert, weil es, fern von
jeder Realistik, mit seinen drei streng hintereinander an-
geordneten Fahnen und ihren Trägern in einer Art
105