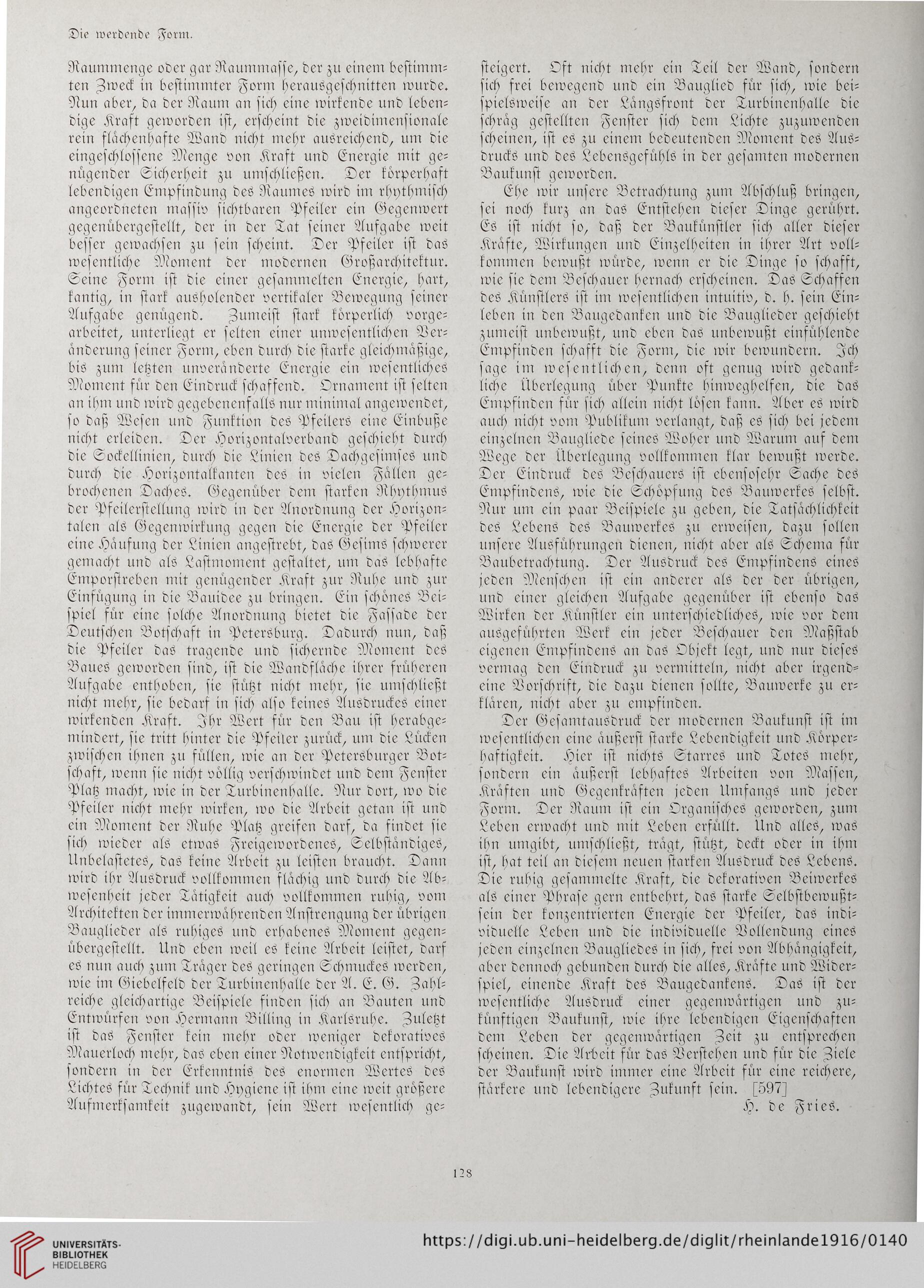Die werdende Fern:.
Raummenge oder gar Raummasse, der zu einem bestimm-
ten Aweck in bestimmter Form herausgeschnitten wurde.
Nun aber, da der Raum an sich eine wirkende und leben-
dige Kraft geworden ist, erscheint die zweidimensionale
rein flachenhafte Wand nicht mehr ausreichend, um die
eingeschlossene Menge von Kraft und Energie mit ge-
nügender Sicherheit zu umschließen. Der körperhaft
lebendigen Empfindung des Raumes wird im rhythmisch
angeordneten massiv sichtbaren Pfeiler ein Gegenwert
gegenübergestellt, der in der Tat seiner Aufgabe weit
besser gewachsen zu sein scheint. Der Pfeiler ist das
wesentliche Moment der modernen Großarchitektur.
Seine Form ist die einer gesammelten Energie, hart,
kantig, in stark ausholender vertikaler Bewegung seiner
Aufgabe genügend. Zumeist stark körperlich vorge-
arbeitet, unterliegt er selten einer unwesentlichen Ver-
änderung seiner Form, eben durch die starke gleichmäßige,
bis zum letzten unveränderte Energie ein wesentliches
Moment für den Eindruck schaffend. Ornament ist selten
an ihm und wird gegebenenfalls nur minimal angcwendet,
so daß Wesen und Funktion des Pfeilers eine Einbuße
nicht erleiden. Der Horizontalverband geschieht durch
die Sockellinien, durch die Linien des Dachgesimscs und
durch die Horizontalkanten des in vielen Fällen ge-
brochenen Daches. Gegenüber dem starken Rhythmus
der Pfeilerstcllung wird in der Anordnung der Horizon-
talen als Gegenwirkung gegen die Energie der Pfeiler
eine Häufung der Linien angestrebt, das Gesims schwerer
gemacht und als Lastmoment gestaltet, um das lebhafte
Emporstreben mit genügender Kraft zur Ruhe und zur
Einfügung in die Bauidee zu bringen. Ein schönes Bei-
spiel für eine solche Anordnung bietet die Fassade der
Deutschen Botschaft in Petersburg. Dadurch nun, daß
die Pfeiler das tragende und sichernde Moment des
Baues geworden sind, ist die Wandfläche ihrer früheren
Aufgabe enthoben, sie stützt nicht mehr, sie umschließt
nicht mehr, sie bedarf in sich also keines Ausdruckes einer-
wirkenden Kraft. Ihr Wert für den Bau ist herabge-
mindert, sie tritt hinter die Pfeiler zurück, um die Lücken
zwischen ilmen zu füllen, wie an der Petersburger Bot-
schaft, wenn sie nicht völlig verschwindet und dem Fenster-
Platz macht, wie in der Turbinenhalle. Nur dort, wo die
Pfeiler nicht mehr wirken, wo die Arbeit getan ist und
ein Moment der Ruhe Platz greifen darf, da findet sie
sich wieder als etwas Freigcwordenes, Selbständiges,
Unbelastetes, das keine Arbeit zu leisten braucht. Dann
wird ihr Ausdruck vollkommen flächig und durch die Ab-
wesenbeit jeder Tätigkeit auch vollkommen ruhig, vom
Architekten der immerwährenden Anstrengung der übrigen
Bauglieder als ruhiges und erhabenes Moment gegen-
übergestellt. Und eben weil es keine Arbeit leistet, darf
es nun auch zum Träger des geringen Schmuckes werden,
wie im Giebelfeld der Turbinenhalle der A. E. G. Zahl-
reiche gleichartige Beispiele finden sich an Bauten und
Entwürfen von Hermann Billing in Karlsruhe. Zuletzt
ist das Fenster kein mehr oder weniger dekoratives
Mauerloch mehr, das eben einer Notwendigkeit entspricht,
sondern in der Erkenntnis des enormen Wertes des
Lichtes für Technik und Hygiene ist ibm eine weit größere
Aufmerksamkeit zugewandt, sein Wert wesentlich ge-
steigert. Oft nicht mehr ein Teil der Wand, sondern
sich frei bewegend und ein Bauglied für sich, wie bei-
spielsweise an der Längsfront der Turbinenhalle die
fchräg gestellten Fenster sich dem Lichte zuzuwenden
fcheinen, ist es zu einem bedeutenden Moment des Aus-
drucks und des Lebensgefühls in der gesamten modernen
Baukunst geworden.
Ehe wir unsere Betrachtung zum Abschluß bringen,
sei noch kurz an das Entstehen dieser Dinge gerührt.
Es ist nicht so, daß der Baukünstler sich aller dieser
Kräfte, Wirkungen und Einzelheiten in ihrer Art voll-
kommen bewußt würde, wenn er die Dinge so schafft,
wie sie dem Beschauer hernach erscheinen. Das Schaffen
des Künstlers ist im wesentlichen intuitiv, d. h. sein Ein-
leben in den Baugedanken und die Bauglieder geschieht
zumeist unbewußt, und eben das unbewußt cinfühlende
Empfinden schafft die Form, die wir bewundern. Ich
sage im wesentlichen, denn oft genug wird gedank-
liche Überlegung über Punkte hinweghelfcn, die das
Empfinden für sich allein nicht lösen kann. Aber es wird
auch nicht vom Publikum verlangt, daß es sich bei jedem
einzelnen Baugliede seines Woher und Warum auf dem
Wege der Überlegung vollkommen klar bewußt werde.
Der Eindruck des Beschauers ist ebensosehr Sache des
Empfindens, wie die Schöpfung des Bauwerkes selbst.
Nur um ein paar Beispiele zu geben, die Tatsächlichkeit
des Lebens des Bauwerkes zu erweisen, dazu sollen
unsere Ausführungen dienen, nicht aber als Schema für
Baubetrachtung. Der Ausdruck des Empfindens eines
jeden Menschen ist ein anderer als der der übrigen,
und einer gleichen Aufgabe gegenüber ist ebenso das
Wirken der Künstler ein unterschiedliches, wie vor dem
ausgeführten Werk ein jeder Beschauer den Maßstab
eigenen Empfindens an das Objekt legt, und nur dieses
vermag den Eindruck zu vermitteln, nicht aber irgend-
eine Vorschrift, die dazu dienen sollte, Bauwerke zu er-
klären, nicht aber zu empfinden.
Der Gcsamtausdruck der modernen Baukunst ist im
wesentlichen eine äußerst starke Lebendigkeit und Körper-
haftigkcit. Hier ist nichts Starres und Totes mebr,
sondern ein äußerst lebhaftes Arbeiten von Massen,
Kräften und Gegenkräften jeden Umfangs und jeder
Form. Der Raum ist ein Organisches geworden, zum
Leben erwacht und mit Leben erfüllt. Und alles, was
ihn umgibt, umschließt, trägt, stützt, deckt oder in ihm
ist, hat teil an diesem neuen starken Ausdruck des Lebens.
Die ruhig gesammelte Kraft, die dekorativen Beiwerkes
als einer Phrase gern entbehrt, das starke Selbstbewußt-
sein der konzentrierten Energie der Pfeiler, das indi-
viduelle Leben und die individuelle Vollendung eines
jeden einzelnen Baugliedes in sich, frei von Abhängigkeit,
aber dennoch gebunden durch die alles, Kräfte und Wider-
spiel, einende Kraft des Baugedankens. Das ist der
wesentliche Ausdruck einer gegenwärtigen und zu-
künftigen Baukunst, wie ihre lebendigen Eigenschaften
dem Leben der gegenwärtigen Zeit zu entsprechen
scheinen. Die Arbeit für das Verstehen und für die Ziele
der Baukunst wird immer eine Arbeit für eine reichere,
stärkere und lebendigere Zukunft sein. s597sj
H. de Fries.
1^8
Raummenge oder gar Raummasse, der zu einem bestimm-
ten Aweck in bestimmter Form herausgeschnitten wurde.
Nun aber, da der Raum an sich eine wirkende und leben-
dige Kraft geworden ist, erscheint die zweidimensionale
rein flachenhafte Wand nicht mehr ausreichend, um die
eingeschlossene Menge von Kraft und Energie mit ge-
nügender Sicherheit zu umschließen. Der körperhaft
lebendigen Empfindung des Raumes wird im rhythmisch
angeordneten massiv sichtbaren Pfeiler ein Gegenwert
gegenübergestellt, der in der Tat seiner Aufgabe weit
besser gewachsen zu sein scheint. Der Pfeiler ist das
wesentliche Moment der modernen Großarchitektur.
Seine Form ist die einer gesammelten Energie, hart,
kantig, in stark ausholender vertikaler Bewegung seiner
Aufgabe genügend. Zumeist stark körperlich vorge-
arbeitet, unterliegt er selten einer unwesentlichen Ver-
änderung seiner Form, eben durch die starke gleichmäßige,
bis zum letzten unveränderte Energie ein wesentliches
Moment für den Eindruck schaffend. Ornament ist selten
an ihm und wird gegebenenfalls nur minimal angcwendet,
so daß Wesen und Funktion des Pfeilers eine Einbuße
nicht erleiden. Der Horizontalverband geschieht durch
die Sockellinien, durch die Linien des Dachgesimscs und
durch die Horizontalkanten des in vielen Fällen ge-
brochenen Daches. Gegenüber dem starken Rhythmus
der Pfeilerstcllung wird in der Anordnung der Horizon-
talen als Gegenwirkung gegen die Energie der Pfeiler
eine Häufung der Linien angestrebt, das Gesims schwerer
gemacht und als Lastmoment gestaltet, um das lebhafte
Emporstreben mit genügender Kraft zur Ruhe und zur
Einfügung in die Bauidee zu bringen. Ein schönes Bei-
spiel für eine solche Anordnung bietet die Fassade der
Deutschen Botschaft in Petersburg. Dadurch nun, daß
die Pfeiler das tragende und sichernde Moment des
Baues geworden sind, ist die Wandfläche ihrer früheren
Aufgabe enthoben, sie stützt nicht mehr, sie umschließt
nicht mehr, sie bedarf in sich also keines Ausdruckes einer-
wirkenden Kraft. Ihr Wert für den Bau ist herabge-
mindert, sie tritt hinter die Pfeiler zurück, um die Lücken
zwischen ilmen zu füllen, wie an der Petersburger Bot-
schaft, wenn sie nicht völlig verschwindet und dem Fenster-
Platz macht, wie in der Turbinenhalle. Nur dort, wo die
Pfeiler nicht mehr wirken, wo die Arbeit getan ist und
ein Moment der Ruhe Platz greifen darf, da findet sie
sich wieder als etwas Freigcwordenes, Selbständiges,
Unbelastetes, das keine Arbeit zu leisten braucht. Dann
wird ihr Ausdruck vollkommen flächig und durch die Ab-
wesenbeit jeder Tätigkeit auch vollkommen ruhig, vom
Architekten der immerwährenden Anstrengung der übrigen
Bauglieder als ruhiges und erhabenes Moment gegen-
übergestellt. Und eben weil es keine Arbeit leistet, darf
es nun auch zum Träger des geringen Schmuckes werden,
wie im Giebelfeld der Turbinenhalle der A. E. G. Zahl-
reiche gleichartige Beispiele finden sich an Bauten und
Entwürfen von Hermann Billing in Karlsruhe. Zuletzt
ist das Fenster kein mehr oder weniger dekoratives
Mauerloch mehr, das eben einer Notwendigkeit entspricht,
sondern in der Erkenntnis des enormen Wertes des
Lichtes für Technik und Hygiene ist ibm eine weit größere
Aufmerksamkeit zugewandt, sein Wert wesentlich ge-
steigert. Oft nicht mehr ein Teil der Wand, sondern
sich frei bewegend und ein Bauglied für sich, wie bei-
spielsweise an der Längsfront der Turbinenhalle die
fchräg gestellten Fenster sich dem Lichte zuzuwenden
fcheinen, ist es zu einem bedeutenden Moment des Aus-
drucks und des Lebensgefühls in der gesamten modernen
Baukunst geworden.
Ehe wir unsere Betrachtung zum Abschluß bringen,
sei noch kurz an das Entstehen dieser Dinge gerührt.
Es ist nicht so, daß der Baukünstler sich aller dieser
Kräfte, Wirkungen und Einzelheiten in ihrer Art voll-
kommen bewußt würde, wenn er die Dinge so schafft,
wie sie dem Beschauer hernach erscheinen. Das Schaffen
des Künstlers ist im wesentlichen intuitiv, d. h. sein Ein-
leben in den Baugedanken und die Bauglieder geschieht
zumeist unbewußt, und eben das unbewußt cinfühlende
Empfinden schafft die Form, die wir bewundern. Ich
sage im wesentlichen, denn oft genug wird gedank-
liche Überlegung über Punkte hinweghelfcn, die das
Empfinden für sich allein nicht lösen kann. Aber es wird
auch nicht vom Publikum verlangt, daß es sich bei jedem
einzelnen Baugliede seines Woher und Warum auf dem
Wege der Überlegung vollkommen klar bewußt werde.
Der Eindruck des Beschauers ist ebensosehr Sache des
Empfindens, wie die Schöpfung des Bauwerkes selbst.
Nur um ein paar Beispiele zu geben, die Tatsächlichkeit
des Lebens des Bauwerkes zu erweisen, dazu sollen
unsere Ausführungen dienen, nicht aber als Schema für
Baubetrachtung. Der Ausdruck des Empfindens eines
jeden Menschen ist ein anderer als der der übrigen,
und einer gleichen Aufgabe gegenüber ist ebenso das
Wirken der Künstler ein unterschiedliches, wie vor dem
ausgeführten Werk ein jeder Beschauer den Maßstab
eigenen Empfindens an das Objekt legt, und nur dieses
vermag den Eindruck zu vermitteln, nicht aber irgend-
eine Vorschrift, die dazu dienen sollte, Bauwerke zu er-
klären, nicht aber zu empfinden.
Der Gcsamtausdruck der modernen Baukunst ist im
wesentlichen eine äußerst starke Lebendigkeit und Körper-
haftigkcit. Hier ist nichts Starres und Totes mebr,
sondern ein äußerst lebhaftes Arbeiten von Massen,
Kräften und Gegenkräften jeden Umfangs und jeder
Form. Der Raum ist ein Organisches geworden, zum
Leben erwacht und mit Leben erfüllt. Und alles, was
ihn umgibt, umschließt, trägt, stützt, deckt oder in ihm
ist, hat teil an diesem neuen starken Ausdruck des Lebens.
Die ruhig gesammelte Kraft, die dekorativen Beiwerkes
als einer Phrase gern entbehrt, das starke Selbstbewußt-
sein der konzentrierten Energie der Pfeiler, das indi-
viduelle Leben und die individuelle Vollendung eines
jeden einzelnen Baugliedes in sich, frei von Abhängigkeit,
aber dennoch gebunden durch die alles, Kräfte und Wider-
spiel, einende Kraft des Baugedankens. Das ist der
wesentliche Ausdruck einer gegenwärtigen und zu-
künftigen Baukunst, wie ihre lebendigen Eigenschaften
dem Leben der gegenwärtigen Zeit zu entsprechen
scheinen. Die Arbeit für das Verstehen und für die Ziele
der Baukunst wird immer eine Arbeit für eine reichere,
stärkere und lebendigere Zukunft sein. s597sj
H. de Fries.
1^8