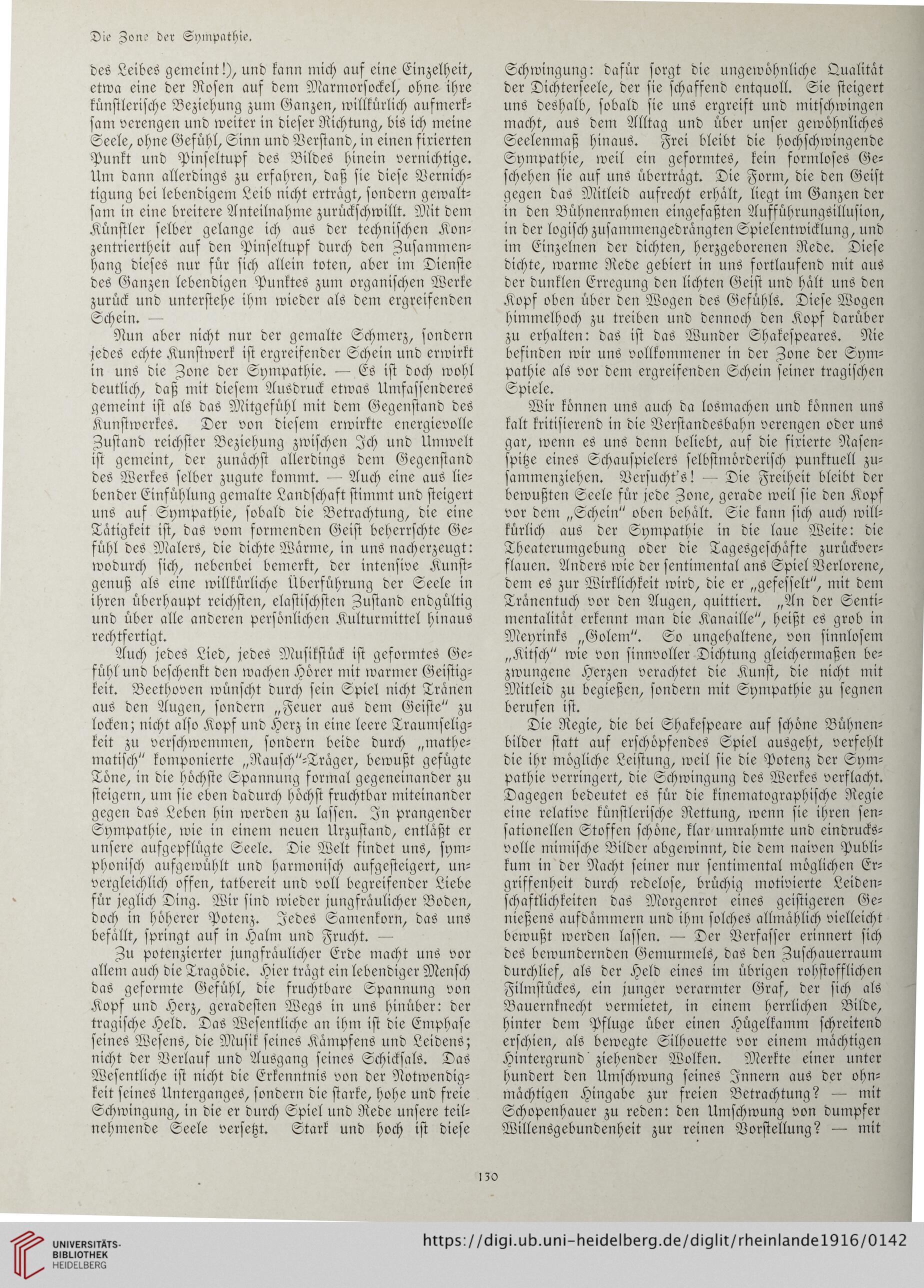Die Aon? der Sympathie.
des Leibes gemeint!), und kann mich auf eine Einzelheit,
etwa eine der Rosen auf dem Marmorsockel, ohne ihre
künstlerische Beziehung zum Ganzen, willkürlich aufmerk-
sam verengen und weiter in dieser Richtung, bis ich meine
Seele, ohne Gefühl, Sinn und Verstand, in einen fixierten
Punkt und Pinseltupf des Bildes hinein vernichtige.
Um dann allerdings zu erfahren, daß sie diese Vernich-
tigung bei lebendigem Leib nicht erträgt, sondern gewalt-
sam in eine breitere Anteilnahme zurückschwillt. Mit dem
Künstler selber gelange ich aus der technischen Kon-
zentriertheit auf den Pinseltupf durch den Zusammen-
hang dieses nur für sich allein toten, aber im Dienste
des Ganzen lebendigen Punktes zum organischen Werke
zurück und unterstehe ihm wieder als dem ergreifenden
Schein. —
Nun aber nicht nur der gemalte Schmerz, sondern
jedes echte Kunstwerk ist ergreifender Schein und erwirkt
in uns die Zone der Sympathie. — Es ist doch wohl
deutlich, daß mit diesem Ausdruck etwas Umfassenderes
gemeint ist als das Mitgefühl mit dem Gegenstand des
Kuustwerkes. Der von diesem erwirkte energievolle
Zustand reichster Beziehung zwischen Ich und Umwelt
ist gemeint, der zunächst allerdings dem Gegenstand
des Werkes selber zugute kommt. — Auch eine aus lie-
bender Einfühlung genialte Landschaft stimmt und steigert
uns auf Sympathie, sobald die Betrachtung, die eine
Tätigkeit ist, das vom formenden Geist beherrschte Ge-
fühl des Malers, die dichte Wärme, in uns nacherzeugt:
wodurch sich, nebenbei bemerkt, der intensive Kunst-
genuß als eine willkürliche Überführung der Seele in
ihren überhaupt reichsten, elastischsten Zustand endgültig
und über alle anderen persönlichen Kulturmittel hinaus
rechtfertigt.
Auch jedes Lied, jedes Musikstück ist geformtes Ge-
fühl und beschenkt den wachen Hörer nut warmer Geistig-
keit. Beethoven wünscht durch sein Spiel nicht Tränen
aus den Augen, sondern „Feuer aus dem Geiste" zu
locken; nicht also Kopf und Herz in eine leere Traumselig-
keit zu verschwemmen, sondern beide durch „mathe-
matisch" komponierte „Rausch"-Träger, bewußt gefügte
Töne, in die höchste Spannung formal gegeneinander zu
steigern, um sie eben dadurch höchst fruchtbar miteinander
gegen das Leben hin werden zu lassen. In prangender
Sympathie, wie in einem neuen Urzustand, entläßt er
unsere aufgepflügte Seele. Die Welt findet uns, sym-
phonisch aufgewühlt und harmonisch aufgesteigert, un-
vergleichlich offen, tatbereit und voll begreifender Liebe
für jeglich Ding. Wir sind wieder jungfräulicher Boden,
doch in höherer Potenz. Jedes Samenkorn, das uns
befällt, springt auf in Halm und Frucht. —
Zu potenzierter jungfräulicher Erde macht uns vor
allen: auch die Tragödie. Hier trägt ein lebendiger Mensch
das geformte Gefühl, die fruchtbare Spannung von
Kopf und Herz, geradesten Wegs in uns hinüber: der
tragische Held. Das Wesentliche an ihm ist die Emphase
seines Wesens, die Musik seines Kämpfens und Leidens;
nicht der Verlauf und Ausgang seines Schicksals. Das
Wesentliche ist nicht die Erkenntnis von der Notwendig-
keit seines Unterganges, sondern die starke, hohe und freie
Schwingung, in die er durch Spiel und Rede unsere teil-
nehmende Seele versetzt. Stark und hoch ist diese
Schwingung: dafür sorgt die ungewöhnliche Qualität
der Dichterseele, der sie schaffend entquoll. Sie steigert
uns deshalb, sobald sie uns ergreift und mitschwingen
macht, aus dem Alltag und über unser gewöhnliches
Seelenmaß hinaus. Frei bleibt die hochschwingende
Sympathie, weil ein geformtes, kein formloses Ge-
schehen sie auf uns überträgt. Die Form, die den Geist
gegen das Mitleid aufrecht erhält, liegt im Ganzen der
in den Bühnenrahmen eingefaßten Aufführungsillusion,
in der logisch zusamnwngedrängten Spielentwicklung, und
im Einzelnen der dichten, herzgeborenen Rede. Diese
dichte, warme Rede gebiert in uns fortlaufend mit aus
der dunklen Erregung den lichten Geist und hält uns den
Kopf oben über den Wogen des Gefühls. Diese Wogen
himmelhoch zu treiben und dennoch den Kopf darüber
zu erhalten: das ist das Wunder Shakespeares. Nie
befinden wir uns vollkommener in der Zone der Sym-
pathie als vor dem ergreifenden Schein seiner tragischen
Spiele.
Wir können uns auch da losmachen und können uns
kalt kritisierend in die Verstandesbahn verengen oder uns
gar, wenn es uns denn beliebt, auf die fixierte Nasen-
spitze eines Schauspielers selbstmörderisch punktuell zu-
fammenziehen. Versuches! — Die Freiheit bleibt der
bewußten Seele für jede Zone, gerade weil sie den Kopf
vor dem „Schein" oben behält. Sie kann sich auch will-
kürlich aus der Sympathie in die laue Weite: die
Theaterumgebung oder die Tagesgeschäfte zurückver-
flauen. Anders wie der sentimental ans Spiel Verlorene,
dem es zur Wirklichkeit wird, die er „gefesselt", mit dem
Tränentuch vor den Augen, quittiert. „An der Senti-
mentalität erkennt man die Kanaille", heißt es grob in
Meyrinks „Golem". So ungehaltene, von sinnlosem
„Kitsch" wie von sinnvoller Dichtung gleichermaßen be-
zwungene Herzen verachtet die Kunst, die nicht nut
Mitleid zu begießen, sondern mit Sympathie zu segnen
berufen ist.
Die Regie, die bei Shakespeare auf schöne Bühnen-
bilder statt auf erschöpfendes Spiel ausgeht, verfehlt
die ihr mögliche Leistung, weil sie die Potenz der Sym-
pathie verringert, die Schwingung des Werkes verflacht.
Dagegen bedeutet es für die kinematographische Regie
eine relative künstlerische Rettung, wenn sie ihren sen-
sationellen Stoffen schöne, klar umrahmte und eindrucks-
volle mimische Bilder abgewinnt, die dem naiven Publi-
kum in der Nacht seiner nur sentimental möglichen Er-
griffenheit durch redelose, brüchig motivierte Leiden-
schaftlichkeiten das Morgenrot eines geistigeren Ge-
nießens aufdämmern und ihm solches allmählich vielleicht
bewußt werden lassen. — Der Verfasser erinnert sich
des bewundernden Gemurmels, das den Zuschauerraum
durchlief, als der Held eines im übrigen rohstofflichen
Filmstückes, ein junger verarmter Graf, der sich als
Bauernknecht vermietet, in einem herrlichen Bilde,
hinter dem Pfluge über einen Hügelkamm schreitend
erschien, als bewegte Silhouette vor einem mächtigen
Hintergrund' ziehender Wolken. Merkte einer unter
hundert den Umschwung seines Innern aus der ohn-
mächtigen Hingabe zur freien Betrachtung? — mit
Schopenhauer zu reden: den Umschwung von dumpfer
Willensgebundenheit zur reinen Vorstellung? — mit
1Z0
des Leibes gemeint!), und kann mich auf eine Einzelheit,
etwa eine der Rosen auf dem Marmorsockel, ohne ihre
künstlerische Beziehung zum Ganzen, willkürlich aufmerk-
sam verengen und weiter in dieser Richtung, bis ich meine
Seele, ohne Gefühl, Sinn und Verstand, in einen fixierten
Punkt und Pinseltupf des Bildes hinein vernichtige.
Um dann allerdings zu erfahren, daß sie diese Vernich-
tigung bei lebendigem Leib nicht erträgt, sondern gewalt-
sam in eine breitere Anteilnahme zurückschwillt. Mit dem
Künstler selber gelange ich aus der technischen Kon-
zentriertheit auf den Pinseltupf durch den Zusammen-
hang dieses nur für sich allein toten, aber im Dienste
des Ganzen lebendigen Punktes zum organischen Werke
zurück und unterstehe ihm wieder als dem ergreifenden
Schein. —
Nun aber nicht nur der gemalte Schmerz, sondern
jedes echte Kunstwerk ist ergreifender Schein und erwirkt
in uns die Zone der Sympathie. — Es ist doch wohl
deutlich, daß mit diesem Ausdruck etwas Umfassenderes
gemeint ist als das Mitgefühl mit dem Gegenstand des
Kuustwerkes. Der von diesem erwirkte energievolle
Zustand reichster Beziehung zwischen Ich und Umwelt
ist gemeint, der zunächst allerdings dem Gegenstand
des Werkes selber zugute kommt. — Auch eine aus lie-
bender Einfühlung genialte Landschaft stimmt und steigert
uns auf Sympathie, sobald die Betrachtung, die eine
Tätigkeit ist, das vom formenden Geist beherrschte Ge-
fühl des Malers, die dichte Wärme, in uns nacherzeugt:
wodurch sich, nebenbei bemerkt, der intensive Kunst-
genuß als eine willkürliche Überführung der Seele in
ihren überhaupt reichsten, elastischsten Zustand endgültig
und über alle anderen persönlichen Kulturmittel hinaus
rechtfertigt.
Auch jedes Lied, jedes Musikstück ist geformtes Ge-
fühl und beschenkt den wachen Hörer nut warmer Geistig-
keit. Beethoven wünscht durch sein Spiel nicht Tränen
aus den Augen, sondern „Feuer aus dem Geiste" zu
locken; nicht also Kopf und Herz in eine leere Traumselig-
keit zu verschwemmen, sondern beide durch „mathe-
matisch" komponierte „Rausch"-Träger, bewußt gefügte
Töne, in die höchste Spannung formal gegeneinander zu
steigern, um sie eben dadurch höchst fruchtbar miteinander
gegen das Leben hin werden zu lassen. In prangender
Sympathie, wie in einem neuen Urzustand, entläßt er
unsere aufgepflügte Seele. Die Welt findet uns, sym-
phonisch aufgewühlt und harmonisch aufgesteigert, un-
vergleichlich offen, tatbereit und voll begreifender Liebe
für jeglich Ding. Wir sind wieder jungfräulicher Boden,
doch in höherer Potenz. Jedes Samenkorn, das uns
befällt, springt auf in Halm und Frucht. —
Zu potenzierter jungfräulicher Erde macht uns vor
allen: auch die Tragödie. Hier trägt ein lebendiger Mensch
das geformte Gefühl, die fruchtbare Spannung von
Kopf und Herz, geradesten Wegs in uns hinüber: der
tragische Held. Das Wesentliche an ihm ist die Emphase
seines Wesens, die Musik seines Kämpfens und Leidens;
nicht der Verlauf und Ausgang seines Schicksals. Das
Wesentliche ist nicht die Erkenntnis von der Notwendig-
keit seines Unterganges, sondern die starke, hohe und freie
Schwingung, in die er durch Spiel und Rede unsere teil-
nehmende Seele versetzt. Stark und hoch ist diese
Schwingung: dafür sorgt die ungewöhnliche Qualität
der Dichterseele, der sie schaffend entquoll. Sie steigert
uns deshalb, sobald sie uns ergreift und mitschwingen
macht, aus dem Alltag und über unser gewöhnliches
Seelenmaß hinaus. Frei bleibt die hochschwingende
Sympathie, weil ein geformtes, kein formloses Ge-
schehen sie auf uns überträgt. Die Form, die den Geist
gegen das Mitleid aufrecht erhält, liegt im Ganzen der
in den Bühnenrahmen eingefaßten Aufführungsillusion,
in der logisch zusamnwngedrängten Spielentwicklung, und
im Einzelnen der dichten, herzgeborenen Rede. Diese
dichte, warme Rede gebiert in uns fortlaufend mit aus
der dunklen Erregung den lichten Geist und hält uns den
Kopf oben über den Wogen des Gefühls. Diese Wogen
himmelhoch zu treiben und dennoch den Kopf darüber
zu erhalten: das ist das Wunder Shakespeares. Nie
befinden wir uns vollkommener in der Zone der Sym-
pathie als vor dem ergreifenden Schein seiner tragischen
Spiele.
Wir können uns auch da losmachen und können uns
kalt kritisierend in die Verstandesbahn verengen oder uns
gar, wenn es uns denn beliebt, auf die fixierte Nasen-
spitze eines Schauspielers selbstmörderisch punktuell zu-
fammenziehen. Versuches! — Die Freiheit bleibt der
bewußten Seele für jede Zone, gerade weil sie den Kopf
vor dem „Schein" oben behält. Sie kann sich auch will-
kürlich aus der Sympathie in die laue Weite: die
Theaterumgebung oder die Tagesgeschäfte zurückver-
flauen. Anders wie der sentimental ans Spiel Verlorene,
dem es zur Wirklichkeit wird, die er „gefesselt", mit dem
Tränentuch vor den Augen, quittiert. „An der Senti-
mentalität erkennt man die Kanaille", heißt es grob in
Meyrinks „Golem". So ungehaltene, von sinnlosem
„Kitsch" wie von sinnvoller Dichtung gleichermaßen be-
zwungene Herzen verachtet die Kunst, die nicht nut
Mitleid zu begießen, sondern mit Sympathie zu segnen
berufen ist.
Die Regie, die bei Shakespeare auf schöne Bühnen-
bilder statt auf erschöpfendes Spiel ausgeht, verfehlt
die ihr mögliche Leistung, weil sie die Potenz der Sym-
pathie verringert, die Schwingung des Werkes verflacht.
Dagegen bedeutet es für die kinematographische Regie
eine relative künstlerische Rettung, wenn sie ihren sen-
sationellen Stoffen schöne, klar umrahmte und eindrucks-
volle mimische Bilder abgewinnt, die dem naiven Publi-
kum in der Nacht seiner nur sentimental möglichen Er-
griffenheit durch redelose, brüchig motivierte Leiden-
schaftlichkeiten das Morgenrot eines geistigeren Ge-
nießens aufdämmern und ihm solches allmählich vielleicht
bewußt werden lassen. — Der Verfasser erinnert sich
des bewundernden Gemurmels, das den Zuschauerraum
durchlief, als der Held eines im übrigen rohstofflichen
Filmstückes, ein junger verarmter Graf, der sich als
Bauernknecht vermietet, in einem herrlichen Bilde,
hinter dem Pfluge über einen Hügelkamm schreitend
erschien, als bewegte Silhouette vor einem mächtigen
Hintergrund' ziehender Wolken. Merkte einer unter
hundert den Umschwung seines Innern aus der ohn-
mächtigen Hingabe zur freien Betrachtung? — mit
Schopenhauer zu reden: den Umschwung von dumpfer
Willensgebundenheit zur reinen Vorstellung? — mit
1Z0