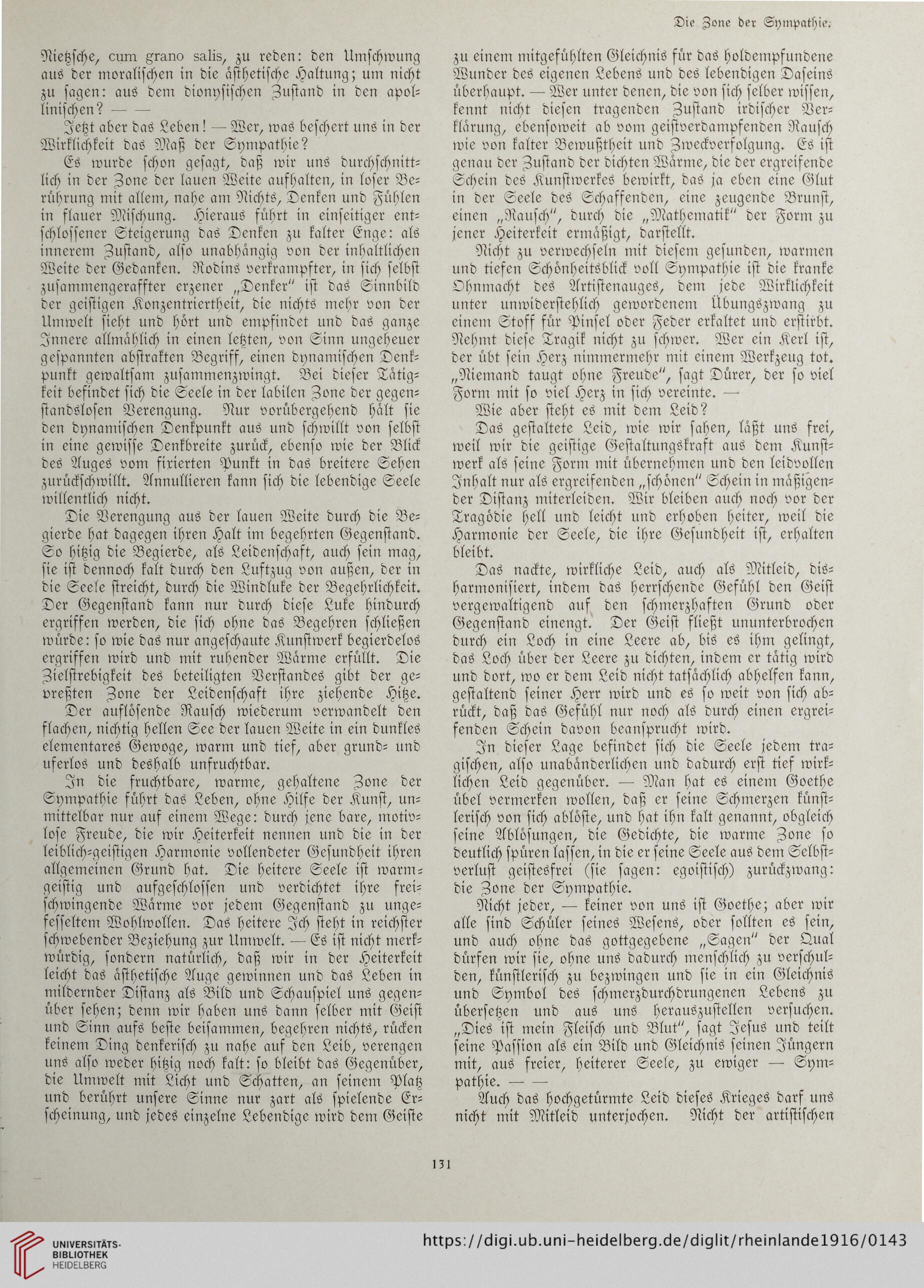Die Zone der Sympathie.-
Nietzsche, cum gmuo sulis, zu reden: den Umschwung
aus der moralischen in die ästhetische Haltung; um nicht
zu sagen: aus den: dionysischen Ausland in den apol-
linischen? — —
Jetzt aber das Leben! — Wer, was beschert uns in der
Wirklichkeit das Maß der Sympathie?
Es wurde schon gesagt, daß wir uns durchschnitt-
lich in der Zone der lauen Weite aufhalten, in loser Be-
rührung mit allem, nahe am Nichts, Denken und Fühlen
in flauer Mischung. Hieraus führt in einseitiger ent-
schlossener Steigerung das Denken zu kalter Enge: als
innerem Ausland, also unabhängig von der inhaltlichen
Weite der Gedanken. Rodins verkrampfter, in sich selbst
zusammengeraffter erzener „Denker" ist das Sinnbild
der geistigen Konzentriertheit, die nichts mehr von der
Umwelt sieht und hört und empfindet und das ganze
Innere allmählich in einen letzten, von Sinn ungeheuer
gespannten abstrakten Begriff, einen dynamischen Denk-
punkt gewaltsam zusammenzwingt. Bei dieser Tätig-
keit befindet sich die Seele in der labilen Aone der gegen-
standslosen Verengung. Nur vorübergehend hält sie
den dynamischen Denkpunkt aus und schwillt von selbst
in eine gewisse Denkbreite zurück, ebenso wie der Blick
des Auges vom fixierten Punkt in das breitere Sehen
zurückschwillt. Annullieren kann sich die lebendige Seele
willentlich nicht.
Die Verengung aus der lauen Weite durch die Be-
gierde hat dagegen ihren Halt im begehrten Gegenstand.
So hitzig die Begierde, als Leidenschaft, auch sein mag,
sie ist dennoch kalt durch den Luftzug von außen, der in
die Seele streicht, durch die Windluke der Begehrlichkeit.
Der Gegenstand kann nur durch diese Luke hindurch
ergriffen werden, die sich ohne das Begehren schließen
würde: so wie das nur angeschaute Kunstwerk begierdelos
ergriffen wird und mit ruhender Wärme erfüllt. Die
Zielstrebigkeit des beteiligten Verstandes gibt der ge-
preßten Aone der Leidenschaft ihre ziehende Hitze.
Der auflösende Rausch wiederum verwandelt den
flachen, nichtig Hellen See der lauen Weite in ein dunkles
elementares Gewoge, warm und tief, aber gründ- und
uferlos und deshalb unfruchtbar.
In die fruchtbare, warme, gehaltene Aone der
Sympathie führt das Leben, ohne Hilfe der Kunst, un-
mittelbar nur auf einem Wege: durch jene bare, motiv-
lose Freude, die wir Heiterkeit nennen und die in der
leiblich-geistigen Harmonie vollendeter Gesundheit ihren
allgemeinen Grund hat. Die heitere Seele ist warm-
geistig und aufgeschlossen und verdichtet ihre frei-
schwingende Wärme vor jedem Gegenstand zu unge-
fesseltem Wohlwollen. Das heitere Ich steht in reichster
schwebender Beziehung zur Umwelt. — Es ist nicht merk-
würdig, sondern natürlich, daß wir in der Heiterkeit
leicht das ästhetische Auge gewinnen und das Leben in
mildernder Distanz als Bild und Schauspiel uns gegen-
über sehen; denn wir haben uns dann selber mit Geist
und Sinn aufs beste beisammen, begehren nichts, rücken
keinem Ding denkerisch zu nahe auf den Leib, verengen
uns also weder hitzig noch kalt: so bleibt das Gegenüber,
die Umwelt mit Licht und Schatten, an seinem Platz
und berührt unsere Sinne nur zart als spielende Er-
scheinung, und jedes einzelne Lebendige wird dem Geiste
zu eineni mitgefühlten Gleichnis für das holdempfundene
Wunder des eigenen Lebens und des lebendigen Daseins
überhaupt. — Wer unter denen, die von sich selber wissen,
kennt nicht diesen tragenden Ausland irdischer Ver-
klärung, ebensoweit ab vom geistverdampfenden Rausch
wie von kalter Bewußtheit und Aweckverfolgung. Es ist
genau der Ausland der dichten Wärme, die der ergreifende
Schein des Kunstwerkes bewirkt, das ja eben eine Glut
in der Seele des Schaffenden, eine zeugende Brunst,
einen „Rausch", durch die „Mathematik" der Form zu
jener Heiterkeit ermäßigt, darstellt.
Nicht zu verwechseln mit diesem gesunden, warmen
und tiefen Schönheitsblick voll Sympathie ist die kranke
Ohnmacht des Artistenauges, dem jede Wirklichkeit
unter unwiderstehlich gewordenem Übungszwang zu
einen: Stoff für Pinsel oder Feder erkaltet und erstirbt.
Nehmt diese Tragik nicht zu schwer. Wer ein Kerl ist,
der übt sein Herz nimmermehr mit einem Werkzeug tot.
„Niemand taugt ohne Freude", sagt Dürer, der so viel
Form mit so viel Herz in sich vereinte. —
Wie aber steht es mit dem Leid?
Das gestaltete Leid, wie wir sahen, läßt uns frei,
weil wir die geistige Gestaltungskraft aus dem Kunst-
werk als seine Form mit übernehmen und den leidvollen
Inhalt nur als ergreifenden „schönen" Schein in mäßigen-
der Distanz miterleiden. Wir bleiben auch noch vor der
Tragödie hell und leicht und erhoben heiter, weil die
Harmonie der Seele, die ihre Gesundheit ist, erhalten
bleibt.
Das nackte, wirkliche Leid, auch als Mitleid, dis-
harmonisiert, indem das herrschende Gefühl den Geist
vergewaltigend auf den schmerzhaften Grund oder
Gegenstand einengt. Der Geist fließt ununterbrochen
durch ein Loch in eine Leere ab, bis es ihm gelingt,
das Loch über der Leere zu dichten, indem er tätig wird
und dort, wo er dem Leid nicht tatsächlich abhelfen kann,
gestaltend seiner Herr wird und es so weit von sich ab-
rückt, daß das Gefühl nur noch als durch einen ergrei-
fenden Schein davon beansprucht wird.
In dieser Lage befindet sich die Seele jedem tra-
gischen, also unabänderlichen und dadurch erst tief wirk-
lichen Leid gegenüber. — Man hat es einem Goethe
übel vermerken wollen, daß er seine Schmerzen künst-
lerisch von sich ablöste, und hat ihn kalt genannt, obgleich
seine Ablösungen, die Gedichte, die warme Aone so
deutlich spüren lassen, in die er seine Seele aus den: Selbst-
verlust geistesfrei (sie sagen: egoistisch) zurückzwang:
die Aone der Sympathie.
Nicht jeder, — keiner von uns ist Goethe; aber wir
alle sind Schüler seines Wesens, oder sollten es sein,
und auch ohne das gottgegebene „Sagen" der Qual
dürfen wir sie, ohne uns dadurch menschlich zu verschul-
den, künstlerisch zu bezwingen und sie in ein Gleichnis
und Symbol des schmerzdurchdrungenen Lebens zu
übersetzen und aus uns herauszustellen versuchen.
„Dies ist mein Fleisch und Blut", sagt Jesus und teilt
seine Passion als ein Bild und Gleichnis seinen Jüngern
mit, aus freier, heiterer Seele, zu ewiger — Sym-
pathie. —
Auch das hochgetürmte Leid dieses Krieges darf uns
nicht mit Mitleid unterjochen. Nicht der artistischen
lZI
Nietzsche, cum gmuo sulis, zu reden: den Umschwung
aus der moralischen in die ästhetische Haltung; um nicht
zu sagen: aus den: dionysischen Ausland in den apol-
linischen? — —
Jetzt aber das Leben! — Wer, was beschert uns in der
Wirklichkeit das Maß der Sympathie?
Es wurde schon gesagt, daß wir uns durchschnitt-
lich in der Zone der lauen Weite aufhalten, in loser Be-
rührung mit allem, nahe am Nichts, Denken und Fühlen
in flauer Mischung. Hieraus führt in einseitiger ent-
schlossener Steigerung das Denken zu kalter Enge: als
innerem Ausland, also unabhängig von der inhaltlichen
Weite der Gedanken. Rodins verkrampfter, in sich selbst
zusammengeraffter erzener „Denker" ist das Sinnbild
der geistigen Konzentriertheit, die nichts mehr von der
Umwelt sieht und hört und empfindet und das ganze
Innere allmählich in einen letzten, von Sinn ungeheuer
gespannten abstrakten Begriff, einen dynamischen Denk-
punkt gewaltsam zusammenzwingt. Bei dieser Tätig-
keit befindet sich die Seele in der labilen Aone der gegen-
standslosen Verengung. Nur vorübergehend hält sie
den dynamischen Denkpunkt aus und schwillt von selbst
in eine gewisse Denkbreite zurück, ebenso wie der Blick
des Auges vom fixierten Punkt in das breitere Sehen
zurückschwillt. Annullieren kann sich die lebendige Seele
willentlich nicht.
Die Verengung aus der lauen Weite durch die Be-
gierde hat dagegen ihren Halt im begehrten Gegenstand.
So hitzig die Begierde, als Leidenschaft, auch sein mag,
sie ist dennoch kalt durch den Luftzug von außen, der in
die Seele streicht, durch die Windluke der Begehrlichkeit.
Der Gegenstand kann nur durch diese Luke hindurch
ergriffen werden, die sich ohne das Begehren schließen
würde: so wie das nur angeschaute Kunstwerk begierdelos
ergriffen wird und mit ruhender Wärme erfüllt. Die
Zielstrebigkeit des beteiligten Verstandes gibt der ge-
preßten Aone der Leidenschaft ihre ziehende Hitze.
Der auflösende Rausch wiederum verwandelt den
flachen, nichtig Hellen See der lauen Weite in ein dunkles
elementares Gewoge, warm und tief, aber gründ- und
uferlos und deshalb unfruchtbar.
In die fruchtbare, warme, gehaltene Aone der
Sympathie führt das Leben, ohne Hilfe der Kunst, un-
mittelbar nur auf einem Wege: durch jene bare, motiv-
lose Freude, die wir Heiterkeit nennen und die in der
leiblich-geistigen Harmonie vollendeter Gesundheit ihren
allgemeinen Grund hat. Die heitere Seele ist warm-
geistig und aufgeschlossen und verdichtet ihre frei-
schwingende Wärme vor jedem Gegenstand zu unge-
fesseltem Wohlwollen. Das heitere Ich steht in reichster
schwebender Beziehung zur Umwelt. — Es ist nicht merk-
würdig, sondern natürlich, daß wir in der Heiterkeit
leicht das ästhetische Auge gewinnen und das Leben in
mildernder Distanz als Bild und Schauspiel uns gegen-
über sehen; denn wir haben uns dann selber mit Geist
und Sinn aufs beste beisammen, begehren nichts, rücken
keinem Ding denkerisch zu nahe auf den Leib, verengen
uns also weder hitzig noch kalt: so bleibt das Gegenüber,
die Umwelt mit Licht und Schatten, an seinem Platz
und berührt unsere Sinne nur zart als spielende Er-
scheinung, und jedes einzelne Lebendige wird dem Geiste
zu eineni mitgefühlten Gleichnis für das holdempfundene
Wunder des eigenen Lebens und des lebendigen Daseins
überhaupt. — Wer unter denen, die von sich selber wissen,
kennt nicht diesen tragenden Ausland irdischer Ver-
klärung, ebensoweit ab vom geistverdampfenden Rausch
wie von kalter Bewußtheit und Aweckverfolgung. Es ist
genau der Ausland der dichten Wärme, die der ergreifende
Schein des Kunstwerkes bewirkt, das ja eben eine Glut
in der Seele des Schaffenden, eine zeugende Brunst,
einen „Rausch", durch die „Mathematik" der Form zu
jener Heiterkeit ermäßigt, darstellt.
Nicht zu verwechseln mit diesem gesunden, warmen
und tiefen Schönheitsblick voll Sympathie ist die kranke
Ohnmacht des Artistenauges, dem jede Wirklichkeit
unter unwiderstehlich gewordenem Übungszwang zu
einen: Stoff für Pinsel oder Feder erkaltet und erstirbt.
Nehmt diese Tragik nicht zu schwer. Wer ein Kerl ist,
der übt sein Herz nimmermehr mit einem Werkzeug tot.
„Niemand taugt ohne Freude", sagt Dürer, der so viel
Form mit so viel Herz in sich vereinte. —
Wie aber steht es mit dem Leid?
Das gestaltete Leid, wie wir sahen, läßt uns frei,
weil wir die geistige Gestaltungskraft aus dem Kunst-
werk als seine Form mit übernehmen und den leidvollen
Inhalt nur als ergreifenden „schönen" Schein in mäßigen-
der Distanz miterleiden. Wir bleiben auch noch vor der
Tragödie hell und leicht und erhoben heiter, weil die
Harmonie der Seele, die ihre Gesundheit ist, erhalten
bleibt.
Das nackte, wirkliche Leid, auch als Mitleid, dis-
harmonisiert, indem das herrschende Gefühl den Geist
vergewaltigend auf den schmerzhaften Grund oder
Gegenstand einengt. Der Geist fließt ununterbrochen
durch ein Loch in eine Leere ab, bis es ihm gelingt,
das Loch über der Leere zu dichten, indem er tätig wird
und dort, wo er dem Leid nicht tatsächlich abhelfen kann,
gestaltend seiner Herr wird und es so weit von sich ab-
rückt, daß das Gefühl nur noch als durch einen ergrei-
fenden Schein davon beansprucht wird.
In dieser Lage befindet sich die Seele jedem tra-
gischen, also unabänderlichen und dadurch erst tief wirk-
lichen Leid gegenüber. — Man hat es einem Goethe
übel vermerken wollen, daß er seine Schmerzen künst-
lerisch von sich ablöste, und hat ihn kalt genannt, obgleich
seine Ablösungen, die Gedichte, die warme Aone so
deutlich spüren lassen, in die er seine Seele aus den: Selbst-
verlust geistesfrei (sie sagen: egoistisch) zurückzwang:
die Aone der Sympathie.
Nicht jeder, — keiner von uns ist Goethe; aber wir
alle sind Schüler seines Wesens, oder sollten es sein,
und auch ohne das gottgegebene „Sagen" der Qual
dürfen wir sie, ohne uns dadurch menschlich zu verschul-
den, künstlerisch zu bezwingen und sie in ein Gleichnis
und Symbol des schmerzdurchdrungenen Lebens zu
übersetzen und aus uns herauszustellen versuchen.
„Dies ist mein Fleisch und Blut", sagt Jesus und teilt
seine Passion als ein Bild und Gleichnis seinen Jüngern
mit, aus freier, heiterer Seele, zu ewiger — Sym-
pathie. —
Auch das hochgetürmte Leid dieses Krieges darf uns
nicht mit Mitleid unterjochen. Nicht der artistischen
lZI