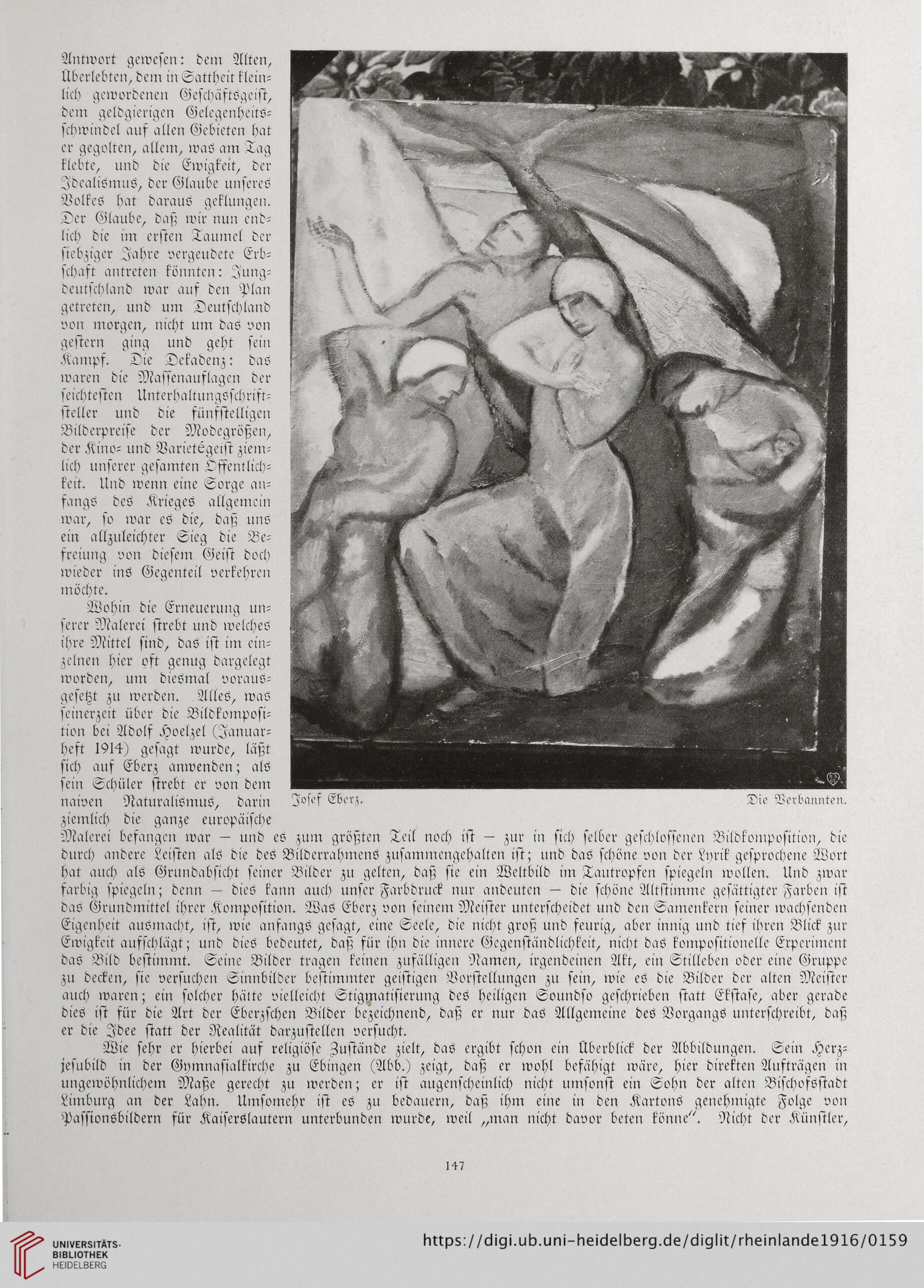Antwort gewesen: dein Alten,
Überlebten, dein in Sattheit klein-
lich gewordenen Geschäftsgeist,
dem geldgierigen Gelegenheits-
schwindel aiis allen Gebieten hat
er gegolten, allein, was am Tag
klebte, und die Ewigkeit, der
Idealismus, der Glaube unseres
Volkes hat daraus geklungen.
Der Glaube, daß wir nun end-
lich die im ersten Taumel der
siebziger Jahre vergeudete Erb-
schaft antreten könnten: Jung-
deutschland war auf den Plan
getreten, und um Deutschland
von morgen, nicht um das von
gestern ging und geht sein
Kampf. Die Dekadenz: das
waren die Massenauflagen der
seichtesten Unterhaltungsschrift-
steller und die fünfstelligen
Bilderpreise der Modegrößen,
der Kino- und Varietegeist ziem-
lich unserer gesamten Öffentlich-
keit. Und wenn eine Sorge an-
fangs des Krieges allgemein
war, so war es die, daß uns
ein allzuleichter Sieg die Be-
freiung von diesem Geist doch
wieder ins Gegenteil verkehren
möchte.
Wohin die Erneuerung un-
serer Malerei strebt und welches
ihre Mittel sind, das ist im ein-
zelnen hier oft genug dargclegt
worden, um diesmal voraus-
gesetzt zu werden. Alles, was
seinerzeit über die Bildkomposi-
tion bei Adolf Hoelzel (Januar-
heft 1914) gesagt wurde, läßt
sich auf Eberz anwenden; als
sein Schüler strebt er von dem
naiven Naturalismus, darin
Josef Eberz. Die Verbannten.
ziemlich die ganze europäische
Malerei befangen war — und es zum größten Teil noch ist — zur in sich selber geschlossenen Bildkomposition, die
durch andere Leisten als die des Bildcrrahmens zusammengehalten ist; und das schöne von der Lyrik gesprochene Wort
hat auch als Grundabsicht seiner Bilder zu gelten, daß sie ein Weltbild im Tautropfen spiegeln wollen. Und zwar
farbig spiegeln; denn — dies kann auch unser Farbdruck nur andeuten — die schöne Altstimme gesättigter Farben ist
das Grundmittel ihrer Komposition. WaS Eberz von seinem Meister unterscheidet und den Samenkern seiner wachsenden
Eigenheit auSmacht, ist, wie anfangs gesagt, eine Seele, die nicht groß und feurig, aber innig und tief ihren Blick zur
Ewigkeit auffchlägt; und dies bedeutet, daß für ihn die innere Gegenständlichkeit, nicht daö kompositionelle Experiment
das Bild bestimmt. Seine Bilder tragen keinen zufälligen Namen, irgendeinen Akt, ein Stilleben oder eine Gruppe
zu decken, sie versuchen Sinnbilder bestimmter geistigen Vorstellungen zu sein, wie eö die Bilder der alten Meister
auch waren; ein solcher hätte vielleicht Stigmatisierung deö heiligen Soundso geschrieben statt Ekstase, aber gerade
dies ist für die Art der Eberzschen Bilder bezeichnend, daß er nur das Allgemeine des Vorgangs unterschreibt, daß
er die Idee statt der Realität darzustellen versucht.
Wie sehr er hierbei auf religiöse Zustände zielt, das ergibt schon ein Überblick der Abbildungen. Sein Herz-
jesubild in der Gymnasialkirche zu Ebingen (Abb.) zeigt, daß er wohl befähigt wäre, hier direkten Aufträgen in
ungewöhnlichem Maße gerecht zu werden; er ist augenscheinlich nicht umsonst ein Sohn der alten Bischofsstadt
Limburg an der Lahn. Umsomehr ist es zu bedauern, daß ihm eine in den Kartons genehmigte Folge von
Passiorisbildern für Kaiserslautern unterbunden wurde, weil „man nicht davor beten könne". Nicht der Künstler,
147
Überlebten, dein in Sattheit klein-
lich gewordenen Geschäftsgeist,
dem geldgierigen Gelegenheits-
schwindel aiis allen Gebieten hat
er gegolten, allein, was am Tag
klebte, und die Ewigkeit, der
Idealismus, der Glaube unseres
Volkes hat daraus geklungen.
Der Glaube, daß wir nun end-
lich die im ersten Taumel der
siebziger Jahre vergeudete Erb-
schaft antreten könnten: Jung-
deutschland war auf den Plan
getreten, und um Deutschland
von morgen, nicht um das von
gestern ging und geht sein
Kampf. Die Dekadenz: das
waren die Massenauflagen der
seichtesten Unterhaltungsschrift-
steller und die fünfstelligen
Bilderpreise der Modegrößen,
der Kino- und Varietegeist ziem-
lich unserer gesamten Öffentlich-
keit. Und wenn eine Sorge an-
fangs des Krieges allgemein
war, so war es die, daß uns
ein allzuleichter Sieg die Be-
freiung von diesem Geist doch
wieder ins Gegenteil verkehren
möchte.
Wohin die Erneuerung un-
serer Malerei strebt und welches
ihre Mittel sind, das ist im ein-
zelnen hier oft genug dargclegt
worden, um diesmal voraus-
gesetzt zu werden. Alles, was
seinerzeit über die Bildkomposi-
tion bei Adolf Hoelzel (Januar-
heft 1914) gesagt wurde, läßt
sich auf Eberz anwenden; als
sein Schüler strebt er von dem
naiven Naturalismus, darin
Josef Eberz. Die Verbannten.
ziemlich die ganze europäische
Malerei befangen war — und es zum größten Teil noch ist — zur in sich selber geschlossenen Bildkomposition, die
durch andere Leisten als die des Bildcrrahmens zusammengehalten ist; und das schöne von der Lyrik gesprochene Wort
hat auch als Grundabsicht seiner Bilder zu gelten, daß sie ein Weltbild im Tautropfen spiegeln wollen. Und zwar
farbig spiegeln; denn — dies kann auch unser Farbdruck nur andeuten — die schöne Altstimme gesättigter Farben ist
das Grundmittel ihrer Komposition. WaS Eberz von seinem Meister unterscheidet und den Samenkern seiner wachsenden
Eigenheit auSmacht, ist, wie anfangs gesagt, eine Seele, die nicht groß und feurig, aber innig und tief ihren Blick zur
Ewigkeit auffchlägt; und dies bedeutet, daß für ihn die innere Gegenständlichkeit, nicht daö kompositionelle Experiment
das Bild bestimmt. Seine Bilder tragen keinen zufälligen Namen, irgendeinen Akt, ein Stilleben oder eine Gruppe
zu decken, sie versuchen Sinnbilder bestimmter geistigen Vorstellungen zu sein, wie eö die Bilder der alten Meister
auch waren; ein solcher hätte vielleicht Stigmatisierung deö heiligen Soundso geschrieben statt Ekstase, aber gerade
dies ist für die Art der Eberzschen Bilder bezeichnend, daß er nur das Allgemeine des Vorgangs unterschreibt, daß
er die Idee statt der Realität darzustellen versucht.
Wie sehr er hierbei auf religiöse Zustände zielt, das ergibt schon ein Überblick der Abbildungen. Sein Herz-
jesubild in der Gymnasialkirche zu Ebingen (Abb.) zeigt, daß er wohl befähigt wäre, hier direkten Aufträgen in
ungewöhnlichem Maße gerecht zu werden; er ist augenscheinlich nicht umsonst ein Sohn der alten Bischofsstadt
Limburg an der Lahn. Umsomehr ist es zu bedauern, daß ihm eine in den Kartons genehmigte Folge von
Passiorisbildern für Kaiserslautern unterbunden wurde, weil „man nicht davor beten könne". Nicht der Künstler,
147