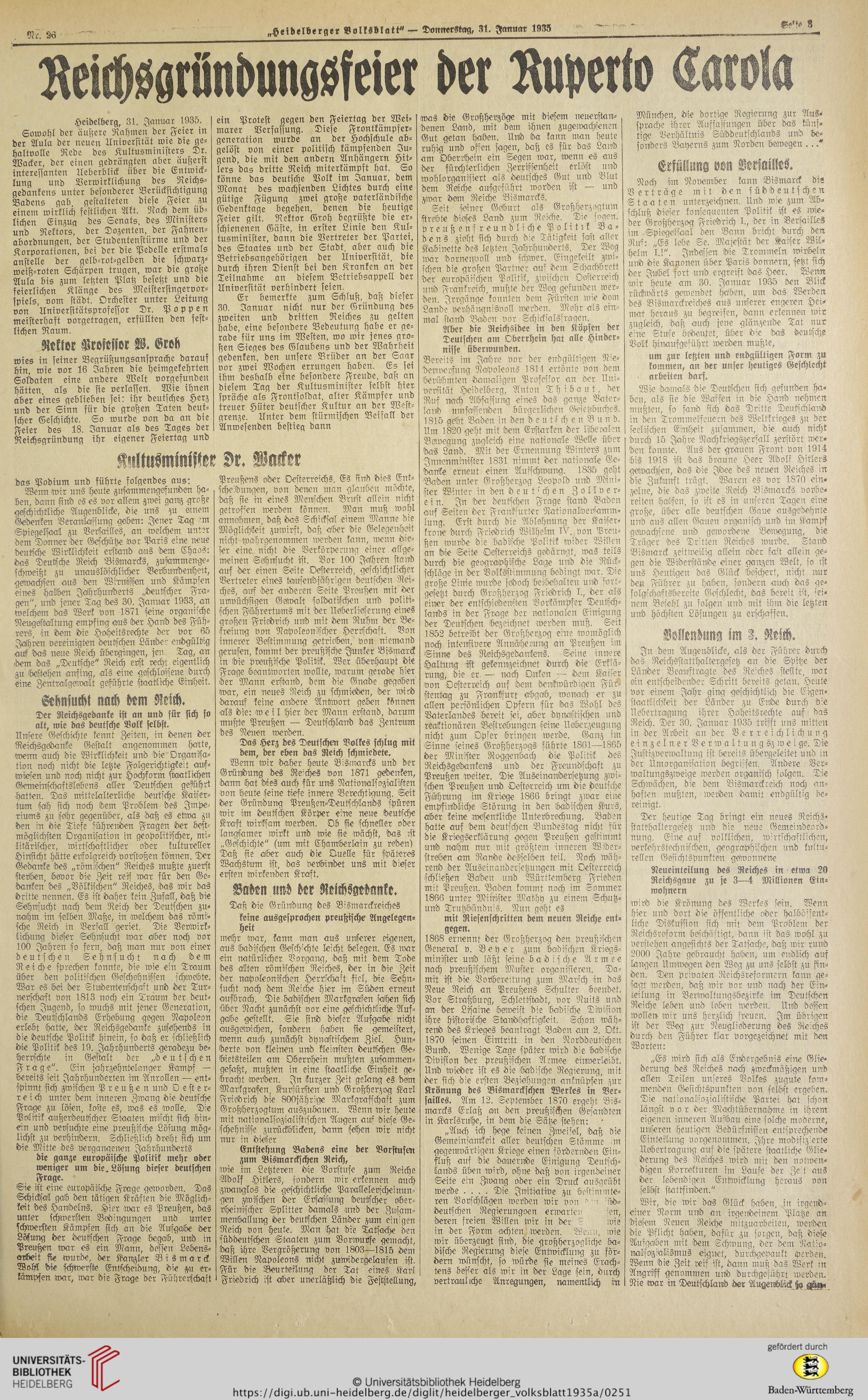Nr. 26
Heidelberger Bolksvlatt" — Donnerstag, 31. Januar 1935
Gs'ke 3
glMimngsseier der
die
die
der
der
Heidelberg, 31. Januar 1935.
Sowohl der äußere Rahmen der Feier in
der Aula der neuen Universität wie die ge-
haltvolle Rede des Kultusministers Dr.
Wacker, der einen gedrängten aber äußerst
interessanten Ueberblick über die Entwick-
lung und Verwirklichung des Reichs-
gedankens unter besonderer Berücksichtigung
Badens gab. gestalteten diese Feier zu
einem wirklich festlichen Akt. Nach dem üb-
lichen Einzug des Senats, des Ministers
und Rektors, der Dozenten, der Fahnen-
abordnungen, der Studentenstürme und der
Korporationen, bei der die Pedelle erstmals
anstelle der gelb-rot-gelben die schwarz-
weitz-roten Schärpen trügen, war die große
Aula bis zum letzten Platz besetzt und die
feierlichen Klänge des Meistersingervor-
spiels, vom städt. Orchester unter Leitung
von Universitätsprofessor Dr. Poppen
meisterhaft vorgetragen, erfüllten den fest-
lichen Raum.
Rektor KroWor W. Sroh
wies in seiner Begrüßungsansprache darauf
hin, wie vor 16 Jahren die heimgekehrten
Soldaten eine andere Welt vorgefunden
hätten, als die sie verlassen. Wie ihnen
aber eines geblieben sei: ihr deutsches Herz
und der Sinn für die großen Taten deut-
scher Geschichte. So wurde von da an die
Feier des 18. Januar als des Tages der
Neichsgründung ihr eigener Feiertag und
ein Protest gegen den Feiertag der Wei-
marer Verfassung. Diese Frontkämpfer-
generation wurde an der Hochschule ab-
gelöst von einer politisch kämpfenden Ju-
gend, die mit den andern Anhängern Hit-
lers das dritte Reich miterkümpft hat. So
könne das deutsche Volk im Januar, dem
Monat des wachsenden Lichtes durch eine
gütige Fügung zwei große vaterländische
Gedenktage begehen, denen die heutige
Feier gilt. Rektor Groh begrüßte die er-
schienenen Gäste, in erster Linie den Kul-
tusminister, dann die Vertreter der Partei,
des Staates und der Stadt, aber auch
Betriebsangehörigen der Universität,
durch ihren Dienst bei den Kranken an
Teilnahme an diesem Vetriebsappell
Universität verhindert seien.
Er bemerkte zum Schluß, daß dieser
30. Januar nicht nur der Gründung des
zweiten und dritten Reiches zu gelten
habe, eine besondere Bedeutung habe er ge-
rade für uns im Westen, wo wir jenes gro-
ßen Sieges des Glaubens und der Wahrheit
gedenken, den unsere Brüder an der Saar
vor zwei Wochen errungen haben. Es sei
ihm deshalb eine besondere Freude, daß an
diesem Tag der Kultusminister selbst hier
spräche als Frontsoldat, alter Kämpfer und
treuer Hüter deutscher Kultur an der West-
grenze. Unter dem stürmischen Beifall der
Anwesenden bestieg dann
München, die dortige Regierung zur Aus-
sprache ihrer Auffassungen über das künf-
tige Verhältnis Süddeutschlands und be-
sonders Bayerns zum Norden bewegen ..
EkWuns von Lrr
was die Großhevzöge mit diesem neuevstan-
denen Land, mit dem ihnen zugelvachsenen
Gut getan haben. Und da kann man heute
ruhig und offen sagen, daß es für das Land
am Oberchein ein Segen war, nrenn es aus
der fürchterlichen Zerrissenheit erlöst und
wohlorganisiert als deutsches Gut und Blut
dem Reiche aufgeführt worden ist — und
zwar dem Reiche Bismarcks.
Seit seiner Geburt als Großherzogtum
strebte dieses Land zum Reiche. Die sogen,
preußenfreundliche Politik Ba-
dens zieht sich durch die Tätigkeit fast aller
Kabinette des letzten Jahrhunderts. Ter Weg
war dornenvoll und schwer. Eingekeilt Zwi-
schen die großen Partner auf dem Schachbrett
der europäischen Politik, zwischen Oesterreich
und Frankreich, mußte der Weg gefunden wer-
den. Jrrgänge konnten dem Fürsten wie dem
Lands verhängnisvoll werden. Mehr als ein-
mal stand Baden vor Schicksalsfragen.
Aber die Reichsidee in den Köpfen der
Deutschen am Oberrhein hat alle Hinder-
nisse überwunden.
Bereits im Jahre vor der endgültigen Nie-
derwerfung Napoleons 1814 ertönte von dem
berühmten damaligen Professor an der Uni-
versität Heidelberg, Anton Thibaut, der
Ruf nach Abfassung eines das ganze Vater-
land umfassenden bürgerlichen Gesetzbuches.
1815 geht Baden in den deutschen Bund.
Um 1820 geht mit dem Erstarken der liberalen
Bewegung zugleich eine nationale Welle über
das Land. Mit der Ernennung Winters zum
Innenminister 1831 nimmt der nationale Ge-
danke erneut einen Aufschwung. 1835 geht
Baden unter Großherzog Leopold und Mini-
ster Winter in den deutschen Zollver-
e i n. In der deutschen Frage stand Baden
auf Seiten der Frankfurter Nationalversamm-
lung. Erst durch die Ablehnung der Kaiser-
krone durch Friedrich Wilhelm IV. von Preu-
ßen wurde die badische Politik wider Willen
an die Seite Oesterreichs gedärngt, was teils
durch die geographische Lage uüd dis Rück-
schläge in der Bolksstimmung bedingt war. Die
große Linie wurde jedoch beibehalten und fort-
gesetzt durch Großherzog Friedrich I., der als
einer der entschiedensten Vorkämpfer Deutsch-
lands in der Frage der nationalen Einigung
der Deutschen bezeichnet werden muß. Seit
1852 betreibt der Großherzog eine womöglich
noch intensivere Annäherung an Preußen im
Sinns des Reichsgedankens. Seine innere
Haltung ist gekennzeichnet durch die Erklä-
rung, die er — nach Onken — dem Kaiser
von Oesterreich auf dem denkwürdigen Für-
stentag zu Frankfurt abgab, wonach er zu
allen persönlichen Opfern für das Wohl des
Vaterlandes bereit sei, aber dynastischen und
reaktionären Bestrebungen seine Aeberzeugung
nicht zum Opfer bringen werde. Ganz im
Sinne seines Großherzogs führte 1861—1865
der Minister Roggenbach die Politik des
Reichsgedankens und der Freundschaft zu
Preußen weiter. Die Auseinandersetzung Zwi-
schen Preußen und Oesterreich um die deutsche
Führung im Kriege 1866 bringt zwar eine
empfindliche Störung in den badischen Kurs,
über keine wesentliche Unterbrechung. Baden
hatte auf dem deutschen Bundestag nicht für
die Kriegserklärung gegen Preußen gestimmt
und nahm nur mit größtem inneren Wider-
streben am Rande desselben teil. Noch wäh-
rend der Auseinandersetzungen mit Oesterreich
schließen Baden und Württemberg Frieden
mit Preußen. Baden kommt noch im Sommer
1866 unter Minister Mathy zu einem Schutz-
und Trutzbündnis. Nun geht es
mit Riesenschritten dem neuen Reiche ent-
gegen.
1868 ernennt der Großherzog den preußischen
General v. Beyer zum badischen Kriegs-
minister und läßt seine badische Armee
nach preußischem Muster organisieren. Da-
mit ist die Vorbereitung zum Marsch in das
Nene Reich an Preußens Schulter beendet.
Vor Straßburg, Schlettstadt, vor Nuits und
cm der Lifaine beweist die badische Division
ihre historische Standhaftigkeit. Schon wäh-
rend des Krieges beantragt Baden am 2. Okt.
1870 seinen Eintritt in den Norddeutschen
Bund. Wenige Tage später wird die badische
Division der preußischen Armee einverleibt.
Und wieder ist es die badische Regierung, mit
der sich die ersten Beziehungen anknüpfen zur
Krönung des Bismarckschen Werkes in Ver-
sailles. Am 12. September 1870 ergeht Bis-
marcks Erlaß an den preußischen Gesandten
in Karlsruhe, in dem die Sätze stehen: -
„Auch ich hege keinen Zweifel, daß die
Gemeinsamkeit aller deutschen Stämme m
gegenwärtigen Kriege einen fördernden Ein-
fluß auf die dauernde Einigung Deutsch-
lands üben wird, ohne daß von irgendeiner
Seite ein Zwang oder ein Druck ausgeübt
werde .... Die Initiative zu bestimmte-
ren Vorschlägen werden wir von md-
deutfchen Regierungoen erwarten 'en,
deren freien Willen wir in der wie
in der Form achten werden. Wenn, wie
wir überzeugt sind, die großherzogliche ba-
dische Regierung diese Entwicklung zu för-
dern wünscht, so würde sie meines Erach-
tens bester als wir in der Lage fein, durch
vertrauliche Anregungen, namentlich in j
Preußens oder Oesterreichs. Es sind dies Ent-
fcheidungeu, von denen man glauben möchte,
daß sie in eines Menschen Brüst allein nicht
getrosten werden können. Man muß wohl
annchmen, daß das Schicksal einem Manne die
Möglichkeit znwirft, daß aber die Gelegenheit
nicht wahrgenommen werden kann, wenn die-
ser eine nicht die Verkörperung einer allge-
meinen Sehnsucht ist. Vor 100 Jahren stand
auf der einen Seite Oesterreich, geschichtlicher
Vertreter eines tausendjährigen deutschen Rei-
ches, auf der anderen Seite Preußen mit der
urwüchsigen Gewalt soldatischen und politi-
schen Führertums mit der Ueberlieferung eines
großen Friedrich und mit dem Ruhm der Be-
freiung vou Napoleonischer Herrschaft. Von
innerer Bestimmung getrieben, von niemand
gerufen, kommt der preußische Junker Bismarck
in die Preußische Politik. Wer überhaupt die
Frage beantworten wollte, warum gerade hier
der Mann erstand, dem die Gnade gegeben
war, ein neues Reich zu schmieden, der wird
darauf keine andere Antwort geben können
als die: weil hier der Mann erstand, darum
mußte Preußen — Deutschland das Zentrum
des Neuen werden.
Das Herz des Deutschen Volkes schlug mit
dem, der eben das Reich schmiedete.
Wenn wir daher heute Bismarcks und der
Gründung des Raches von 1871 .gedenken,
dann hat dies auch für uns Nationalsozialisten
von heute feine tiefe innere Berechtigung. Seit
der Gründung Preußen-Deutschlands spüren
wir im deutschen Körper eins neue deutsche
Kraft wirksam werden. Ob sie schneller oder
langsamer wirkt und wie sie wächst, das stt
„Geschichte" (um mit Chamberlain zu reden)
Daß sie aber auch die Quelle für späteres
Wachstum ist, das verbindet uns mit dieser
ersten wirkenden Kraft.
BMn M) der ReiKsgOMe.
Daß die Gründung des Bismarckreiches
keine ausgesprochen preußische Angelegen-
heit
mehr war, kann man aus unserer eigenen,
aus badischen Gefch'chte leicht belegen. Es war
ein natürlicher Vorgang, daß mit dem Tode
des alten römischen Reiches, der in die Zeit
der napoleonischen Herrschaft fiel, die Sehn-
sucht nach dem Reiche hier im Süden erneut
aufbrach. Die badischen Markgrafen sahen sich
über Nacht zunächst vor eins .geschichtliche Auf-
gabe gestellt. Sie sind dieser Aufgabe nicht
ausgewichen, sondern haben sie gemeistert,
wenn auch zunächst dynastischem Ziel. Hun-
derte von kleinen und kleinsten deutschen Ge-
bietsteilen am Oberrhein mußten zusammen-
gefaßt, mußten in eine staatliche Einheit ge-
bracht werden. In kurzer Zeit gelang es dem
Markgrafen, Kurfürsten und Großhsrzog Karl
Friedrich die 800jährige Markgrafschaft zum
Großherzogtum auszubauen. Wenn wir heute
mit nationalsozialisty'chen Augen aus diese Ge-
schehnisse zurückblicken, dann sehen wir nicht
nur in dieser
Entstehung Badens eine der Vorftufm
zum Bismarckschen Reich,
wie im Letzteren die Vorstufe zum Reiche
Adolf Hitlers, sondern wir erkennen auch
zwanglos die geschichtliche Parallelerscheinun-
gen zwischen der Erfassung deutscher ober-
rheinischer Splitter damals und der Zusam-
menballung der deutschen Länder zum ein'gen
Reich von heute. Man hat die Tatsache den
süddeutschen Staaten zum Vorwurfe gemacht,
daß ihre Vergrößerung von 1803—1815 dem
Willen Napoleons nicht zuwidergelaufen ist.
Für die Beurteilung der Tat "eines Karl
Friedrich ist aber unerläßlich die Feststellung,
Noch im November kann Bismarck dir
Verträge mit den süddeutschen
Staaten unterzeichnen. Uüd wie zum Ab-
schluß dieser konsequenten Politik ist es wie-
der Großhevzog Friedrich I., der in Versailles
im Spiegelfaa'l den Bann bricht durch den
Ruf: „Es lebe Se. Majestät der Kaiser Wil-
helm I.!". Indessen die Trommeln wirbeln
und die Kanonen über Paris donnern, setzt sich
der Jubel fort uüd ergreift das Heer. Wenn
wir heute am 30. Januar 1935 öen Blick
rückwärts gewendet haben, um das Werden
des Bismarckreiches aus unserer engeren Hei-
mat heraus zu begreifen, dann erkennen wir
zugleich, daß auch jene glänzende Tat nur
eine Stufe bedeutet, über die das deutsche
Volk hinaufgesührt werden mußte,
um zur letzten und endgültigen Form zu
kommen, an der unser heutiges Geschlecht
arbeiten darf.
Wie damals die Deutschen sich gefunden ha-
ben, als sie die Waffen in die Hand nehmen
mußten, so fand sich das Dritte Deutschland
in den Trommelfeuern des Weltkrieges zu der
seelischen Einheit zusammen, die auch nicht
durch 15 Jahre Nachkriegszerfall zerstört wer-
den konnte. Aus der grauen Front von 1914
bis 1918 ist das braune Heer Adolf Hitlers
gewachsen, das die Idee des neuen Reiches in
die Zukunft trägt. Waren es vor 1870 ein-
zelne, die das zweite Reich Bismarcks vorbe-
reiten halfen, so ist es in unseren Tagen eine
große, über alle deutschen Gaue ausgedehnte
und aus allen Gauen organisch und im Kampf
gewachsene und gewordene Bewegung, die
Träger des Dritten Reiches wurde. Stand
Bismarck zeitweilig allein oder fast allein ge-
gen die Widerstände einer ganzen Welt, so ist
uns Heutigen das Glück beschert, nicht nur
den Führer zu haben, sondern auch das ge-
folgschaftsbererte Geschlecht, das "bereit ist, fei-
nem Befehl zu folgen und mit ihm die letzten
und höchsten Lösungen zu erschaffen.
BMWdlM im Z. Reich.
In dem Augenblicke, als der Führer durch
das Reichsstatthaltergefetz an die Spitze der
Länder Beauftragte des Reiches stellte, war
ein entscheidender Schritt bereits getan. Heute
vor einem Jahr ging geschichtlich die Eigen-
staatlichkeit der Länder zu Ende durch die
Nebertragung ihrer Hoheitsrechte auf das
Reich. Der 30. Januar 1935 trifft uns mitten
in der Arbeit an der V e r r e i ch l i ch u n g
e i n z e l n e r V e r w a l t u n g sz w e i ge. Tie
Justizverwaltung ist bereits übevgeleitet und in
der Umorganifation begriffen. Andere Ver-
waltungszweige werden organisch folgen. Die
Schwächen, die dem Bismarckreich noch an-
haften mußten, werden damit endgültig be-
reinigt.
Der heutige Tag bringt ein neues Reich Z-
statthaltergefetz und dis neue Gemeindeord-
nung. Eine auf volklichen, wirtschaftlichen,
verkehrstechnifchen, geographischen und kultu-
rellen Gesichtspunkten gewonnene
Neueinteilung des Reiches in etwa 20
Reichsgaue zu je 3—4 Millionen Ein-
wohnern
wird die Krönung des Werkes sein. Wenn
hier und dort die öffentliche oder halböstent-
liche Diskussion sich mit dem Problem der
Reichsreform beschäftigt, dann ist das Wohl zu
verstehen angesichts der Tatsache, daß war rund
2000 Jahre gebraucht haben, um endlich auf
langen Umwegen den Weg zu uns selbst zu fin-
den. Den privaten Reichsreformern kann ge-
sagt werden, daß wir vor und nach der Ein-
leitung in Verwaltungsbezirke im Deutschen
Reiche leben und loben werden. Und dessen
wollen wir uns herzlich freuen. Im übrigen
ist der Weg zur Neugliederung des Reiches
durch den Führer klar vorgezeichnet mit den
Worten:
„Es wird sich als Endergebnis eine Glie-
derung des Reiches nach zweckmäßigen und
allen Teilen unseres Volkes zugute kom-
nrenden Gesichtspunkten von selbst ergeben.
Die nationalsozialistische Partei hat "schon
längst vor der Machtübernahme in ihrem
eigenen inneren Ausbau eine solche moderns,
unseren heutigen Bedürfnissen entsprechende
Einteilung vorgenommen. Ihrs modifizierte
Uebertragung auf die spätere staatliche Glie-
derung des Reiches wird mit den notwen-
digen Korrekturen im Laufe der Zeit aus
der lebendigen Entwicklung heraus von
selbst stattfinden."
Wir, die wir das Glück haben in irgend-
einer Norm und an irgendeinem Platze an
"diesem Neuen Reiche mitzuavbeiten, werden
die Pflicht haben, dafür zu sorgen, daß diese
Aufgaben mit dem Schwung, der dem Natio-
nalfvtzi'alismus eignet, durchgepaukt iperden.
Wenn die Zeit reif ist, dann muß das Werk in
Angriff genommen und durchgeführt werden.
Nie war in Deutschland dm Augenblick,
MltudmiMer Ar. Wacker
das Podium und führte folgendes aus:
Wenn wir uns heute zufammengefunden ha¬
ben, dann find es es vor allem zwei ganz große
geschichtliche Augenblicke, die uns zu einem
Gedenken Veranlassung geben: Jener Tag 'M
Spiegelsaal zu Versailles, an welchem unter
dem Donner der Geschütze vor Paris eine neue
deutsche Wirklichkeit erstand aus dem Chaos:
das Deutsche Reich Bismarcks, zusammenge-
schweißt zu unauslöschlicher Verbundenheit,
gewachsen aus den Wivnissen und Kämpfen
eines halben Jahrhunderts „deutscher Fra¬
gen", und jener Tag des 30. Januar 1933, an
welchem das Werk von 1871 seine organische
Neugestaltung empfing aus der Hand des Füh¬
rers, in dem die Hoheitsrechte der vor 65
Jahren vereinigten deutschen Länder endgültig
auf das neue Reich übergingen, jen. Tag, an
-dem das „Deutsche" Reich erst recht eigentlich
zu beistehen >cmfing, als eine geschloffene, durch
eine Zentralgswalt geführte staatliche Einheit.
SchnsiM na» dem Reich.
Der Reichsgedanke ist an und für sich so
alt, wie das deutsche Volk selbst.
Unsere Geschichte kennt Zeiten, in denen der
Reichsgedanke Gestalt angenommen .hatte,
wenn auch die Wirklichkeit und die Organisa¬
tion noch nicht die letzte Folgerichtigkeit auf¬
wissen und noch nicht zur Hochform staatlichen
Gemeinschaftslebens aller Deutschen geführt
hatten. Das mittelalterliche deutsche Kaiser¬
tum sah sich noch dem Problem des Impe¬
riums zu sehr gegenüber, als daß es etwa zu
den in die Tiefe führenden Fragen der best¬
möglichsten Organisation in geopolitischer, mi¬
litärischer, wirtschaftlicher oder kultureller
Hinsicht hätte erfolgreich vorstoßen können. Der
Gedanke des „römischen" Reiches mußte zuerst
stevben, bevor die Zeit reif war für den Ge-
danken des „Völkischen" Reiches, das wir das
dritte nennen. Es ist daher kein Zufall, daß die
Sehnsucht nach dem Reich der Deutschen zu¬
nahm im selben Maße, in welchem das römi¬
sche Reich in Verfall geriet. Die Verwirk¬
lichung dieser Sehnsucht war aber noch vor
100 Jahren so fern, daß man nur von einer
deutschen Sehnsucht nach dem
Reiche sprechen konnte, die wie ein Traum
über den politischen Geschehnissen schwebte.
War es bei der Studentenschaft und der Tur-
nerfchaft von 1813 noch ein Traum der deut-
schen Jugend, jo wuchs mit jener Generation,
die Deutschlands Erhebung gegen Napoleon
erlebt hatte, der Reichsgedanke zusehends in
die deutsche Politik hinein, so daß er schließlich
die Politik des 19. Jahrhunderts geradezu be-
herrschte in Gestalt der „deutschen
Frage". Ein jahrzehntelanger Kampf —
bereits seit Jahrhunderten im Anrollsn — ent-
fpinnt sich zwischen Preußen und O e st s r-
reich unter dem inneren Zwang die deutsche
Frage zu lösen, koste es, was es wolle. Die
Politik außerdeutscher Staaten mischt sich hin¬
ein und versuchte eine preußische Lösung mög-
li.chst zu verhindern. Schließlich dreht sich um
die Mitte des vergangenen Jahrhunderts
die ganze europäische Politik mehr oder
weniger um die. Lösung dieser deutschen
Frage.
Sie.ist eine europäische Frage geworden. Das
'Schicksal gab den tätigen Kräften die Möglich¬
keit des Handelns. Hier war es Preußen, das
unter schwersten Bedingungen und unter
schwersten Kämpfen sich an die Aufgabe -der
Losung der deutschen Frage begab, und in
Preußen war es ein Mann, ddssen Lebens¬
arbeit sie wurde, der Kanzler Bismarck
Wahl dis schwerste Entscheidung, die zu er¬
kämpfen war, war die Frage der Führerschaft
Heidelberger Bolksvlatt" — Donnerstag, 31. Januar 1935
Gs'ke 3
glMimngsseier der
die
die
der
der
Heidelberg, 31. Januar 1935.
Sowohl der äußere Rahmen der Feier in
der Aula der neuen Universität wie die ge-
haltvolle Rede des Kultusministers Dr.
Wacker, der einen gedrängten aber äußerst
interessanten Ueberblick über die Entwick-
lung und Verwirklichung des Reichs-
gedankens unter besonderer Berücksichtigung
Badens gab. gestalteten diese Feier zu
einem wirklich festlichen Akt. Nach dem üb-
lichen Einzug des Senats, des Ministers
und Rektors, der Dozenten, der Fahnen-
abordnungen, der Studentenstürme und der
Korporationen, bei der die Pedelle erstmals
anstelle der gelb-rot-gelben die schwarz-
weitz-roten Schärpen trügen, war die große
Aula bis zum letzten Platz besetzt und die
feierlichen Klänge des Meistersingervor-
spiels, vom städt. Orchester unter Leitung
von Universitätsprofessor Dr. Poppen
meisterhaft vorgetragen, erfüllten den fest-
lichen Raum.
Rektor KroWor W. Sroh
wies in seiner Begrüßungsansprache darauf
hin, wie vor 16 Jahren die heimgekehrten
Soldaten eine andere Welt vorgefunden
hätten, als die sie verlassen. Wie ihnen
aber eines geblieben sei: ihr deutsches Herz
und der Sinn für die großen Taten deut-
scher Geschichte. So wurde von da an die
Feier des 18. Januar als des Tages der
Neichsgründung ihr eigener Feiertag und
ein Protest gegen den Feiertag der Wei-
marer Verfassung. Diese Frontkämpfer-
generation wurde an der Hochschule ab-
gelöst von einer politisch kämpfenden Ju-
gend, die mit den andern Anhängern Hit-
lers das dritte Reich miterkümpft hat. So
könne das deutsche Volk im Januar, dem
Monat des wachsenden Lichtes durch eine
gütige Fügung zwei große vaterländische
Gedenktage begehen, denen die heutige
Feier gilt. Rektor Groh begrüßte die er-
schienenen Gäste, in erster Linie den Kul-
tusminister, dann die Vertreter der Partei,
des Staates und der Stadt, aber auch
Betriebsangehörigen der Universität,
durch ihren Dienst bei den Kranken an
Teilnahme an diesem Vetriebsappell
Universität verhindert seien.
Er bemerkte zum Schluß, daß dieser
30. Januar nicht nur der Gründung des
zweiten und dritten Reiches zu gelten
habe, eine besondere Bedeutung habe er ge-
rade für uns im Westen, wo wir jenes gro-
ßen Sieges des Glaubens und der Wahrheit
gedenken, den unsere Brüder an der Saar
vor zwei Wochen errungen haben. Es sei
ihm deshalb eine besondere Freude, daß an
diesem Tag der Kultusminister selbst hier
spräche als Frontsoldat, alter Kämpfer und
treuer Hüter deutscher Kultur an der West-
grenze. Unter dem stürmischen Beifall der
Anwesenden bestieg dann
München, die dortige Regierung zur Aus-
sprache ihrer Auffassungen über das künf-
tige Verhältnis Süddeutschlands und be-
sonders Bayerns zum Norden bewegen ..
EkWuns von Lrr
was die Großhevzöge mit diesem neuevstan-
denen Land, mit dem ihnen zugelvachsenen
Gut getan haben. Und da kann man heute
ruhig und offen sagen, daß es für das Land
am Oberchein ein Segen war, nrenn es aus
der fürchterlichen Zerrissenheit erlöst und
wohlorganisiert als deutsches Gut und Blut
dem Reiche aufgeführt worden ist — und
zwar dem Reiche Bismarcks.
Seit seiner Geburt als Großherzogtum
strebte dieses Land zum Reiche. Die sogen,
preußenfreundliche Politik Ba-
dens zieht sich durch die Tätigkeit fast aller
Kabinette des letzten Jahrhunderts. Ter Weg
war dornenvoll und schwer. Eingekeilt Zwi-
schen die großen Partner auf dem Schachbrett
der europäischen Politik, zwischen Oesterreich
und Frankreich, mußte der Weg gefunden wer-
den. Jrrgänge konnten dem Fürsten wie dem
Lands verhängnisvoll werden. Mehr als ein-
mal stand Baden vor Schicksalsfragen.
Aber die Reichsidee in den Köpfen der
Deutschen am Oberrhein hat alle Hinder-
nisse überwunden.
Bereits im Jahre vor der endgültigen Nie-
derwerfung Napoleons 1814 ertönte von dem
berühmten damaligen Professor an der Uni-
versität Heidelberg, Anton Thibaut, der
Ruf nach Abfassung eines das ganze Vater-
land umfassenden bürgerlichen Gesetzbuches.
1815 geht Baden in den deutschen Bund.
Um 1820 geht mit dem Erstarken der liberalen
Bewegung zugleich eine nationale Welle über
das Land. Mit der Ernennung Winters zum
Innenminister 1831 nimmt der nationale Ge-
danke erneut einen Aufschwung. 1835 geht
Baden unter Großherzog Leopold und Mini-
ster Winter in den deutschen Zollver-
e i n. In der deutschen Frage stand Baden
auf Seiten der Frankfurter Nationalversamm-
lung. Erst durch die Ablehnung der Kaiser-
krone durch Friedrich Wilhelm IV. von Preu-
ßen wurde die badische Politik wider Willen
an die Seite Oesterreichs gedärngt, was teils
durch die geographische Lage uüd dis Rück-
schläge in der Bolksstimmung bedingt war. Die
große Linie wurde jedoch beibehalten und fort-
gesetzt durch Großherzog Friedrich I., der als
einer der entschiedensten Vorkämpfer Deutsch-
lands in der Frage der nationalen Einigung
der Deutschen bezeichnet werden muß. Seit
1852 betreibt der Großherzog eine womöglich
noch intensivere Annäherung an Preußen im
Sinns des Reichsgedankens. Seine innere
Haltung ist gekennzeichnet durch die Erklä-
rung, die er — nach Onken — dem Kaiser
von Oesterreich auf dem denkwürdigen Für-
stentag zu Frankfurt abgab, wonach er zu
allen persönlichen Opfern für das Wohl des
Vaterlandes bereit sei, aber dynastischen und
reaktionären Bestrebungen seine Aeberzeugung
nicht zum Opfer bringen werde. Ganz im
Sinne seines Großherzogs führte 1861—1865
der Minister Roggenbach die Politik des
Reichsgedankens und der Freundschaft zu
Preußen weiter. Die Auseinandersetzung Zwi-
schen Preußen und Oesterreich um die deutsche
Führung im Kriege 1866 bringt zwar eine
empfindliche Störung in den badischen Kurs,
über keine wesentliche Unterbrechung. Baden
hatte auf dem deutschen Bundestag nicht für
die Kriegserklärung gegen Preußen gestimmt
und nahm nur mit größtem inneren Wider-
streben am Rande desselben teil. Noch wäh-
rend der Auseinandersetzungen mit Oesterreich
schließen Baden und Württemberg Frieden
mit Preußen. Baden kommt noch im Sommer
1866 unter Minister Mathy zu einem Schutz-
und Trutzbündnis. Nun geht es
mit Riesenschritten dem neuen Reiche ent-
gegen.
1868 ernennt der Großherzog den preußischen
General v. Beyer zum badischen Kriegs-
minister und läßt seine badische Armee
nach preußischem Muster organisieren. Da-
mit ist die Vorbereitung zum Marsch in das
Nene Reich an Preußens Schulter beendet.
Vor Straßburg, Schlettstadt, vor Nuits und
cm der Lifaine beweist die badische Division
ihre historische Standhaftigkeit. Schon wäh-
rend des Krieges beantragt Baden am 2. Okt.
1870 seinen Eintritt in den Norddeutschen
Bund. Wenige Tage später wird die badische
Division der preußischen Armee einverleibt.
Und wieder ist es die badische Regierung, mit
der sich die ersten Beziehungen anknüpfen zur
Krönung des Bismarckschen Werkes in Ver-
sailles. Am 12. September 1870 ergeht Bis-
marcks Erlaß an den preußischen Gesandten
in Karlsruhe, in dem die Sätze stehen: -
„Auch ich hege keinen Zweifel, daß die
Gemeinsamkeit aller deutschen Stämme m
gegenwärtigen Kriege einen fördernden Ein-
fluß auf die dauernde Einigung Deutsch-
lands üben wird, ohne daß von irgendeiner
Seite ein Zwang oder ein Druck ausgeübt
werde .... Die Initiative zu bestimmte-
ren Vorschlägen werden wir von md-
deutfchen Regierungoen erwarten 'en,
deren freien Willen wir in der wie
in der Form achten werden. Wenn, wie
wir überzeugt sind, die großherzogliche ba-
dische Regierung diese Entwicklung zu för-
dern wünscht, so würde sie meines Erach-
tens bester als wir in der Lage fein, durch
vertrauliche Anregungen, namentlich in j
Preußens oder Oesterreichs. Es sind dies Ent-
fcheidungeu, von denen man glauben möchte,
daß sie in eines Menschen Brüst allein nicht
getrosten werden können. Man muß wohl
annchmen, daß das Schicksal einem Manne die
Möglichkeit znwirft, daß aber die Gelegenheit
nicht wahrgenommen werden kann, wenn die-
ser eine nicht die Verkörperung einer allge-
meinen Sehnsucht ist. Vor 100 Jahren stand
auf der einen Seite Oesterreich, geschichtlicher
Vertreter eines tausendjährigen deutschen Rei-
ches, auf der anderen Seite Preußen mit der
urwüchsigen Gewalt soldatischen und politi-
schen Führertums mit der Ueberlieferung eines
großen Friedrich und mit dem Ruhm der Be-
freiung vou Napoleonischer Herrschaft. Von
innerer Bestimmung getrieben, von niemand
gerufen, kommt der preußische Junker Bismarck
in die Preußische Politik. Wer überhaupt die
Frage beantworten wollte, warum gerade hier
der Mann erstand, dem die Gnade gegeben
war, ein neues Reich zu schmieden, der wird
darauf keine andere Antwort geben können
als die: weil hier der Mann erstand, darum
mußte Preußen — Deutschland das Zentrum
des Neuen werden.
Das Herz des Deutschen Volkes schlug mit
dem, der eben das Reich schmiedete.
Wenn wir daher heute Bismarcks und der
Gründung des Raches von 1871 .gedenken,
dann hat dies auch für uns Nationalsozialisten
von heute feine tiefe innere Berechtigung. Seit
der Gründung Preußen-Deutschlands spüren
wir im deutschen Körper eins neue deutsche
Kraft wirksam werden. Ob sie schneller oder
langsamer wirkt und wie sie wächst, das stt
„Geschichte" (um mit Chamberlain zu reden)
Daß sie aber auch die Quelle für späteres
Wachstum ist, das verbindet uns mit dieser
ersten wirkenden Kraft.
BMn M) der ReiKsgOMe.
Daß die Gründung des Bismarckreiches
keine ausgesprochen preußische Angelegen-
heit
mehr war, kann man aus unserer eigenen,
aus badischen Gefch'chte leicht belegen. Es war
ein natürlicher Vorgang, daß mit dem Tode
des alten römischen Reiches, der in die Zeit
der napoleonischen Herrschaft fiel, die Sehn-
sucht nach dem Reiche hier im Süden erneut
aufbrach. Die badischen Markgrafen sahen sich
über Nacht zunächst vor eins .geschichtliche Auf-
gabe gestellt. Sie sind dieser Aufgabe nicht
ausgewichen, sondern haben sie gemeistert,
wenn auch zunächst dynastischem Ziel. Hun-
derte von kleinen und kleinsten deutschen Ge-
bietsteilen am Oberrhein mußten zusammen-
gefaßt, mußten in eine staatliche Einheit ge-
bracht werden. In kurzer Zeit gelang es dem
Markgrafen, Kurfürsten und Großhsrzog Karl
Friedrich die 800jährige Markgrafschaft zum
Großherzogtum auszubauen. Wenn wir heute
mit nationalsozialisty'chen Augen aus diese Ge-
schehnisse zurückblicken, dann sehen wir nicht
nur in dieser
Entstehung Badens eine der Vorftufm
zum Bismarckschen Reich,
wie im Letzteren die Vorstufe zum Reiche
Adolf Hitlers, sondern wir erkennen auch
zwanglos die geschichtliche Parallelerscheinun-
gen zwischen der Erfassung deutscher ober-
rheinischer Splitter damals und der Zusam-
menballung der deutschen Länder zum ein'gen
Reich von heute. Man hat die Tatsache den
süddeutschen Staaten zum Vorwurfe gemacht,
daß ihre Vergrößerung von 1803—1815 dem
Willen Napoleons nicht zuwidergelaufen ist.
Für die Beurteilung der Tat "eines Karl
Friedrich ist aber unerläßlich die Feststellung,
Noch im November kann Bismarck dir
Verträge mit den süddeutschen
Staaten unterzeichnen. Uüd wie zum Ab-
schluß dieser konsequenten Politik ist es wie-
der Großhevzog Friedrich I., der in Versailles
im Spiegelfaa'l den Bann bricht durch den
Ruf: „Es lebe Se. Majestät der Kaiser Wil-
helm I.!". Indessen die Trommeln wirbeln
und die Kanonen über Paris donnern, setzt sich
der Jubel fort uüd ergreift das Heer. Wenn
wir heute am 30. Januar 1935 öen Blick
rückwärts gewendet haben, um das Werden
des Bismarckreiches aus unserer engeren Hei-
mat heraus zu begreifen, dann erkennen wir
zugleich, daß auch jene glänzende Tat nur
eine Stufe bedeutet, über die das deutsche
Volk hinaufgesührt werden mußte,
um zur letzten und endgültigen Form zu
kommen, an der unser heutiges Geschlecht
arbeiten darf.
Wie damals die Deutschen sich gefunden ha-
ben, als sie die Waffen in die Hand nehmen
mußten, so fand sich das Dritte Deutschland
in den Trommelfeuern des Weltkrieges zu der
seelischen Einheit zusammen, die auch nicht
durch 15 Jahre Nachkriegszerfall zerstört wer-
den konnte. Aus der grauen Front von 1914
bis 1918 ist das braune Heer Adolf Hitlers
gewachsen, das die Idee des neuen Reiches in
die Zukunft trägt. Waren es vor 1870 ein-
zelne, die das zweite Reich Bismarcks vorbe-
reiten halfen, so ist es in unseren Tagen eine
große, über alle deutschen Gaue ausgedehnte
und aus allen Gauen organisch und im Kampf
gewachsene und gewordene Bewegung, die
Träger des Dritten Reiches wurde. Stand
Bismarck zeitweilig allein oder fast allein ge-
gen die Widerstände einer ganzen Welt, so ist
uns Heutigen das Glück beschert, nicht nur
den Führer zu haben, sondern auch das ge-
folgschaftsbererte Geschlecht, das "bereit ist, fei-
nem Befehl zu folgen und mit ihm die letzten
und höchsten Lösungen zu erschaffen.
BMWdlM im Z. Reich.
In dem Augenblicke, als der Führer durch
das Reichsstatthaltergefetz an die Spitze der
Länder Beauftragte des Reiches stellte, war
ein entscheidender Schritt bereits getan. Heute
vor einem Jahr ging geschichtlich die Eigen-
staatlichkeit der Länder zu Ende durch die
Nebertragung ihrer Hoheitsrechte auf das
Reich. Der 30. Januar 1935 trifft uns mitten
in der Arbeit an der V e r r e i ch l i ch u n g
e i n z e l n e r V e r w a l t u n g sz w e i ge. Tie
Justizverwaltung ist bereits übevgeleitet und in
der Umorganifation begriffen. Andere Ver-
waltungszweige werden organisch folgen. Die
Schwächen, die dem Bismarckreich noch an-
haften mußten, werden damit endgültig be-
reinigt.
Der heutige Tag bringt ein neues Reich Z-
statthaltergefetz und dis neue Gemeindeord-
nung. Eine auf volklichen, wirtschaftlichen,
verkehrstechnifchen, geographischen und kultu-
rellen Gesichtspunkten gewonnene
Neueinteilung des Reiches in etwa 20
Reichsgaue zu je 3—4 Millionen Ein-
wohnern
wird die Krönung des Werkes sein. Wenn
hier und dort die öffentliche oder halböstent-
liche Diskussion sich mit dem Problem der
Reichsreform beschäftigt, dann ist das Wohl zu
verstehen angesichts der Tatsache, daß war rund
2000 Jahre gebraucht haben, um endlich auf
langen Umwegen den Weg zu uns selbst zu fin-
den. Den privaten Reichsreformern kann ge-
sagt werden, daß wir vor und nach der Ein-
leitung in Verwaltungsbezirke im Deutschen
Reiche leben und loben werden. Und dessen
wollen wir uns herzlich freuen. Im übrigen
ist der Weg zur Neugliederung des Reiches
durch den Führer klar vorgezeichnet mit den
Worten:
„Es wird sich als Endergebnis eine Glie-
derung des Reiches nach zweckmäßigen und
allen Teilen unseres Volkes zugute kom-
nrenden Gesichtspunkten von selbst ergeben.
Die nationalsozialistische Partei hat "schon
längst vor der Machtübernahme in ihrem
eigenen inneren Ausbau eine solche moderns,
unseren heutigen Bedürfnissen entsprechende
Einteilung vorgenommen. Ihrs modifizierte
Uebertragung auf die spätere staatliche Glie-
derung des Reiches wird mit den notwen-
digen Korrekturen im Laufe der Zeit aus
der lebendigen Entwicklung heraus von
selbst stattfinden."
Wir, die wir das Glück haben in irgend-
einer Norm und an irgendeinem Platze an
"diesem Neuen Reiche mitzuavbeiten, werden
die Pflicht haben, dafür zu sorgen, daß diese
Aufgaben mit dem Schwung, der dem Natio-
nalfvtzi'alismus eignet, durchgepaukt iperden.
Wenn die Zeit reif ist, dann muß das Werk in
Angriff genommen und durchgeführt werden.
Nie war in Deutschland dm Augenblick,
MltudmiMer Ar. Wacker
das Podium und führte folgendes aus:
Wenn wir uns heute zufammengefunden ha¬
ben, dann find es es vor allem zwei ganz große
geschichtliche Augenblicke, die uns zu einem
Gedenken Veranlassung geben: Jener Tag 'M
Spiegelsaal zu Versailles, an welchem unter
dem Donner der Geschütze vor Paris eine neue
deutsche Wirklichkeit erstand aus dem Chaos:
das Deutsche Reich Bismarcks, zusammenge-
schweißt zu unauslöschlicher Verbundenheit,
gewachsen aus den Wivnissen und Kämpfen
eines halben Jahrhunderts „deutscher Fra¬
gen", und jener Tag des 30. Januar 1933, an
welchem das Werk von 1871 seine organische
Neugestaltung empfing aus der Hand des Füh¬
rers, in dem die Hoheitsrechte der vor 65
Jahren vereinigten deutschen Länder endgültig
auf das neue Reich übergingen, jen. Tag, an
-dem das „Deutsche" Reich erst recht eigentlich
zu beistehen >cmfing, als eine geschloffene, durch
eine Zentralgswalt geführte staatliche Einheit.
SchnsiM na» dem Reich.
Der Reichsgedanke ist an und für sich so
alt, wie das deutsche Volk selbst.
Unsere Geschichte kennt Zeiten, in denen der
Reichsgedanke Gestalt angenommen .hatte,
wenn auch die Wirklichkeit und die Organisa¬
tion noch nicht die letzte Folgerichtigkeit auf¬
wissen und noch nicht zur Hochform staatlichen
Gemeinschaftslebens aller Deutschen geführt
hatten. Das mittelalterliche deutsche Kaiser¬
tum sah sich noch dem Problem des Impe¬
riums zu sehr gegenüber, als daß es etwa zu
den in die Tiefe führenden Fragen der best¬
möglichsten Organisation in geopolitischer, mi¬
litärischer, wirtschaftlicher oder kultureller
Hinsicht hätte erfolgreich vorstoßen können. Der
Gedanke des „römischen" Reiches mußte zuerst
stevben, bevor die Zeit reif war für den Ge-
danken des „Völkischen" Reiches, das wir das
dritte nennen. Es ist daher kein Zufall, daß die
Sehnsucht nach dem Reich der Deutschen zu¬
nahm im selben Maße, in welchem das römi¬
sche Reich in Verfall geriet. Die Verwirk¬
lichung dieser Sehnsucht war aber noch vor
100 Jahren so fern, daß man nur von einer
deutschen Sehnsucht nach dem
Reiche sprechen konnte, die wie ein Traum
über den politischen Geschehnissen schwebte.
War es bei der Studentenschaft und der Tur-
nerfchaft von 1813 noch ein Traum der deut-
schen Jugend, jo wuchs mit jener Generation,
die Deutschlands Erhebung gegen Napoleon
erlebt hatte, der Reichsgedanke zusehends in
die deutsche Politik hinein, so daß er schließlich
die Politik des 19. Jahrhunderts geradezu be-
herrschte in Gestalt der „deutschen
Frage". Ein jahrzehntelanger Kampf —
bereits seit Jahrhunderten im Anrollsn — ent-
fpinnt sich zwischen Preußen und O e st s r-
reich unter dem inneren Zwang die deutsche
Frage zu lösen, koste es, was es wolle. Die
Politik außerdeutscher Staaten mischt sich hin¬
ein und versuchte eine preußische Lösung mög-
li.chst zu verhindern. Schließlich dreht sich um
die Mitte des vergangenen Jahrhunderts
die ganze europäische Politik mehr oder
weniger um die. Lösung dieser deutschen
Frage.
Sie.ist eine europäische Frage geworden. Das
'Schicksal gab den tätigen Kräften die Möglich¬
keit des Handelns. Hier war es Preußen, das
unter schwersten Bedingungen und unter
schwersten Kämpfen sich an die Aufgabe -der
Losung der deutschen Frage begab, und in
Preußen war es ein Mann, ddssen Lebens¬
arbeit sie wurde, der Kanzler Bismarck
Wahl dis schwerste Entscheidung, die zu er¬
kämpfen war, war die Frage der Führerschaft