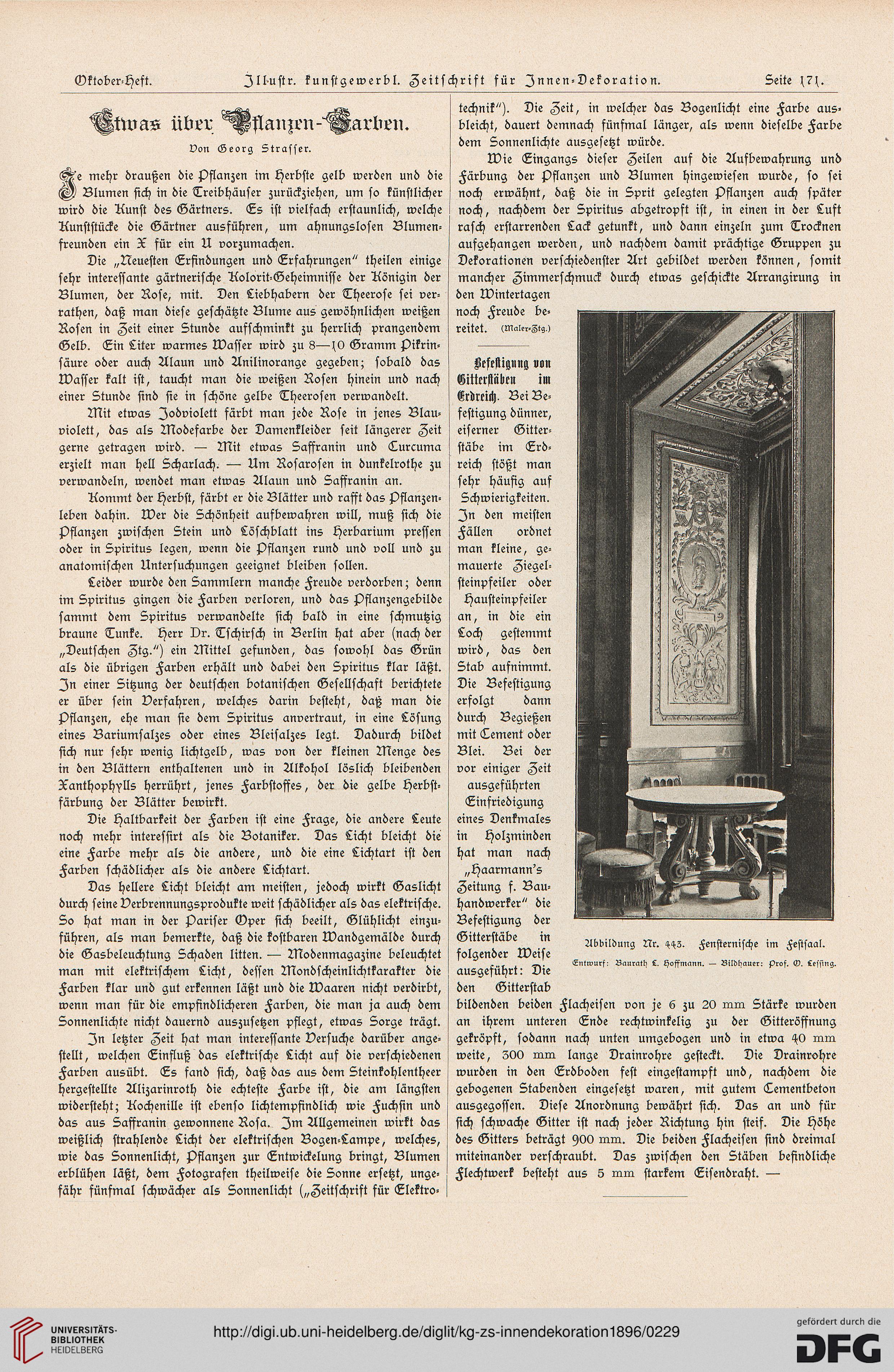Mktober-Heft.
Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.
Seite f7s.
Uwas über
von Georg Straffer.
Me mehr draußen die Pflanzen im Herbste gelb werden und die
kM Blumen sich in die Treibhäuser zurückziehen, um so künstlicher
wird die Kunst des Gärtners. Es ist vielfach erstaunlich, welche
Kunststücke die Gärtner aussühren, um ahnungslosen Blumen-
freunden ein X für ein U vorzumachen.
Die „Neuesten Erfindungen und Erfahrungen" theilen einige
sehr interessante gärtnerische Kolorit-Geheimnisse der Königin der
Blumen, der Rose, mit. Den Liebhabern der Theerose sei ver-
rathen, daß man diese geschätzte Blume aus gewöhnlichen weißen
Rosen in Zeit einer Stunde aufschminkt zu herrlich prangendem
Gelb. Ein Liter warmes Wasser wird zu 8—sO Gramm Pikrin-
säure oder auch Alaun und Anilinorange gegeben; sobald das
Wasser kalt ist, taucht man die weißen Rosen hinein und nach
einer Stunde sind sie in schöne gelbe Theerofen verwandelt.
Mit etwas Zodviolett färbt man jede Rose in jenes Blau-
violett, das als Modefarbe der Damenkleider seit längerer Zeit
gerne getragen wird. — Mit etwas Saffranin und Turcuma
erzielt man hell Scharlach. — Um Rosarosen in dunkelrothe zu
verwandeln, wendet man etwas Alaun und Saffranin an.
Kommt der Herbst, färbt er die Blätter und rafft das Pflanzen-
leben dahin. Wer die Schönheit aufbewahren will, muß sich die
Pflanzen zwischen Stein und Löschblatt ins Herbarium pressen
oder in Spiritus legen, wenn die Pflanzen rund und voll und zu
anatomischen Untersuchungen geeignet bleiben sollen.
Leider wurde den Sammlern manche Freude verdorben; denn
im Spiritus gingen die Farben verloren, und das Pflanzengebilde
sammt dem Spiritus verwandelte sich bald in eine schmutzig
braune Tunke. Herr Dr. Tschirsch in Berlin hat aber (nach der
„Deutschen Ztg.") ein Mittel gefunden, das sowohl das Grün
als die übrigen Farben erhält und dabei den Spiritus klar läßt.
Zn einer Sitzung der deutschen botanischen Gesellschaft berichtete
er über sein Verfahren, welches darin besteht, daß man die
Pflanzen, ehe man sie dem Spiritus anvertraut, in eine Lösung
eines Bariumsalzes oder eines Bleisalzes legt. Dadurch bildet
sich nur sehr wenig lichtgelb, was von der kleinen Menge des
in den Blättern enthaltenen und in Alkohol löslich bleibenden
Ztanthophylls herrührt, jenes Farbstoffes, der die gelbe Herbst-
färbung der Blätter bewirkt.
Die Haltbarkeit der Farben ist eine Frage, die andere Leute
noch mehr interessirt als die Botaniker. Das Licht bleicht die
eine Farbe mehr als die andere, und die eine Lichtart ist den
Farben schädlicher als die andere Lichtart.
Das hellere Licht bleicht am meisten, jedoch wirkt Gaslicht
durch seine Verbrennungsprodukte weit schädlicher als das elektrische.
So hat man in der Pariser Mper sich beeilt, Glühlicht einzu-
führen, als man bemerkte, daß die kostbaren Wandgemälde durch
die Gasbeleuchtung Schaden litten. — Modenmagazine beleuchtet
man mit elektrischem Licht, dessen Mondscheinlichtkarakter die
Farben klar und gut erkennen läßt und die Waaren nicht verdirbt,
wenn man für die empfindlicheren Farben, die man ja auch dem
Sonnenlichte nicht dauernd auszusetzen pflegt, etwas Sorge trägt.
Zn letzter Zeit hat man interessante Versuche darüber ange-
stellt, welchen Einfluß das elektrische Licht auf die verschiedenen
Farben ausübt. Es fand sich, daß das aus dem Steinkohlentheer
hergestellte Alizarinroth die echteste Farbe ist, die am längsten
widersteht; Kochenille ist ebenso lichtempfindlich wie Fuchsin und
das aus Saffranin gewonnene Rosa. Zm Allgemeinen wirkt das
weißlich strahlende Licht der elektrischen Bogen-Lampe, welches,
wie das Sonnenlicht, Pflanzen zur Entwickelung bringt, Blumen
erblühen läßt, dem Fotografen theilweise die Sonne ersetzt, unge-
fähr fünfmal schwächer als Sonnenlicht („Zeitschrift für Elektro-
technik"). Die Zeit, in welcher das Bogenlicht eine Farbe aus-
bleicht, dauert demnach fünfmal länger, als wenn dieselbe Farbe
dem Sonnenlichte ausgesetzt würde.
Wie Eingangs dieser Zeilen auf die Aufbewahrung und
Färbung der Pflanzen und Blumen hingewiesen wurde, so sei
noch erwähnt, daß die in Sprit gelegten Pflanzen auch später
noch, nachdem der Spiritus abgetropft ist, in einen in der Luft
rasch erstarrenden Lack getunkt, und dann einzeln zum Trocknen
aufgehangen werden, und nachdem damit prächtige Gruppen zu
Dekorationen verschiedenster Art gebildet werden können, somit
mancher Zimmerschmuck durch etwas geschickte Arrangirung in
den Wintertagen
noch Freude be-
reitet. (Maler-Ztg.)
Befestigung von
Gitterstiilicn im
Erdreich. Bei Be-
festigung dünner,
eiserner Gitter-
stäbe im Erd-
reich stößt man
sehr häufig auf
Schwierigkeiten.
Zn den meisten
Fällen ordnet
man kleine, ge-
mauerte Ziegel-
steinpfeiler oder
Hausteinpseiler
an, in die ein
Loch gestemmt
wird, das den
Stab aufnimmt.
Die Befestigung
erfolgt dann
durch Begießen
mit Tement oder
Blei. Bei der
vor einiger Zeit
ausgeführten
Einfriedigung
eines Denkmales
in Holzminden
hat man nach
„Haarmann's
Zeitung f. Bau-
handwerker" die
Befestigung der
Gitterstäbe in
folgender Weise
ausgeführt: Die
den Gitterstab
bildenden beiden Flacheisen von je 6 zu 20 mm Stärke wurden
an ihrem unteren Ende rechtwinkelig zu der Gitteröffnung
gekröpft, sodann nach unten umgebogen und in etwa HO mm
weite, 300 mm lange Drainrohre gesteckt. Die Drainrohre
wurden in den Erdboden fest eingestampft und, nachdem die
gebogenen Stabenden eingesetzt waren, mit gutem Tementbeton
ausgegossen. Diese Anordnung bewährt sich. Das an und für
sich schwache Gitter ist nach jeder Richtung hin steif. Die Höhe
des Gitters beträgt Y00 mm. Die beiden Flacheisen sind dreimal
miteinander verschraubt. Das zwischen den Stäben befindliche
Flechtwerk besteht aus 5 mm starkem Eisendraht. —
Abbildung Nr. HHZ. Fensternische im Festsaal.
Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.
Seite f7s.
Uwas über
von Georg Straffer.
Me mehr draußen die Pflanzen im Herbste gelb werden und die
kM Blumen sich in die Treibhäuser zurückziehen, um so künstlicher
wird die Kunst des Gärtners. Es ist vielfach erstaunlich, welche
Kunststücke die Gärtner aussühren, um ahnungslosen Blumen-
freunden ein X für ein U vorzumachen.
Die „Neuesten Erfindungen und Erfahrungen" theilen einige
sehr interessante gärtnerische Kolorit-Geheimnisse der Königin der
Blumen, der Rose, mit. Den Liebhabern der Theerose sei ver-
rathen, daß man diese geschätzte Blume aus gewöhnlichen weißen
Rosen in Zeit einer Stunde aufschminkt zu herrlich prangendem
Gelb. Ein Liter warmes Wasser wird zu 8—sO Gramm Pikrin-
säure oder auch Alaun und Anilinorange gegeben; sobald das
Wasser kalt ist, taucht man die weißen Rosen hinein und nach
einer Stunde sind sie in schöne gelbe Theerofen verwandelt.
Mit etwas Zodviolett färbt man jede Rose in jenes Blau-
violett, das als Modefarbe der Damenkleider seit längerer Zeit
gerne getragen wird. — Mit etwas Saffranin und Turcuma
erzielt man hell Scharlach. — Um Rosarosen in dunkelrothe zu
verwandeln, wendet man etwas Alaun und Saffranin an.
Kommt der Herbst, färbt er die Blätter und rafft das Pflanzen-
leben dahin. Wer die Schönheit aufbewahren will, muß sich die
Pflanzen zwischen Stein und Löschblatt ins Herbarium pressen
oder in Spiritus legen, wenn die Pflanzen rund und voll und zu
anatomischen Untersuchungen geeignet bleiben sollen.
Leider wurde den Sammlern manche Freude verdorben; denn
im Spiritus gingen die Farben verloren, und das Pflanzengebilde
sammt dem Spiritus verwandelte sich bald in eine schmutzig
braune Tunke. Herr Dr. Tschirsch in Berlin hat aber (nach der
„Deutschen Ztg.") ein Mittel gefunden, das sowohl das Grün
als die übrigen Farben erhält und dabei den Spiritus klar läßt.
Zn einer Sitzung der deutschen botanischen Gesellschaft berichtete
er über sein Verfahren, welches darin besteht, daß man die
Pflanzen, ehe man sie dem Spiritus anvertraut, in eine Lösung
eines Bariumsalzes oder eines Bleisalzes legt. Dadurch bildet
sich nur sehr wenig lichtgelb, was von der kleinen Menge des
in den Blättern enthaltenen und in Alkohol löslich bleibenden
Ztanthophylls herrührt, jenes Farbstoffes, der die gelbe Herbst-
färbung der Blätter bewirkt.
Die Haltbarkeit der Farben ist eine Frage, die andere Leute
noch mehr interessirt als die Botaniker. Das Licht bleicht die
eine Farbe mehr als die andere, und die eine Lichtart ist den
Farben schädlicher als die andere Lichtart.
Das hellere Licht bleicht am meisten, jedoch wirkt Gaslicht
durch seine Verbrennungsprodukte weit schädlicher als das elektrische.
So hat man in der Pariser Mper sich beeilt, Glühlicht einzu-
führen, als man bemerkte, daß die kostbaren Wandgemälde durch
die Gasbeleuchtung Schaden litten. — Modenmagazine beleuchtet
man mit elektrischem Licht, dessen Mondscheinlichtkarakter die
Farben klar und gut erkennen läßt und die Waaren nicht verdirbt,
wenn man für die empfindlicheren Farben, die man ja auch dem
Sonnenlichte nicht dauernd auszusetzen pflegt, etwas Sorge trägt.
Zn letzter Zeit hat man interessante Versuche darüber ange-
stellt, welchen Einfluß das elektrische Licht auf die verschiedenen
Farben ausübt. Es fand sich, daß das aus dem Steinkohlentheer
hergestellte Alizarinroth die echteste Farbe ist, die am längsten
widersteht; Kochenille ist ebenso lichtempfindlich wie Fuchsin und
das aus Saffranin gewonnene Rosa. Zm Allgemeinen wirkt das
weißlich strahlende Licht der elektrischen Bogen-Lampe, welches,
wie das Sonnenlicht, Pflanzen zur Entwickelung bringt, Blumen
erblühen läßt, dem Fotografen theilweise die Sonne ersetzt, unge-
fähr fünfmal schwächer als Sonnenlicht („Zeitschrift für Elektro-
technik"). Die Zeit, in welcher das Bogenlicht eine Farbe aus-
bleicht, dauert demnach fünfmal länger, als wenn dieselbe Farbe
dem Sonnenlichte ausgesetzt würde.
Wie Eingangs dieser Zeilen auf die Aufbewahrung und
Färbung der Pflanzen und Blumen hingewiesen wurde, so sei
noch erwähnt, daß die in Sprit gelegten Pflanzen auch später
noch, nachdem der Spiritus abgetropft ist, in einen in der Luft
rasch erstarrenden Lack getunkt, und dann einzeln zum Trocknen
aufgehangen werden, und nachdem damit prächtige Gruppen zu
Dekorationen verschiedenster Art gebildet werden können, somit
mancher Zimmerschmuck durch etwas geschickte Arrangirung in
den Wintertagen
noch Freude be-
reitet. (Maler-Ztg.)
Befestigung von
Gitterstiilicn im
Erdreich. Bei Be-
festigung dünner,
eiserner Gitter-
stäbe im Erd-
reich stößt man
sehr häufig auf
Schwierigkeiten.
Zn den meisten
Fällen ordnet
man kleine, ge-
mauerte Ziegel-
steinpfeiler oder
Hausteinpseiler
an, in die ein
Loch gestemmt
wird, das den
Stab aufnimmt.
Die Befestigung
erfolgt dann
durch Begießen
mit Tement oder
Blei. Bei der
vor einiger Zeit
ausgeführten
Einfriedigung
eines Denkmales
in Holzminden
hat man nach
„Haarmann's
Zeitung f. Bau-
handwerker" die
Befestigung der
Gitterstäbe in
folgender Weise
ausgeführt: Die
den Gitterstab
bildenden beiden Flacheisen von je 6 zu 20 mm Stärke wurden
an ihrem unteren Ende rechtwinkelig zu der Gitteröffnung
gekröpft, sodann nach unten umgebogen und in etwa HO mm
weite, 300 mm lange Drainrohre gesteckt. Die Drainrohre
wurden in den Erdboden fest eingestampft und, nachdem die
gebogenen Stabenden eingesetzt waren, mit gutem Tementbeton
ausgegossen. Diese Anordnung bewährt sich. Das an und für
sich schwache Gitter ist nach jeder Richtung hin steif. Die Höhe
des Gitters beträgt Y00 mm. Die beiden Flacheisen sind dreimal
miteinander verschraubt. Das zwischen den Stäben befindliche
Flechtwerk besteht aus 5 mm starkem Eisendraht. —
Abbildung Nr. HHZ. Fensternische im Festsaal.