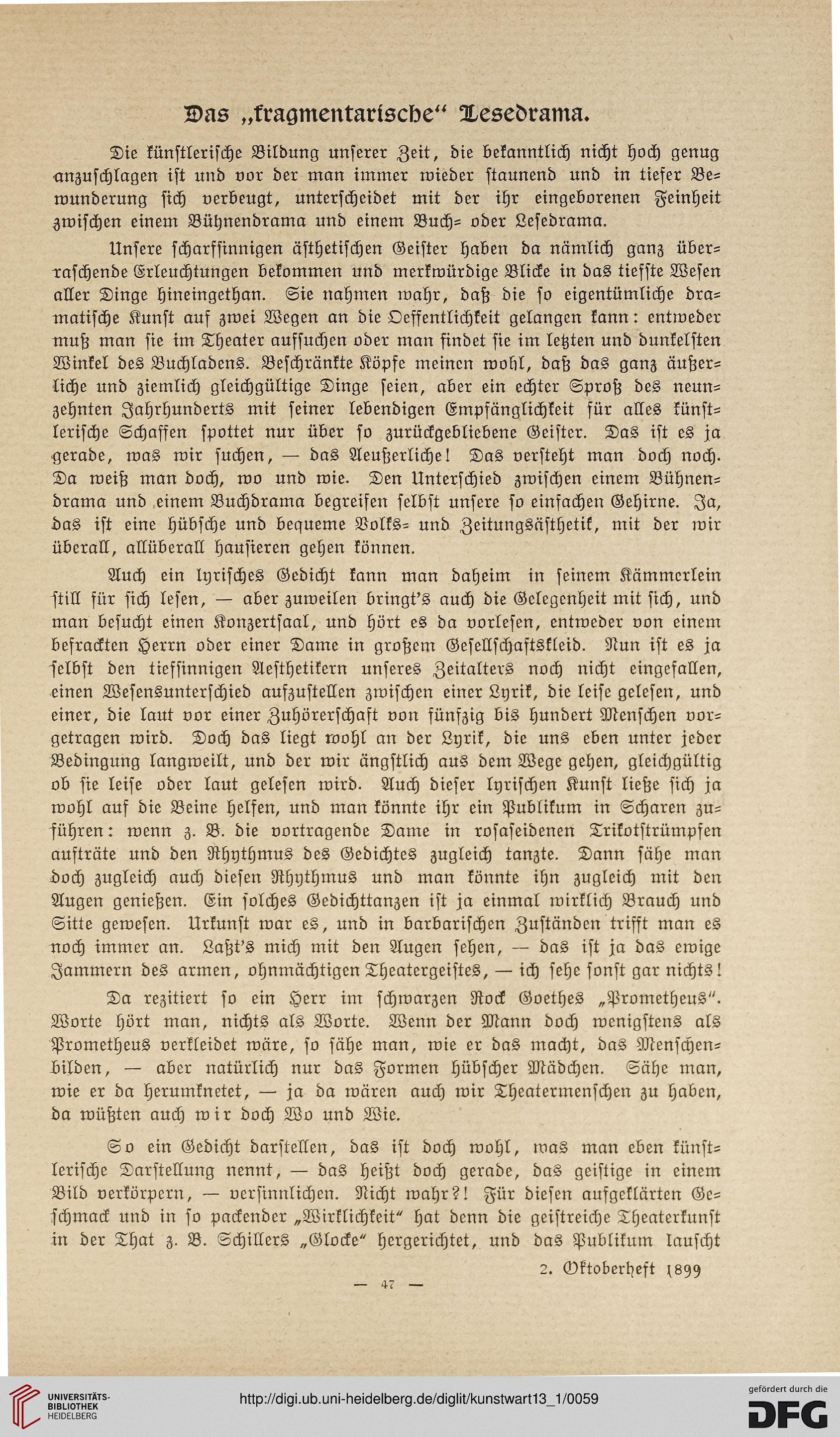Das „kragmentartscbe" Lesedrama.
Die künstlerische Bildung unserer Zeit, die bekanntlich nicht hoch genug
anzuschlagen ist und vor der man immer wieder staunend und in tiefer Be-
wunderung sich verbeugt, unterscheidet mit der ihr eingeborenen Feinheit
zwischen einem Bühnendrama und einem Buch- oder Lesedrama.
Unsere scharfsinnigen ästhetischen Geister haben da nämlich ganz über-
vaschende Erleuchtungen bekommen und merkwürdige Blicke in das tiefste Wesen
aller Dinge hineingethan. Sie nahmen wahr, daß die so eigentümliche dra-
matische Kunst auf zwei Wegen an die Oeffentlichkeit gelangen kann: entweder
muß man sie im Theater aufsuchen oder man stndet sie im letzten und dunkelsten
Winkel des Buchladens. Beschränkte Köpfe meinen wobl, daß das ganz äußer-
liche und ziemlich gleichgültige Dinge seien, aber ein echter Sproß des neun-
zehnten Jahrhunderts mit seiner lebendigen Empfänglichkeit für alles künst-
lerische Schaffen spottet nur über so zurückgebliebene Geister. Das ist es sa
gerade, was wir suchen, — das Aeußerliche! Das versteht man doch noch.
Da weiß man doch, wo und wie. Den Unterschied zwischen einem Bühnen-
drama und einem Buchdrama begreisen selbst unsere so einsachen Gehirne. Ja,
das ist eine hübsche und bequeme Volks- und Zeitungsästhetik, mit der wir
überall, allüberall hausieren gehen können.
Auch ein lyrisches Gedicht kann man daheim in seinem Kämmcrlein
still sür sich lesen, — aber zuweilen bringt's auch die Gelegenheit mit sich, und
man besucht einen Konzertsaal, und hört es da vorlesen, entweder von einem
befrackten Herrn oder einer Dame in großem Gesellschaftskleid. Nun ist es ja
selbst den tiefsinnigen Aesthetikern unseres Zeitalters noch nicht eingefallen,
einen Wesensunterschied aufzustellen zwischen einer Lyrik, die leise gelesen, und
einer, die laut vor einer Zuhörerschaft von fünfzig bis hundert Menschen vor-
getragen wird. Doch das liegt wohl an der Lyrik, die uns eben unter jeder
Bedingung langweilt, und der wir ängstlich aus dem Wege gehen, gleichgültig
ob sie leise oder laut gelesen wird. Auch dieser lyrischen Kunst ließe sich ja
wohl auf die Beine helfen, und man könnte ihr ein Publikum in Scharen zu-
Mhren: wenn z. B. die vortragende Dame in rosaseidenen Trikotstrümpfen
aufträte und den Rhythmus des Gedichtes zugleich tanzte. Dann sähe man
Loch zugleich auch diesen Rhythmus und man könnte ihn zugleich mit den
Augen genießen. Ein solches Gedichttanzen ist ja einmal wirklich Brauch und
Sitte gewesen. Urkunst war es, und in barbarischen Zuftänden trifft man es
noch immer an. Laßt's mich mit den Augen sehen, — das ist ja das ewige
Jammern des armen, ohnmächtigen Theatergeistes, — ich sehe sonst gar nichts!
Da rezitiert so ein Herr im schwarzen Rock Goethes „Prometheus".
Worte hört man, nichts als Worte. Wenn der Mann doch wenigstens als
Prometheus verkleidet wäre, so sähe man, wie er das macht, das Menschen-
-bilden, — aber natürlich nur das Formen hübscher Mädchen. Sähe man,
wie er da herumknetet, — ja da wären auch wir Theatermenschen zu haben,
da wüßten auch wir doch Wo und Wie.
So ein Gedicht darstellen, das ist doch wohl, was man eben künst-
lerische Darstellung nennt, — das heißt doch gerade, das geistige in einem
Bild verkörpern, — versinnlichen. Nicht wahr?! Für diesen aufgeklärten Ge-
schmack und in so packender „Wirklichkeit" hat denn die geistreiche Theaterkunst
in der That z. B. Schillers „Glocke" hergerichtet, und das Publikum lauscht
2. Gktoberhest ^899
Die künstlerische Bildung unserer Zeit, die bekanntlich nicht hoch genug
anzuschlagen ist und vor der man immer wieder staunend und in tiefer Be-
wunderung sich verbeugt, unterscheidet mit der ihr eingeborenen Feinheit
zwischen einem Bühnendrama und einem Buch- oder Lesedrama.
Unsere scharfsinnigen ästhetischen Geister haben da nämlich ganz über-
vaschende Erleuchtungen bekommen und merkwürdige Blicke in das tiefste Wesen
aller Dinge hineingethan. Sie nahmen wahr, daß die so eigentümliche dra-
matische Kunst auf zwei Wegen an die Oeffentlichkeit gelangen kann: entweder
muß man sie im Theater aufsuchen oder man stndet sie im letzten und dunkelsten
Winkel des Buchladens. Beschränkte Köpfe meinen wobl, daß das ganz äußer-
liche und ziemlich gleichgültige Dinge seien, aber ein echter Sproß des neun-
zehnten Jahrhunderts mit seiner lebendigen Empfänglichkeit für alles künst-
lerische Schaffen spottet nur über so zurückgebliebene Geister. Das ist es sa
gerade, was wir suchen, — das Aeußerliche! Das versteht man doch noch.
Da weiß man doch, wo und wie. Den Unterschied zwischen einem Bühnen-
drama und einem Buchdrama begreisen selbst unsere so einsachen Gehirne. Ja,
das ist eine hübsche und bequeme Volks- und Zeitungsästhetik, mit der wir
überall, allüberall hausieren gehen können.
Auch ein lyrisches Gedicht kann man daheim in seinem Kämmcrlein
still sür sich lesen, — aber zuweilen bringt's auch die Gelegenheit mit sich, und
man besucht einen Konzertsaal, und hört es da vorlesen, entweder von einem
befrackten Herrn oder einer Dame in großem Gesellschaftskleid. Nun ist es ja
selbst den tiefsinnigen Aesthetikern unseres Zeitalters noch nicht eingefallen,
einen Wesensunterschied aufzustellen zwischen einer Lyrik, die leise gelesen, und
einer, die laut vor einer Zuhörerschaft von fünfzig bis hundert Menschen vor-
getragen wird. Doch das liegt wohl an der Lyrik, die uns eben unter jeder
Bedingung langweilt, und der wir ängstlich aus dem Wege gehen, gleichgültig
ob sie leise oder laut gelesen wird. Auch dieser lyrischen Kunst ließe sich ja
wohl auf die Beine helfen, und man könnte ihr ein Publikum in Scharen zu-
Mhren: wenn z. B. die vortragende Dame in rosaseidenen Trikotstrümpfen
aufträte und den Rhythmus des Gedichtes zugleich tanzte. Dann sähe man
Loch zugleich auch diesen Rhythmus und man könnte ihn zugleich mit den
Augen genießen. Ein solches Gedichttanzen ist ja einmal wirklich Brauch und
Sitte gewesen. Urkunst war es, und in barbarischen Zuftänden trifft man es
noch immer an. Laßt's mich mit den Augen sehen, — das ist ja das ewige
Jammern des armen, ohnmächtigen Theatergeistes, — ich sehe sonst gar nichts!
Da rezitiert so ein Herr im schwarzen Rock Goethes „Prometheus".
Worte hört man, nichts als Worte. Wenn der Mann doch wenigstens als
Prometheus verkleidet wäre, so sähe man, wie er das macht, das Menschen-
-bilden, — aber natürlich nur das Formen hübscher Mädchen. Sähe man,
wie er da herumknetet, — ja da wären auch wir Theatermenschen zu haben,
da wüßten auch wir doch Wo und Wie.
So ein Gedicht darstellen, das ist doch wohl, was man eben künst-
lerische Darstellung nennt, — das heißt doch gerade, das geistige in einem
Bild verkörpern, — versinnlichen. Nicht wahr?! Für diesen aufgeklärten Ge-
schmack und in so packender „Wirklichkeit" hat denn die geistreiche Theaterkunst
in der That z. B. Schillers „Glocke" hergerichtet, und das Publikum lauscht
2. Gktoberhest ^899