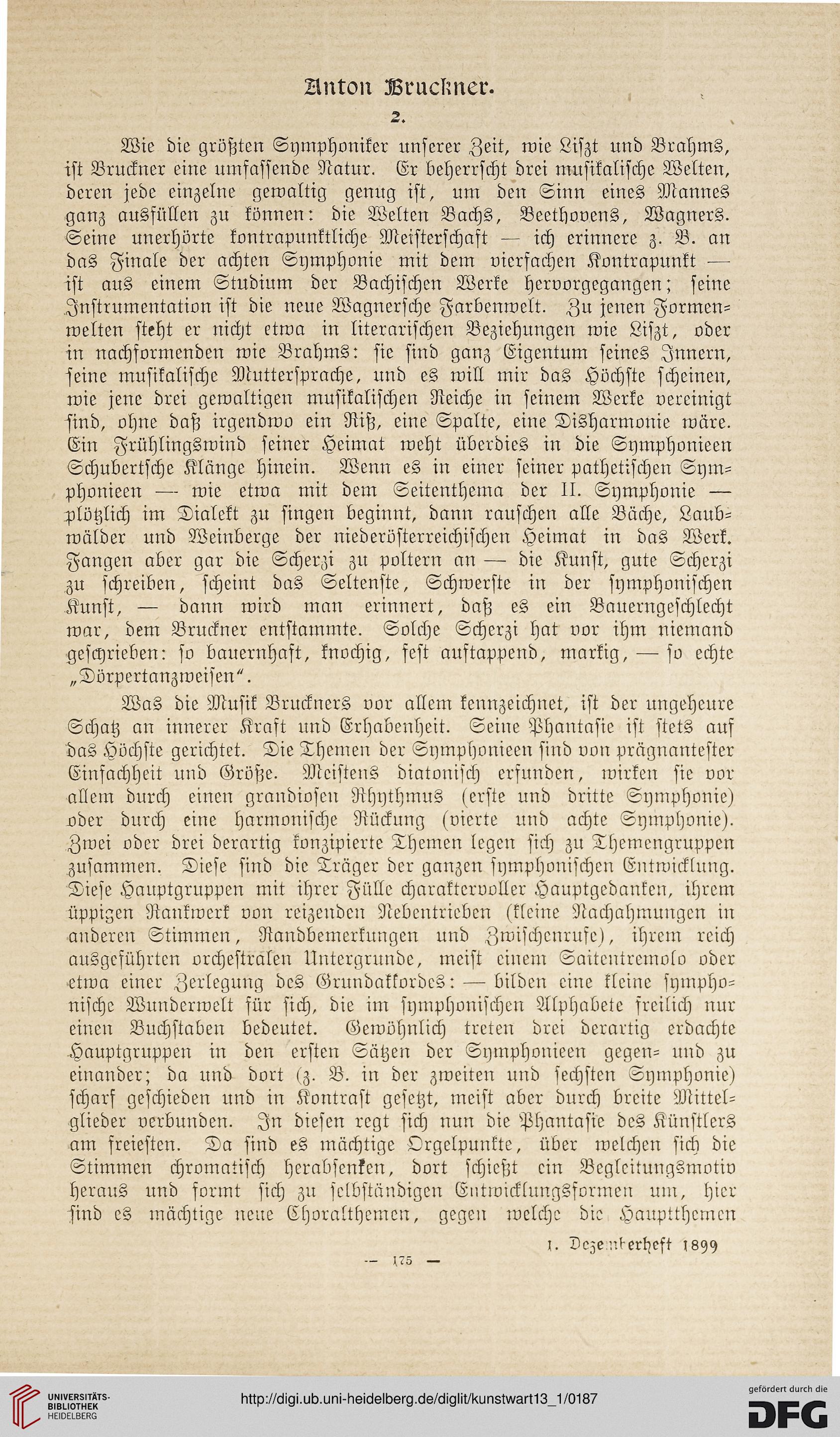Anwir Wruclmer.
2.
Wie die größten Symphoniker unserer Zeit, wie Liszt und Brahms,
ist Bruckner eine umfassende Natur. Er beherrscht drei musikalische Welten,
deren jede einzelne gewaltig genug ist, um den Sinn eines Mannes
ganz ausfüllen zu können: die Welten Bachs, Beethovens, Wagners.
Seine unerhörte kontrapunktliche Meisterschaft — ich erinnere z. B. an
das Finale der achten Symphonie mit dem viersachen Kontrapunkt —
ist aus einem Studium der Bachischen Werke hervorgegangen; seine
Jnstrumentation ist die neue Wagnersche Farbenwelt. Zu jenen Formen-
welten steht er nicht etwa in literarischen Beziehungen wie Liszt, oder
in nachsormenden wie Brahms: sie sind ganz Eigentum seines Jnnern,
seine musikalische Aluttersprache, und es will mir das Höchste scheinen,
wie jene drei gewaltigen musikalischen Reiche in seinem Werke vercinigt
sind, ohne daß irgendwo ein Riß, eine Spalte, eine Disharmonie wäre.
Ein Frühlingswind seiner Heimat weht überdies in die Symphonieen
Schubertsche Klänge hinein. Wenn es in einer seiner pathetischen Sym-
phonieen — wie etwa mit dem Seitenthema der II. Symphonie —
glötzlich im Dialekt zu singen beginnt, dann rauschen alle Büche, Laub-
wälder und Weinberge der niederösterreichischen Heimat in das Werk.
Fangen aber gar die Scherzi zu poltern an — die Kunst, gute Scherzi
zu schreiben, scheint das Seltenste, Schwerste in der symphonischen
Kunst, — dann wird man erinnert, daß es ein Bauerngeschlecht
war, dem Bruckner entstammte. Solche Scherzi hat vor ihm niemand
gescyrieben: so bauernhast, knochig, sest auftappend, markig, — so echte
„Dörpertanzweisen".
Was die Musik Bruckners vor allem kennzeichnet, ist der ungeheure
Schatz an innerer Kraft und Erhabenheit. Seine Phantasie ist stets auf
das Höchste gerichtet. Die Themen der Symphonieen sind von prägnantester
Einsachheit und Größe. Meistens diatonisch ersunden, wirken sie vor
allem durch einen grandiosen Rhythmus (erste und dritte Symphonie)
oder durch eine harmonische Rückung (vierte und achte Symphonie).
Zwei oder drei derartig konzipierte Themen legen sich zu Thewengruppen
gusammen. Diese sind die Träger der ganzen symphonischen Entwicklung.
Diese Hauptgruppen mit ihrer Fülle charaktervoller Hauptgedanken, ihrem
üppigen Rankwerk von reizenden Nebentrieben (kleine Nachahmungen in
anderen Stimmen, Randbemerkungen und Zwischenrufe), ihrem reich
ausgcsührten orchestralen Untergrunde, meist einem Saitentremolo oder
etwa einer Zerlegung des Grundakkordes: — bilden eine kleine sympho-
nische Wunderwelt sür sich, die im symphonischen Alphabete sreilich nur
einen Buchstaben bedeutet. Gewöhnlich treten drei derartig erdachte
Hauptgruppen in den ersten Sätzen der Symphonieen gegen- und zu
einander; da und dort (z. B. in der zweiten und sechsten Symphonie)
scharf geschieden und in Kontrast gesetzt, meist aber durch breite Mittel-
glieder verbunden. Jn diesen regt sich nun die Phantasie des Künstlers
am sreiesten. Da sind es mächtige Orgelpunkte, über welchen sich die
Stimmen chromatisch herabsenken, dort schießt cin Beglcitungsmotiv
heraus und sormt sich zu sclbständigen Entwicklungsformen um, hier
chnd es mächtige neue Choralthemcn, gegen welche die Hauptthemcn
I. Dcze n.terhest 189Y
2.
Wie die größten Symphoniker unserer Zeit, wie Liszt und Brahms,
ist Bruckner eine umfassende Natur. Er beherrscht drei musikalische Welten,
deren jede einzelne gewaltig genug ist, um den Sinn eines Mannes
ganz ausfüllen zu können: die Welten Bachs, Beethovens, Wagners.
Seine unerhörte kontrapunktliche Meisterschaft — ich erinnere z. B. an
das Finale der achten Symphonie mit dem viersachen Kontrapunkt —
ist aus einem Studium der Bachischen Werke hervorgegangen; seine
Jnstrumentation ist die neue Wagnersche Farbenwelt. Zu jenen Formen-
welten steht er nicht etwa in literarischen Beziehungen wie Liszt, oder
in nachsormenden wie Brahms: sie sind ganz Eigentum seines Jnnern,
seine musikalische Aluttersprache, und es will mir das Höchste scheinen,
wie jene drei gewaltigen musikalischen Reiche in seinem Werke vercinigt
sind, ohne daß irgendwo ein Riß, eine Spalte, eine Disharmonie wäre.
Ein Frühlingswind seiner Heimat weht überdies in die Symphonieen
Schubertsche Klänge hinein. Wenn es in einer seiner pathetischen Sym-
phonieen — wie etwa mit dem Seitenthema der II. Symphonie —
glötzlich im Dialekt zu singen beginnt, dann rauschen alle Büche, Laub-
wälder und Weinberge der niederösterreichischen Heimat in das Werk.
Fangen aber gar die Scherzi zu poltern an — die Kunst, gute Scherzi
zu schreiben, scheint das Seltenste, Schwerste in der symphonischen
Kunst, — dann wird man erinnert, daß es ein Bauerngeschlecht
war, dem Bruckner entstammte. Solche Scherzi hat vor ihm niemand
gescyrieben: so bauernhast, knochig, sest auftappend, markig, — so echte
„Dörpertanzweisen".
Was die Musik Bruckners vor allem kennzeichnet, ist der ungeheure
Schatz an innerer Kraft und Erhabenheit. Seine Phantasie ist stets auf
das Höchste gerichtet. Die Themen der Symphonieen sind von prägnantester
Einsachheit und Größe. Meistens diatonisch ersunden, wirken sie vor
allem durch einen grandiosen Rhythmus (erste und dritte Symphonie)
oder durch eine harmonische Rückung (vierte und achte Symphonie).
Zwei oder drei derartig konzipierte Themen legen sich zu Thewengruppen
gusammen. Diese sind die Träger der ganzen symphonischen Entwicklung.
Diese Hauptgruppen mit ihrer Fülle charaktervoller Hauptgedanken, ihrem
üppigen Rankwerk von reizenden Nebentrieben (kleine Nachahmungen in
anderen Stimmen, Randbemerkungen und Zwischenrufe), ihrem reich
ausgcsührten orchestralen Untergrunde, meist einem Saitentremolo oder
etwa einer Zerlegung des Grundakkordes: — bilden eine kleine sympho-
nische Wunderwelt sür sich, die im symphonischen Alphabete sreilich nur
einen Buchstaben bedeutet. Gewöhnlich treten drei derartig erdachte
Hauptgruppen in den ersten Sätzen der Symphonieen gegen- und zu
einander; da und dort (z. B. in der zweiten und sechsten Symphonie)
scharf geschieden und in Kontrast gesetzt, meist aber durch breite Mittel-
glieder verbunden. Jn diesen regt sich nun die Phantasie des Künstlers
am sreiesten. Da sind es mächtige Orgelpunkte, über welchen sich die
Stimmen chromatisch herabsenken, dort schießt cin Beglcitungsmotiv
heraus und sormt sich zu sclbständigen Entwicklungsformen um, hier
chnd es mächtige neue Choralthemcn, gegen welche die Hauptthemcn
I. Dcze n.terhest 189Y