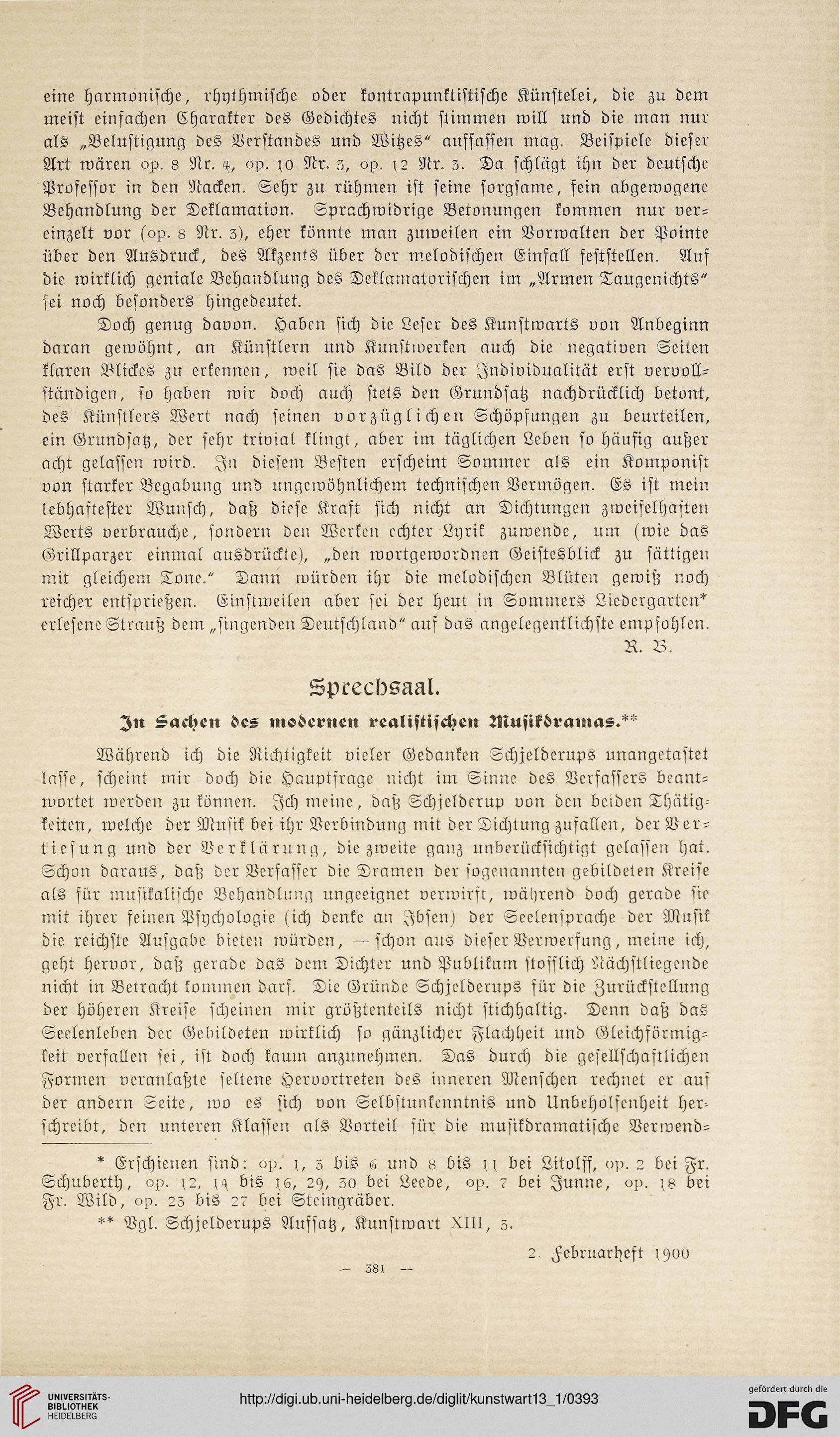eine harmonische, rhythmische oder kontrapunktistische Künstelei, die zu dem
meist einfachen Charakter des Gedichtes nicht stimmen will und die man nur
als „Belustigung des Verstandes und Witzes" auffassen mag. Beispiele dieser
Art wären op. 8 Nr. op. Nr. Z, op. ,2 Nr. 3. Da schlägt ihn der dcutsche
Professor in den Nacken. Sehr zu rühmen ist seine sorgsame, fein abgewogenc
Behandlung der Deklamation. Sprachwidrige Betonungen kommen nur ver-
einzelt vor sop. 8 Nr. z), eher könnte man zuweilen ein Vorwalten der Pointe
über den Ausdruck, des Akzents über der melodischen Einfall feststellen. Aus
die wirklich geniale Behandlung des Deklamatorischen im „Armen Taugenichts"
sei noch besonders hingedeutet.
Doch genug davon. Haben sich dic Leser des Kunstwarts von Anbeginn
daran gewöhnt, an Künstlern und Kunstiverken auch die negativen Seiten
klaren Blickes zu erkennen, weil sie das Vild der Jndividualitüt erst vervoll-
ständigen, so haben wir doch auch stets den Grundsatz nachdrücklich betont,
des Künstlers Wert nach seinen vorzüglichen Schöpfungen zu beurteilen,
ein Grundsatz, der sehr trivial klingt, aber im täglichen Leben so häufig autzer
acht gelassen wird. Jn diesem Besten erscheint Sommer als ein Komponist
von starker Begabung und ungcwöhnlichem technischen Vermögen. Es ist mein
lebhastester Wunsch, datz diese Kraft sich nicht an Dichtungen Zweifelhasten
Werts verbrauche, sondern den Werken echter Lyrik zuwende, um swie das
Grillparzer einmal ausdrückte), „den wortgewordnen Geistesblick zu sättigen
mit gleichem Tone." Dann würden ihr die melodischcn Blüten gewiß noch
reicher entsprießen. Einstweilen aber sei der heut in Sommers Liedergarten*
erlesene Strauß dem „singendeir Deutschland" auf das angelegentlichste empfohlen.
R. B.
Sprecdsaal.
)ri Saclren des rnoöernen realistischen Musikdrarnas.**
Während ich die Richtigkeit vieler Gedanken Schjelderups unangetastet
lasse, scheint mir doch die Hauptfrage nicht im Sinne des Vcrsassers beant-
wortet werdeir zu können. Jch meine, datz Schjelderup von den bciden Thütig-
keiten, welche der Musik bei ihr Verbindung mit der Dichtung zufallen, der V er-
tiefung und der Verklärung, die zweite ganz unberücksichtigt gelassen hat.
Schon daraus, datz der Verfasser die Dramen der sogenannten gebildeten Kreise
als für musikalische Behandlung ungeeigner verwirst, während doch gerade sie
mit ihrer feinen Psychologie (ich denke an Jbsen) der Seelensprache der Musik
die reichste Aufgabe bieten würden, — schon aus dieser Verwersung, meine ich,
geht hervor, datz gerade das dcm Dichter und Publikum stofflich Nächstliegende
nicht in Betracht kominen darf. Die Gründe Schjelderups sür die Zurückstellung
der höheren Kreise scheinen mir grötztenteils nicht stichhaltig. Denn datz das
Seelenleben der Gebildeten wirklich so gänzlicher Flachheit und Gleichförmig-
keit versallen sei, ist doch kaum anzunehmen. Das durch die gesellschastlichen
Formen vcranlaßte seltene Heroortreten des inneren Menschen rechnet er auf
der andern Seite, wo es sich von Selbstunkenntnis und Unbeholfenheit her-
schreibt, den unteren Klassen als Vorteil sür die musikdramatische Verwend-
* Erschienen srnd: op. 1, 3 bis s und 8 bis ^ bei Litolff, op. 2 bei Fr.
Schuberth, op. ^2, ^ bis is, 29, zo bei Leede, op. 7 bei Junne, op. ^3 bei
Fr. Wild, op. 23 bis 27 bei Steingrüber.
** Vgl. Schjelderups Aufsatz, Kunstwart Xlll, z.
2. Februarheft 1900
meist einfachen Charakter des Gedichtes nicht stimmen will und die man nur
als „Belustigung des Verstandes und Witzes" auffassen mag. Beispiele dieser
Art wären op. 8 Nr. op. Nr. Z, op. ,2 Nr. 3. Da schlägt ihn der dcutsche
Professor in den Nacken. Sehr zu rühmen ist seine sorgsame, fein abgewogenc
Behandlung der Deklamation. Sprachwidrige Betonungen kommen nur ver-
einzelt vor sop. 8 Nr. z), eher könnte man zuweilen ein Vorwalten der Pointe
über den Ausdruck, des Akzents über der melodischen Einfall feststellen. Aus
die wirklich geniale Behandlung des Deklamatorischen im „Armen Taugenichts"
sei noch besonders hingedeutet.
Doch genug davon. Haben sich dic Leser des Kunstwarts von Anbeginn
daran gewöhnt, an Künstlern und Kunstiverken auch die negativen Seiten
klaren Blickes zu erkennen, weil sie das Vild der Jndividualitüt erst vervoll-
ständigen, so haben wir doch auch stets den Grundsatz nachdrücklich betont,
des Künstlers Wert nach seinen vorzüglichen Schöpfungen zu beurteilen,
ein Grundsatz, der sehr trivial klingt, aber im täglichen Leben so häufig autzer
acht gelassen wird. Jn diesem Besten erscheint Sommer als ein Komponist
von starker Begabung und ungcwöhnlichem technischen Vermögen. Es ist mein
lebhastester Wunsch, datz diese Kraft sich nicht an Dichtungen Zweifelhasten
Werts verbrauche, sondern den Werken echter Lyrik zuwende, um swie das
Grillparzer einmal ausdrückte), „den wortgewordnen Geistesblick zu sättigen
mit gleichem Tone." Dann würden ihr die melodischcn Blüten gewiß noch
reicher entsprießen. Einstweilen aber sei der heut in Sommers Liedergarten*
erlesene Strauß dem „singendeir Deutschland" auf das angelegentlichste empfohlen.
R. B.
Sprecdsaal.
)ri Saclren des rnoöernen realistischen Musikdrarnas.**
Während ich die Richtigkeit vieler Gedanken Schjelderups unangetastet
lasse, scheint mir doch die Hauptfrage nicht im Sinne des Vcrsassers beant-
wortet werdeir zu können. Jch meine, datz Schjelderup von den bciden Thütig-
keiten, welche der Musik bei ihr Verbindung mit der Dichtung zufallen, der V er-
tiefung und der Verklärung, die zweite ganz unberücksichtigt gelassen hat.
Schon daraus, datz der Verfasser die Dramen der sogenannten gebildeten Kreise
als für musikalische Behandlung ungeeigner verwirst, während doch gerade sie
mit ihrer feinen Psychologie (ich denke an Jbsen) der Seelensprache der Musik
die reichste Aufgabe bieten würden, — schon aus dieser Verwersung, meine ich,
geht hervor, datz gerade das dcm Dichter und Publikum stofflich Nächstliegende
nicht in Betracht kominen darf. Die Gründe Schjelderups sür die Zurückstellung
der höheren Kreise scheinen mir grötztenteils nicht stichhaltig. Denn datz das
Seelenleben der Gebildeten wirklich so gänzlicher Flachheit und Gleichförmig-
keit versallen sei, ist doch kaum anzunehmen. Das durch die gesellschastlichen
Formen vcranlaßte seltene Heroortreten des inneren Menschen rechnet er auf
der andern Seite, wo es sich von Selbstunkenntnis und Unbeholfenheit her-
schreibt, den unteren Klassen als Vorteil sür die musikdramatische Verwend-
* Erschienen srnd: op. 1, 3 bis s und 8 bis ^ bei Litolff, op. 2 bei Fr.
Schuberth, op. ^2, ^ bis is, 29, zo bei Leede, op. 7 bei Junne, op. ^3 bei
Fr. Wild, op. 23 bis 27 bei Steingrüber.
** Vgl. Schjelderups Aufsatz, Kunstwart Xlll, z.
2. Februarheft 1900