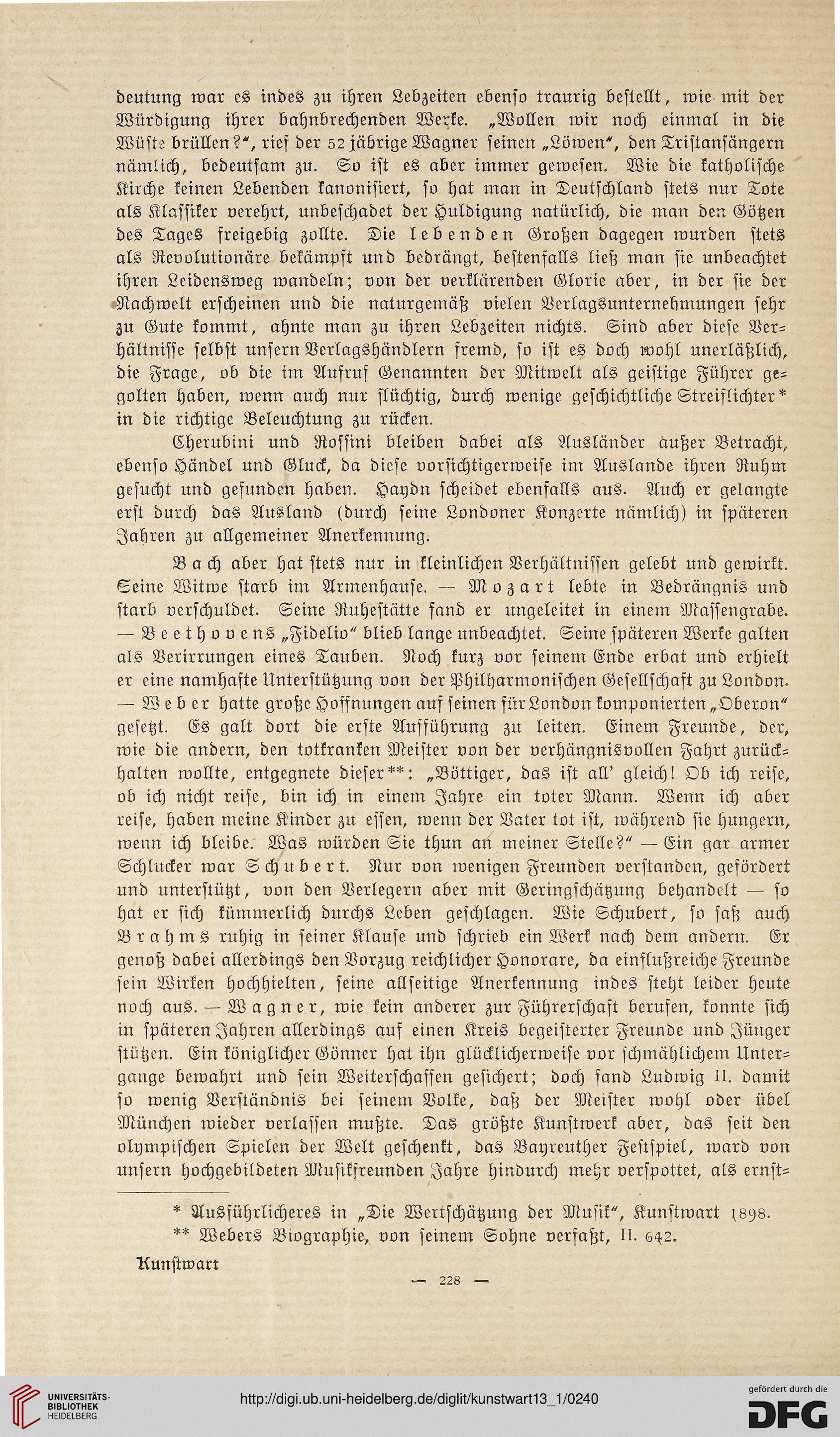deutung roar es indes zu ihren Lebzeiten ebenso traurig bestellt, wie mit der
Würdigung ihrer bahnbrechenden Werke. „Wollen wir noch einmal in die
Wüsts brüllen?", ries der 52 jäbrige Wagner seinen „Löwen", den Tristansängern
nämlich, bedeutsam zu. So ist es aber immer gewesen. Wie die katholische
Kirche keinen Lebenden kanonisiert, so hat man in Deutschland stets nur Tote
als Klassiker verehrt, unbeschadet der Huldigung natürlich, die man den Götzen
des Tages sreigebig zollte. Die lebenden Großen dagegen wurden stets
als Revolutionäre bekämpft und bedrängt, bestensalls ließ man sie unbeachtet
ihren Leidensweg wandeln; von der verklürenden Glorie aber, in der sie der
Nachwelt erscheinen und die naturgemäß vielen Verlagsunternehmungen sehr
zu Gute kommt, ahnte man zu ihren Lebzeiten nichts. Sind aber diese Ver-
hältnisse selbst unsern Verlagshändlern fremd, so ist es doch wohl unerläßlich,
die Frage, ob die im Aufruf Genannten der Mitwelt als geistige Führcr ge-
golten haben, wenn auch nur flüchtig, durch wenige geschichtliche Streislichter*
in die richtige Beleuchtung zu rücken.
Cherubini und Rossini bleiben dabei als Ausländer äußer Betracht,
ebenso Händel und Gluck, da diese vorsichtigerweise im Auslande ihren Ruhm
gesucht und gefunden haben. Haydn scheidet ebenfalls aus. Auch er gelangte
erst durch das Ausland (durch seine Londoner Konzerte nämlich) in späteren
Jahren zu allgemeiner Anerkennung.
Bach aber hat stets nur in kleinlichen Verhältnissen gelebt und gewirkt.
Seine Witwe starb im Armenhause. — Mozart lebte in Bedrängnis und
starb verschuldet. Seine Ruhestätte fand er ungeleitet in einem Massengrabe.
— Beethovens „Fidelio" blieb lange unbeachtet. Seine späteren Werke galten
als Verirrungen eines Tauben. Noch kurz vor seinem Ende erbat und erhielt
er eine namhafte Unterstützung von der Philharmonischen Gesellschaft zu London.
— Weber hatte große Hoffnungen auf seinen fürLondon komponierten „Oberon"
gesetzt. Es galt dort die erste Aufführung zu leiten. Einem Freunde, der,
wie die andern, den totkranken Meister von der verhängnisvollen Fahrt zurück-
halten wollte, entgegnete dieser**: „Böttiger, das ist all' gleich! Ob ich reise,
ob ich nicht reise, bin ich in einem Jahre ein toter Mann. Wenn ich aber
reise, haben meine Kinder zu essen, wenn der Vater tot ist, während sie hungern,
wenn ich bleibe. Was würden Sie thun an meiner Stelle?" — Ein gar armer
Schlucker war Schubert. Nur von wenigen Freunden verstanden, gesördert
und unterstützt, von den Verlegern aber mit Geringschätzung behandelt — so
hat er sich kümmerlich durchs Leben geschlagen. Wie Schubert, so saß auch
Brahms ruhig in seiner Klause und schrieb ein Werk nach dem andern. Er
genoß dabei allerdings den Vorzug reichlicher Honorare, da einslußreiche Freunde
sein Wirken hochhielten, seine allseitige Anerkennung indes steht leider heute
noch aus. — W agn er, wie kein anderer zur Führerschaft berufen, konnte sich
in späteren Jahren allerdings aus einen Kreis begeisterter Freunde und Jünger
stützen. Ein königlicher Gönner hat ihn glücklicherweise vor schmählichem Unter-
gange bewahrt und sein Weiterschassen gesichert; doch sand Ludwig ll. damit
so wenig Verständnis bei seinem Volke, daß der Meister wohl oder übel
München wieder verlassen mußte. Das größte Kunstwerk aber, das seit den
olympischen Spielen der Welt geschenkt, das Bayreuther Festspiel, ward von
unsern hochgebildeten Musikfreunden Jahre hindurch mehr verspottet, als ernst-
* Ausführlicheres in „Die Wertschätzung der Musik", Kunstwart ^898.
** Webers Bwgraphie, von seinem Sohne verfaßt, II. sq.2.
Runstwarr
— 228 —
Würdigung ihrer bahnbrechenden Werke. „Wollen wir noch einmal in die
Wüsts brüllen?", ries der 52 jäbrige Wagner seinen „Löwen", den Tristansängern
nämlich, bedeutsam zu. So ist es aber immer gewesen. Wie die katholische
Kirche keinen Lebenden kanonisiert, so hat man in Deutschland stets nur Tote
als Klassiker verehrt, unbeschadet der Huldigung natürlich, die man den Götzen
des Tages sreigebig zollte. Die lebenden Großen dagegen wurden stets
als Revolutionäre bekämpft und bedrängt, bestensalls ließ man sie unbeachtet
ihren Leidensweg wandeln; von der verklürenden Glorie aber, in der sie der
Nachwelt erscheinen und die naturgemäß vielen Verlagsunternehmungen sehr
zu Gute kommt, ahnte man zu ihren Lebzeiten nichts. Sind aber diese Ver-
hältnisse selbst unsern Verlagshändlern fremd, so ist es doch wohl unerläßlich,
die Frage, ob die im Aufruf Genannten der Mitwelt als geistige Führcr ge-
golten haben, wenn auch nur flüchtig, durch wenige geschichtliche Streislichter*
in die richtige Beleuchtung zu rücken.
Cherubini und Rossini bleiben dabei als Ausländer äußer Betracht,
ebenso Händel und Gluck, da diese vorsichtigerweise im Auslande ihren Ruhm
gesucht und gefunden haben. Haydn scheidet ebenfalls aus. Auch er gelangte
erst durch das Ausland (durch seine Londoner Konzerte nämlich) in späteren
Jahren zu allgemeiner Anerkennung.
Bach aber hat stets nur in kleinlichen Verhältnissen gelebt und gewirkt.
Seine Witwe starb im Armenhause. — Mozart lebte in Bedrängnis und
starb verschuldet. Seine Ruhestätte fand er ungeleitet in einem Massengrabe.
— Beethovens „Fidelio" blieb lange unbeachtet. Seine späteren Werke galten
als Verirrungen eines Tauben. Noch kurz vor seinem Ende erbat und erhielt
er eine namhafte Unterstützung von der Philharmonischen Gesellschaft zu London.
— Weber hatte große Hoffnungen auf seinen fürLondon komponierten „Oberon"
gesetzt. Es galt dort die erste Aufführung zu leiten. Einem Freunde, der,
wie die andern, den totkranken Meister von der verhängnisvollen Fahrt zurück-
halten wollte, entgegnete dieser**: „Böttiger, das ist all' gleich! Ob ich reise,
ob ich nicht reise, bin ich in einem Jahre ein toter Mann. Wenn ich aber
reise, haben meine Kinder zu essen, wenn der Vater tot ist, während sie hungern,
wenn ich bleibe. Was würden Sie thun an meiner Stelle?" — Ein gar armer
Schlucker war Schubert. Nur von wenigen Freunden verstanden, gesördert
und unterstützt, von den Verlegern aber mit Geringschätzung behandelt — so
hat er sich kümmerlich durchs Leben geschlagen. Wie Schubert, so saß auch
Brahms ruhig in seiner Klause und schrieb ein Werk nach dem andern. Er
genoß dabei allerdings den Vorzug reichlicher Honorare, da einslußreiche Freunde
sein Wirken hochhielten, seine allseitige Anerkennung indes steht leider heute
noch aus. — W agn er, wie kein anderer zur Führerschaft berufen, konnte sich
in späteren Jahren allerdings aus einen Kreis begeisterter Freunde und Jünger
stützen. Ein königlicher Gönner hat ihn glücklicherweise vor schmählichem Unter-
gange bewahrt und sein Weiterschassen gesichert; doch sand Ludwig ll. damit
so wenig Verständnis bei seinem Volke, daß der Meister wohl oder übel
München wieder verlassen mußte. Das größte Kunstwerk aber, das seit den
olympischen Spielen der Welt geschenkt, das Bayreuther Festspiel, ward von
unsern hochgebildeten Musikfreunden Jahre hindurch mehr verspottet, als ernst-
* Ausführlicheres in „Die Wertschätzung der Musik", Kunstwart ^898.
** Webers Bwgraphie, von seinem Sohne verfaßt, II. sq.2.
Runstwarr
— 228 —