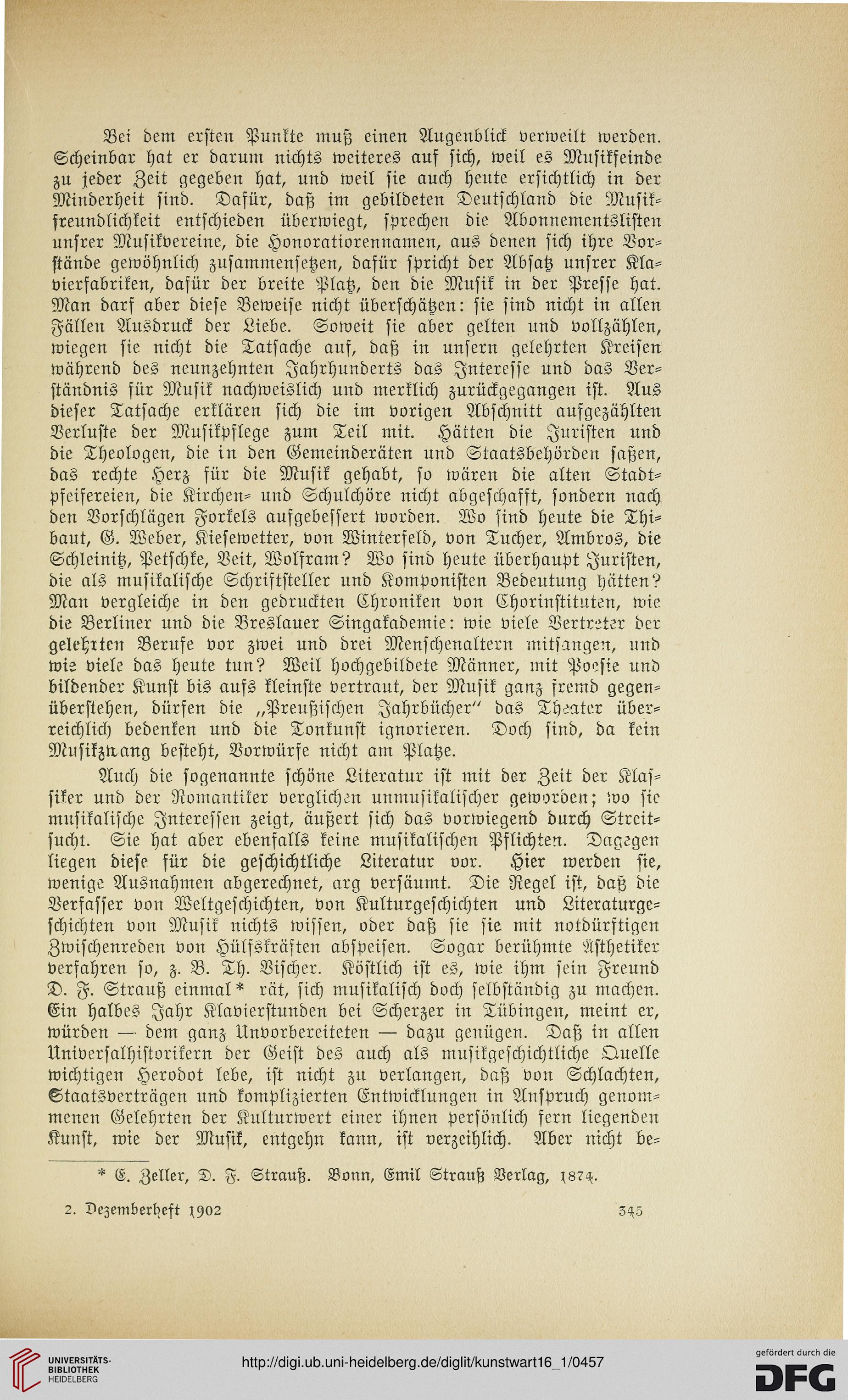Bei dem ersten Punkte mnß einen Augenblick verweilt werden.
Scheinbar hat er darum nichts weiteres auf sich, weil es Musikfeinde
zu jeder Zeit gegeben hat, und weil sie auch heute ersichtlich in der
Minderheit sind. Dafür, daß im gebildeten Deutschland die Mnsik-
sreundlichkeit entschieden überwiegt, sprechen die Abonnementslisten
unsrer Musikvereine, die Honoratiorennamen, aus denen sich ihre Vor-
stände gewöhnlich zusammensetzen, dasür spricht der Absatz unsrer Kla-
vierfabriken, dafür der breite Platz, den die Musik in der Presse hat.
Man darf aber diese Beweise nicht überschätzen: sie sind nicht in allen
Fällen Ausdruck der Liebe. Soweit sie aber gelten und vollzählen,
wiegen sie nicht die Tatsache auf, daß in unsern gelehrten Kreisen
während des neunzehnten Jahrhunderts das Jnteresse und das Ber-
ständnis für Musik nachweislich und merklich zurückgegangen ist. Aus
dieser Tatsache erklären sich die im vorigen Abschnitt ausgezählten
Verluste der Musikpflege zum Teil mit. Hätten die Juristen und
die Theologen, die in den Gemeinderäten und Staatsbehörden saßen,
das rechte Herz sür die Musik gehabt, so wären die alten Stadt-
pfeifereien, die Kirchen- und Schulchöre nicht abgeschasst, sondern nach
den Vorschlägen Forkels aufgebessert worden. Wo sind heute die Thi-
baut, G. Weber, Kiesewetter, von Winterfeld, von Tucher, Ambros, die
Schleinitz, Petschke, Veit, Wolfram? Wo sind heute überhaupt Juristen,
die als musikalische Schriftsteller und Komponisten Bedeutung hätten?
Man vergleiche in den gedruckten Chroniken von Chorinstituten, wie
die Berliner und die Breslaner Singakademie: wie viele Vertreter der
gelehrten Beruse vor zwei und drei Menschenaltern mitsangen, nnd
wie viele das heute tun? Weil hochgebildete Männer, mit Poesie und
bildender Kunst bis aufs kleinste vertraut, der Musik ganz sremd gegen-
überstehen, dürfen die „Preußischen Jahrbücher" das Theater über-
reichlich bedenken und die Tonkunst ignorieren. Doch sind, da kein
Mnsikzwang besteht, Vorwürfe nicht am Platze.
Auch die sogenannte schöne Literatur ist mit der Zeit der Klas-
siker und der Romantiker verglichen unmusikalischer geworden; wo sie
musikalische Jnteressen zeigt, äußert sich das vorwiegend durch Streit-
sucht. Sie hat aber ebenfalls keine musikalischen Pflichten. Dagegen
liegen diese für die geschichtliche Literatur vor. Hier rverden sie,
wenige Ausnahmen abgerechnet, arg versäumt. Die Regel ist, daß die
Verfasser von Weltgeschichten, von Kulturgeschichten und Literaturge-
schichten von Musik nichts wissen, oder daß sie sie mit notdürftigen
Zwischenreden von Hülfskrästen abspeisen. Sogar berühmte Ästhetiker
verfahren so, z. B. Th. Vischer. Köstlich ist es, wie ihm sein Freund
D. F. Strauß einmal* rät, sich musikalisch doch selbständig zu machen.
Ein halbes Jahr Klavierstnnden bei Scherzer in Tübingen, meint er,
würden — dem ganz Unvorbereiteten — dazu genügen. Daß in allen
Universalhistorikern der Geist des auch als musikgeschichtliche Quelle
wichtigen Herodot lebe, ist nicht zu verlangen, daß von Schlachten,
Staatsverträgen und komplizierten Entwicklungen in Anspruch genom-
menen Gelehrten der Kulturwert einer ihnen persönlich fern liegenden
Kunst, wie der Musik, entgehn kann, ist verzeihlich. Aber nicht be-
* E. Zeller, D. F. Strauß. Vonn, Emil Strauß Verlag, ^87^.
2. Dezemberheft t9«2
3^5
Scheinbar hat er darum nichts weiteres auf sich, weil es Musikfeinde
zu jeder Zeit gegeben hat, und weil sie auch heute ersichtlich in der
Minderheit sind. Dafür, daß im gebildeten Deutschland die Mnsik-
sreundlichkeit entschieden überwiegt, sprechen die Abonnementslisten
unsrer Musikvereine, die Honoratiorennamen, aus denen sich ihre Vor-
stände gewöhnlich zusammensetzen, dasür spricht der Absatz unsrer Kla-
vierfabriken, dafür der breite Platz, den die Musik in der Presse hat.
Man darf aber diese Beweise nicht überschätzen: sie sind nicht in allen
Fällen Ausdruck der Liebe. Soweit sie aber gelten und vollzählen,
wiegen sie nicht die Tatsache auf, daß in unsern gelehrten Kreisen
während des neunzehnten Jahrhunderts das Jnteresse und das Ber-
ständnis für Musik nachweislich und merklich zurückgegangen ist. Aus
dieser Tatsache erklären sich die im vorigen Abschnitt ausgezählten
Verluste der Musikpflege zum Teil mit. Hätten die Juristen und
die Theologen, die in den Gemeinderäten und Staatsbehörden saßen,
das rechte Herz sür die Musik gehabt, so wären die alten Stadt-
pfeifereien, die Kirchen- und Schulchöre nicht abgeschasst, sondern nach
den Vorschlägen Forkels aufgebessert worden. Wo sind heute die Thi-
baut, G. Weber, Kiesewetter, von Winterfeld, von Tucher, Ambros, die
Schleinitz, Petschke, Veit, Wolfram? Wo sind heute überhaupt Juristen,
die als musikalische Schriftsteller und Komponisten Bedeutung hätten?
Man vergleiche in den gedruckten Chroniken von Chorinstituten, wie
die Berliner und die Breslaner Singakademie: wie viele Vertreter der
gelehrten Beruse vor zwei und drei Menschenaltern mitsangen, nnd
wie viele das heute tun? Weil hochgebildete Männer, mit Poesie und
bildender Kunst bis aufs kleinste vertraut, der Musik ganz sremd gegen-
überstehen, dürfen die „Preußischen Jahrbücher" das Theater über-
reichlich bedenken und die Tonkunst ignorieren. Doch sind, da kein
Mnsikzwang besteht, Vorwürfe nicht am Platze.
Auch die sogenannte schöne Literatur ist mit der Zeit der Klas-
siker und der Romantiker verglichen unmusikalischer geworden; wo sie
musikalische Jnteressen zeigt, äußert sich das vorwiegend durch Streit-
sucht. Sie hat aber ebenfalls keine musikalischen Pflichten. Dagegen
liegen diese für die geschichtliche Literatur vor. Hier rverden sie,
wenige Ausnahmen abgerechnet, arg versäumt. Die Regel ist, daß die
Verfasser von Weltgeschichten, von Kulturgeschichten und Literaturge-
schichten von Musik nichts wissen, oder daß sie sie mit notdürftigen
Zwischenreden von Hülfskrästen abspeisen. Sogar berühmte Ästhetiker
verfahren so, z. B. Th. Vischer. Köstlich ist es, wie ihm sein Freund
D. F. Strauß einmal* rät, sich musikalisch doch selbständig zu machen.
Ein halbes Jahr Klavierstnnden bei Scherzer in Tübingen, meint er,
würden — dem ganz Unvorbereiteten — dazu genügen. Daß in allen
Universalhistorikern der Geist des auch als musikgeschichtliche Quelle
wichtigen Herodot lebe, ist nicht zu verlangen, daß von Schlachten,
Staatsverträgen und komplizierten Entwicklungen in Anspruch genom-
menen Gelehrten der Kulturwert einer ihnen persönlich fern liegenden
Kunst, wie der Musik, entgehn kann, ist verzeihlich. Aber nicht be-
* E. Zeller, D. F. Strauß. Vonn, Emil Strauß Verlag, ^87^.
2. Dezemberheft t9«2
3^5