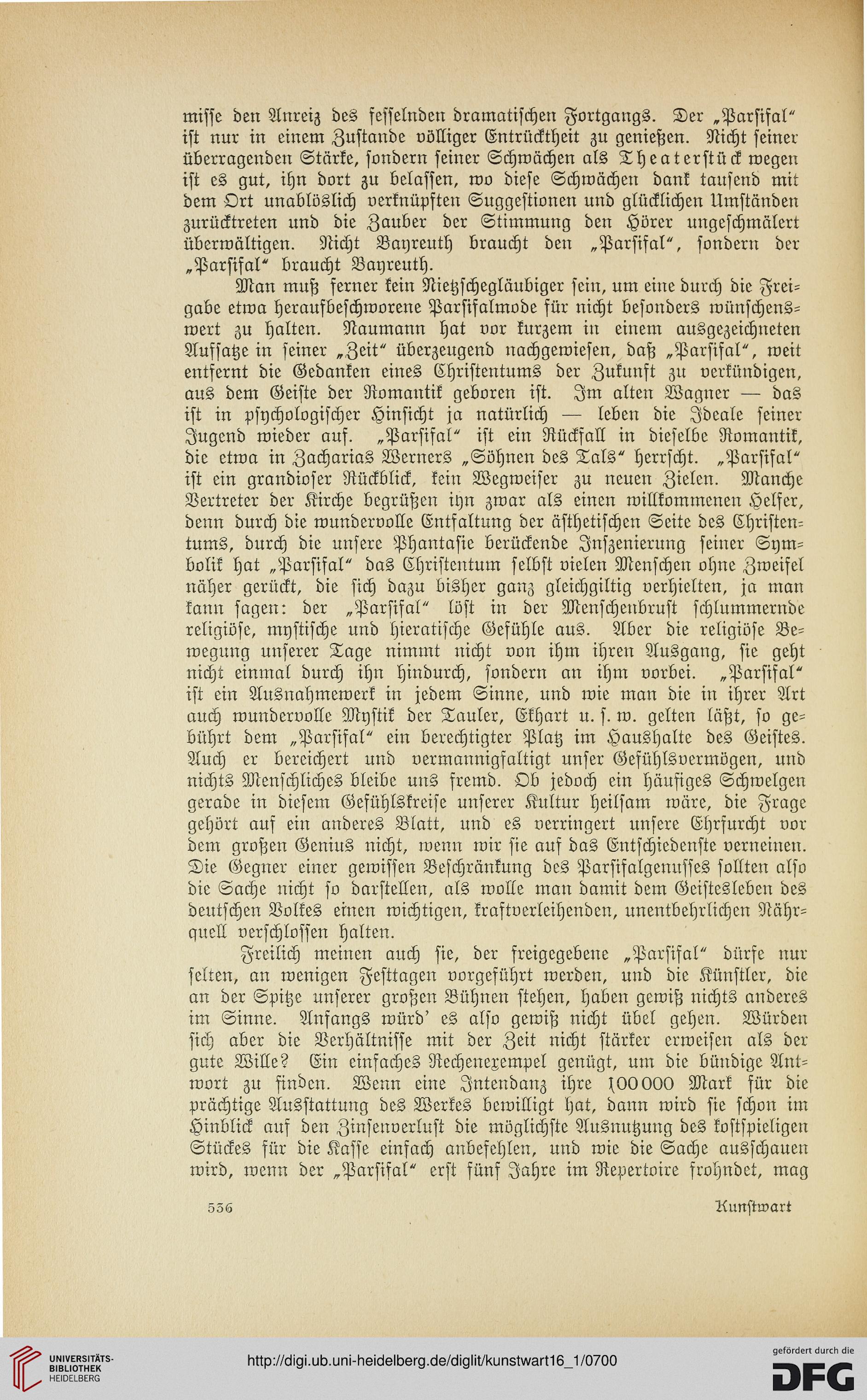misse den Anreiz des sesselnden dramatischen Fortgangs. Der „Parsifal"
ist nur in einem Zustande völliger Entrücktheit zu genießen. Nicht seiner
überragenden Stärke, sondern seiner Schwächen als Theaterstück wegen
ist es gut, ihn dort zu belassen, wo diese Schwächen dank tausend mit
dem Ort unablöslich verknüpften Suggestionen und glücklichen Umständen
zurücktreten und die Zauber der Stimmung den Hörer ungeschmälert
überwältigen. Nicht Bayreuth braucht den „Parsisal", sondern der
„Parsifal" braucht Bayreuth.
Man muß ferner kein Nietzschegläubiger sein, um eine durch die Frei-
gabe etwa heraufbeschworene Parsifalmode sür nicht besonders wünschens-
wert zu halten. Naumann hat vor kurzem in einem ausgezeichneten
Aussatze in seiner „Zeit" überzeugend nachgewiesen, daß „Parsifal", weit
entsernt die Gedanken eines Christentums der Zukunst zu verkündigen,
aus dem Geiste der Romantik geboren ist. Jm alten Wagner — das
ist in psychologischer Hinsicht sa natürlich — leben die Jdeale seiner
Jugend wieder aus. „Parsifal" ist ein Rücksall in dieselbe Romantik,
die etwa in Zacharias Werners „Söhnen des Tals" herrscht. „Parsifal"
ist ein grandioser Rückblick, kein Wegweiser zu neuen Zielen. Manche
Vertreter der Kirche begrüßen iyn zwar als einen willkommenen Helfer,
denn durch die wundervolle Entsaltung der ästhetischen Seite des Christen-
tums, durch die unsere Phantasie berückende Jnszenierung seiner Sym-
bolik hat „Parsisal" das Christentum selbst vielen Menschen ohne Zweifel
näher gerückt, die sich dazu üisher ganz gleichgiltig verhielten, ja man
kann sagen: der „Parsisal" löst in der Menschenbrust schlummernde
religiöse, mystische und hieratische Gesühle aus. Aber die religiöse Be-
wegung unserer Tage nimmt nicht von ihm ihren Ausgang, sie geht
nicht einmal durch ihn hindurch, sondern an ihm vorbei. „Parsifal"
ist ein Ausnahmewerk in jedem Sinne, und wie man die in ihrer Art
auch wundervolle Mystik der Tauler, Ekhart u. s. w. gelten läßt, so ge-
bührt dem „Parsifal" ein berechtigter Platz im Haushalte des Geistes.
Auch er bereichert und vermannigsaltigt unser Gesühlsvermögen, und
nichts Menschliches bleibe uns fremd. Ob jedoch ein häufiges Schwelgen
gerade in diesem Gefühlskreise unserer Kultur heilsam würe, die Frage
gehört aus ein anderes Blatt, und es verringert unsere Ehrfurcht vor
dem großen Genius nicht, wenn wir sie auf das Entschiedenste verneinen.
Die Gegner einer gewissen Beschränkung des Parsifalgenusses sollten also
die Sache nicht so darstellen, als wolle man damit dem Geistesleben des
deutschen Volkes einen wichtigen, krastverleihenden, unentbehrlichen Nähr-
quell verschlossen halten.
Freilich meinen auch sie, der freigegebene „Parsifal" dürse nur
selten, an wenigen Festtagen vorgeführt werden, und die Künstler, die
an der Spitze unserer großen Bühnen stehen, haben gewiß nichts anderes
im Sinne. Anfangs würd' es also gewiß nicht übel gehen. Würden
sich aber die Verhältnisse mit der Zeit nicht stärker erweisen als der
gute Wille? Ein einfaches Rechenexempel genügt, um die bündige Ant-
wort zu sinden. Wenn eine Jntendanz ihre jOOOOO Mark sür die
prächtige Ausstattung des Werkes bewilligt hat, dann wird sie schon im
Hinblick aus den Zinsenverlust die möglichste Ausnutzung des kostspieligen
Stückes für die Kasse einfach anbesehlen, und wie die Sache ausschauen
wird, wenn der „Parsisal" erst fünf Jahre im Repertoire srohndet, mag
Runstwart
ist nur in einem Zustande völliger Entrücktheit zu genießen. Nicht seiner
überragenden Stärke, sondern seiner Schwächen als Theaterstück wegen
ist es gut, ihn dort zu belassen, wo diese Schwächen dank tausend mit
dem Ort unablöslich verknüpften Suggestionen und glücklichen Umständen
zurücktreten und die Zauber der Stimmung den Hörer ungeschmälert
überwältigen. Nicht Bayreuth braucht den „Parsisal", sondern der
„Parsifal" braucht Bayreuth.
Man muß ferner kein Nietzschegläubiger sein, um eine durch die Frei-
gabe etwa heraufbeschworene Parsifalmode sür nicht besonders wünschens-
wert zu halten. Naumann hat vor kurzem in einem ausgezeichneten
Aussatze in seiner „Zeit" überzeugend nachgewiesen, daß „Parsifal", weit
entsernt die Gedanken eines Christentums der Zukunst zu verkündigen,
aus dem Geiste der Romantik geboren ist. Jm alten Wagner — das
ist in psychologischer Hinsicht sa natürlich — leben die Jdeale seiner
Jugend wieder aus. „Parsifal" ist ein Rücksall in dieselbe Romantik,
die etwa in Zacharias Werners „Söhnen des Tals" herrscht. „Parsifal"
ist ein grandioser Rückblick, kein Wegweiser zu neuen Zielen. Manche
Vertreter der Kirche begrüßen iyn zwar als einen willkommenen Helfer,
denn durch die wundervolle Entsaltung der ästhetischen Seite des Christen-
tums, durch die unsere Phantasie berückende Jnszenierung seiner Sym-
bolik hat „Parsisal" das Christentum selbst vielen Menschen ohne Zweifel
näher gerückt, die sich dazu üisher ganz gleichgiltig verhielten, ja man
kann sagen: der „Parsisal" löst in der Menschenbrust schlummernde
religiöse, mystische und hieratische Gesühle aus. Aber die religiöse Be-
wegung unserer Tage nimmt nicht von ihm ihren Ausgang, sie geht
nicht einmal durch ihn hindurch, sondern an ihm vorbei. „Parsifal"
ist ein Ausnahmewerk in jedem Sinne, und wie man die in ihrer Art
auch wundervolle Mystik der Tauler, Ekhart u. s. w. gelten läßt, so ge-
bührt dem „Parsifal" ein berechtigter Platz im Haushalte des Geistes.
Auch er bereichert und vermannigsaltigt unser Gesühlsvermögen, und
nichts Menschliches bleibe uns fremd. Ob jedoch ein häufiges Schwelgen
gerade in diesem Gefühlskreise unserer Kultur heilsam würe, die Frage
gehört aus ein anderes Blatt, und es verringert unsere Ehrfurcht vor
dem großen Genius nicht, wenn wir sie auf das Entschiedenste verneinen.
Die Gegner einer gewissen Beschränkung des Parsifalgenusses sollten also
die Sache nicht so darstellen, als wolle man damit dem Geistesleben des
deutschen Volkes einen wichtigen, krastverleihenden, unentbehrlichen Nähr-
quell verschlossen halten.
Freilich meinen auch sie, der freigegebene „Parsifal" dürse nur
selten, an wenigen Festtagen vorgeführt werden, und die Künstler, die
an der Spitze unserer großen Bühnen stehen, haben gewiß nichts anderes
im Sinne. Anfangs würd' es also gewiß nicht übel gehen. Würden
sich aber die Verhältnisse mit der Zeit nicht stärker erweisen als der
gute Wille? Ein einfaches Rechenexempel genügt, um die bündige Ant-
wort zu sinden. Wenn eine Jntendanz ihre jOOOOO Mark sür die
prächtige Ausstattung des Werkes bewilligt hat, dann wird sie schon im
Hinblick aus den Zinsenverlust die möglichste Ausnutzung des kostspieligen
Stückes für die Kasse einfach anbesehlen, und wie die Sache ausschauen
wird, wenn der „Parsisal" erst fünf Jahre im Repertoire srohndet, mag
Runstwart