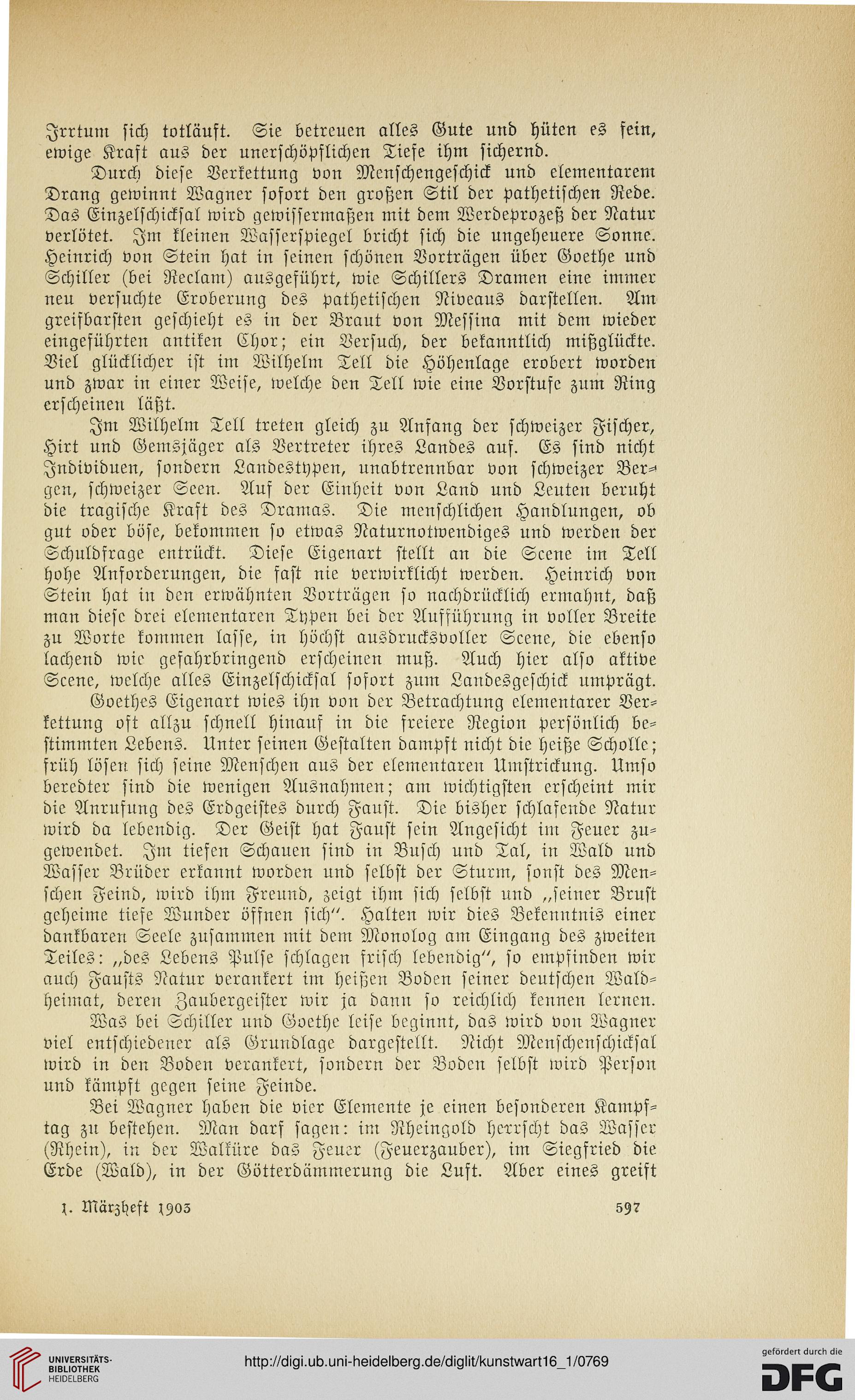Jrrtum sich totläuft. Sie betreuen alles Gute uud hüten es fein,
ewige Kraft aus der unerschöpflichen Tiefe ihm sichernd.
Durch diefe Verkettung von Menschengefchick und elementarem
Drang gewinnt Wagner fofort den großen Stil der pathetischen Rede.
Das Einzelschicksal wird gewissermaßen mit dem Werdeprozeß der Natur
verlötet. Jm kleinen Wasserfpiegel bricht sich die ungehenere Sonne.
Heinrich von Stein hat in seinen schönen Vorträgen über Goethe und
Schiller (bei Reclam) ausgesührt, wie Schillers Dramen eine immer
neu versuchte Eroberung des pathetischen Niveaus darstellen. Am
greisbarsten geschieht es in der Braut von Messina mit dem wieder
eingeführten antiken Chor; ein Versuch, der bekanntlich mißglückte.
Viel glücklicher ist im Wilhelm Tell die Höhenlage erobert worden
und zwar in einer Weise, welche den Tell wie eine Vorstufe zum Ring
erscheinen läßt.
Jm Wilhelm Tell treten gleich zu Anfang der schweizer Fischer,
Hirt und Gemsjäger als Vertreter ihres Landes auf. Es sind nicht
Jndividuen, sondern Landestypen, unabtrennbar von schweizer Ber-<
gen, schweizer Seen. Auf der Einheit von Land und Leuten beruht
die tragische Krast des Dramas. Die menschlichen Handlnngen, ob
gut oder böse, bekommen so etwas Naturnotwendiges und werden der
Schuldfrage entrückt. Diese Eigenart stellt an die Scene im Tell
hohe Anforderungen, die sast nie verwirklicht werden. Heinrich von
Stein hat in den erwähnten Vortrügen so nachdrücklich ermahnt, daß
man diese drei elementaren Typen bei dcr Ausführung in voller Breite
zu Worte kommen lasse, in höchst ausdrucksvoller Scene, die ebenso
lachend wie gefahrbringend erscheinen muß. Auch hier also aktive
Scene, welche alles Einzelschicksal sofort zum Landesgeschick umprägt.
Goethes Eigenart wies ihn von der Betrachtung elementarer Ver-
kettung oft allzu schnell hinaus in die sreiere Region persönlich be-
stimmten Lebens. Unter seinen Gestalten dampft nicht die heiße Scholle;
früh lösen sich seine Menschen aus der elementaren Umstrickung. Umso
beredter sind die wenigen Ausnahmen; am wichtigsten erscheint mir
die Anrufung des Erdgeistes durch Faust. Die bisher schlafende Natur
wird da lebendig. Der Geist hat Faust sein Angesicht im Feuer zu-
gewendet. Jm tiesen Schauen sind in Busch und Tal, in Wald und
Wasser Brüder erkannt worden und selbst der Sturm, sonst des Men-
schen Feind, wird ihm Freund, zeigt ihm sich selbst und „seiner Brust
gcheime tiefe Wunder öffnen sich". Halten wir dies Bekenntnis einer
dankbaren Seele zusammen mit dem Monolog am Eingang des zweiten
Teiles: „des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig", so empfinden wir
auch Fausts Natur verankert im heißen Boden seiner deutschen Wald-
heimat, deren Zaubergeister wir ja dann so reichlich kennen lernen.
Was bei Schiller und Goethe leise beginnt, das wird von Wagner
viel entschiedener als Grundlage dargestellt. Nicht Menschenschicksal
wird in den Boden verankert, sondern der Boden selbst wird Person
und kämpft gegen seine Feinde.
Bei Wagner haben die vier Elemente je einen besonderen Kampf-
tag zu bestehen. Man darf sagen: im Rheingold herrscht das Wasser
(Rhein), in der Walküre das Feuer (Feuerzauber), im Siegfried die
Erde (Wald), in der Götterdämmerung die Luft. Aber eines greift
1. Märzheft tZos
59?
ewige Kraft aus der unerschöpflichen Tiefe ihm sichernd.
Durch diefe Verkettung von Menschengefchick und elementarem
Drang gewinnt Wagner fofort den großen Stil der pathetischen Rede.
Das Einzelschicksal wird gewissermaßen mit dem Werdeprozeß der Natur
verlötet. Jm kleinen Wasserfpiegel bricht sich die ungehenere Sonne.
Heinrich von Stein hat in seinen schönen Vorträgen über Goethe und
Schiller (bei Reclam) ausgesührt, wie Schillers Dramen eine immer
neu versuchte Eroberung des pathetischen Niveaus darstellen. Am
greisbarsten geschieht es in der Braut von Messina mit dem wieder
eingeführten antiken Chor; ein Versuch, der bekanntlich mißglückte.
Viel glücklicher ist im Wilhelm Tell die Höhenlage erobert worden
und zwar in einer Weise, welche den Tell wie eine Vorstufe zum Ring
erscheinen läßt.
Jm Wilhelm Tell treten gleich zu Anfang der schweizer Fischer,
Hirt und Gemsjäger als Vertreter ihres Landes auf. Es sind nicht
Jndividuen, sondern Landestypen, unabtrennbar von schweizer Ber-<
gen, schweizer Seen. Auf der Einheit von Land und Leuten beruht
die tragische Krast des Dramas. Die menschlichen Handlnngen, ob
gut oder böse, bekommen so etwas Naturnotwendiges und werden der
Schuldfrage entrückt. Diese Eigenart stellt an die Scene im Tell
hohe Anforderungen, die sast nie verwirklicht werden. Heinrich von
Stein hat in den erwähnten Vortrügen so nachdrücklich ermahnt, daß
man diese drei elementaren Typen bei dcr Ausführung in voller Breite
zu Worte kommen lasse, in höchst ausdrucksvoller Scene, die ebenso
lachend wie gefahrbringend erscheinen muß. Auch hier also aktive
Scene, welche alles Einzelschicksal sofort zum Landesgeschick umprägt.
Goethes Eigenart wies ihn von der Betrachtung elementarer Ver-
kettung oft allzu schnell hinaus in die sreiere Region persönlich be-
stimmten Lebens. Unter seinen Gestalten dampft nicht die heiße Scholle;
früh lösen sich seine Menschen aus der elementaren Umstrickung. Umso
beredter sind die wenigen Ausnahmen; am wichtigsten erscheint mir
die Anrufung des Erdgeistes durch Faust. Die bisher schlafende Natur
wird da lebendig. Der Geist hat Faust sein Angesicht im Feuer zu-
gewendet. Jm tiesen Schauen sind in Busch und Tal, in Wald und
Wasser Brüder erkannt worden und selbst der Sturm, sonst des Men-
schen Feind, wird ihm Freund, zeigt ihm sich selbst und „seiner Brust
gcheime tiefe Wunder öffnen sich". Halten wir dies Bekenntnis einer
dankbaren Seele zusammen mit dem Monolog am Eingang des zweiten
Teiles: „des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig", so empfinden wir
auch Fausts Natur verankert im heißen Boden seiner deutschen Wald-
heimat, deren Zaubergeister wir ja dann so reichlich kennen lernen.
Was bei Schiller und Goethe leise beginnt, das wird von Wagner
viel entschiedener als Grundlage dargestellt. Nicht Menschenschicksal
wird in den Boden verankert, sondern der Boden selbst wird Person
und kämpft gegen seine Feinde.
Bei Wagner haben die vier Elemente je einen besonderen Kampf-
tag zu bestehen. Man darf sagen: im Rheingold herrscht das Wasser
(Rhein), in der Walküre das Feuer (Feuerzauber), im Siegfried die
Erde (Wald), in der Götterdämmerung die Luft. Aber eines greift
1. Märzheft tZos
59?