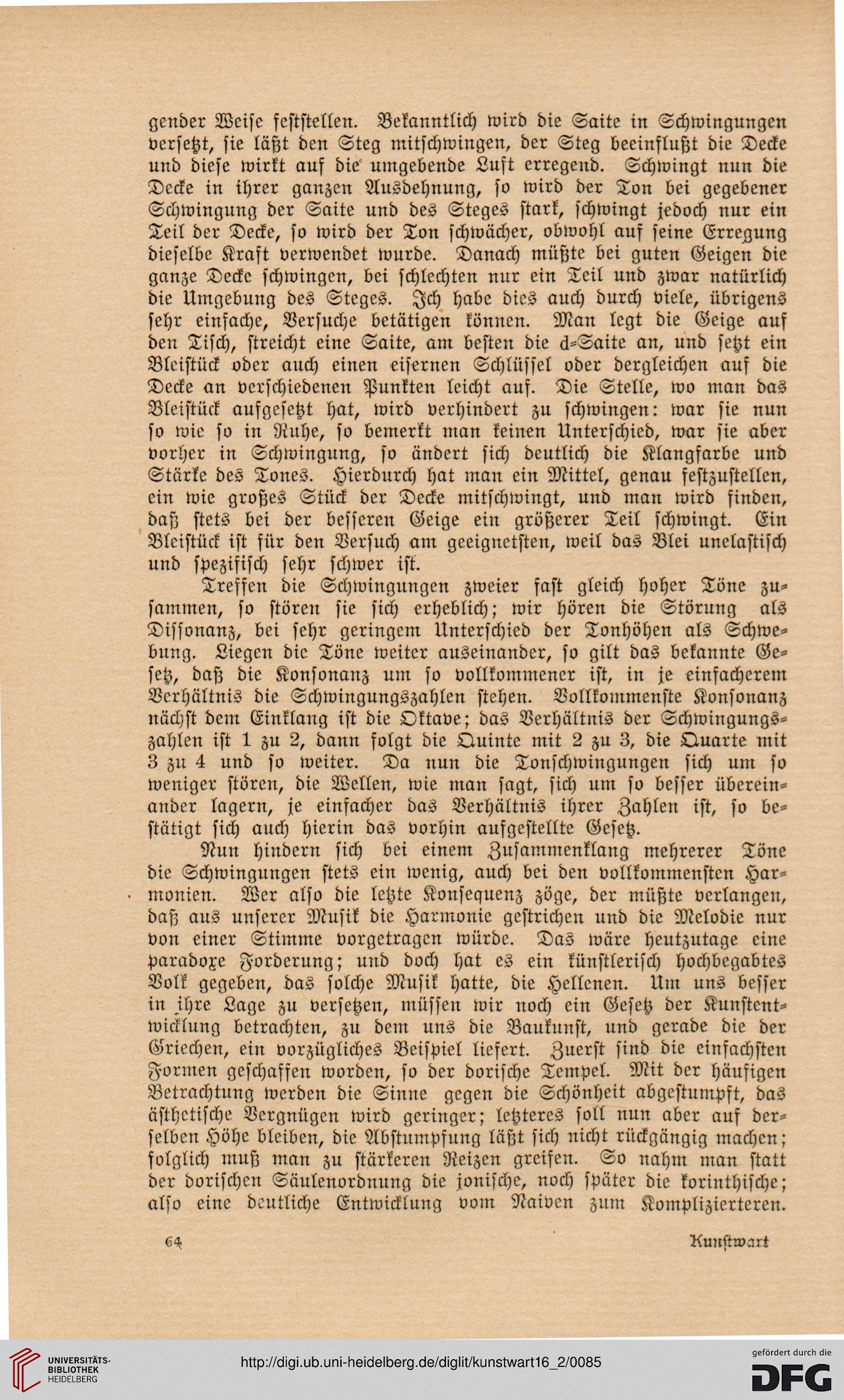gender Weise festftellen. Bekanntlich wird die Saite in Schwingungen
versetzt, sie läßt den Steg mitschwingen, der Steg beeinflußt die Decke
und diese wirkt auf die umgebende Luft erregend. Schwingt nun die
Decke in ihrer ganzen Ausdehnung, so wird der Ton bei gegebener
Schwingung der Saite und des Steges stark, schwingt jedoch nur ein
Teil der Decke, so wird der Ton schwächer, obwohl auf seine Erregung
dieselbe Kraft verwendet wurde. Danach müßte bei guten Geigen die
ganze Deckc schwingen, bei schlechten nur ein Teil und zwar natürlich
die Umgebung des Steges. Jch habe dies auch durch viele, übrigens
sehr einfache, Versuche betätigen können. Man legt die Geige auf
den Tisch, streicht eine Saite, am besten die ä-Saite an, und setzt ein
Bleistück oder auch einen eisernen Schlüssel oder dergleichen auf die
Decke an verschiedenen Punkten leicht auf. Die Stelle, wo man das
Bleistück aufgesetzt hat, wird verhindert zu schwingen: war sie nun
so wie so in Ruhe, so bemerkt man keinen Unterschied, war sie aber
vorher in Schwingung, so ändert sich deutlich die Klangfarbe und
Stärke des Tones. Hierdurch hat man ein Mittel, genau festzustellen,
ein wie großes Stück der Decke mitschwingt, und man wird finden,
daß stets bei der besseren Geige ein größerer Teil schwingt. Ein
Blcistück ist für den Versuch am geeignetsten, weil das Blei unelastisch
und spezifisch sehr schwer ist.
Treffen die Schwingungen zweier fast gleich hoher Töne zu-
sammen, so stören sie sich erheblich; wir hören die Störung als
Dissonanz, bei sehr geringem Unterschied der Tonhöhen als Schwe-
bung. Liegen dic Töne weiter auseinander, so gilt das bekannte Ge-
setz, daß die Konsonanz um so vollkommener ist, in je einfacherem
Vcrhältnis die Schwingungszahlen stehen. Vollkommenste Konsonanz
nächst dem Einklaug ist die Oktave; das Verhältnis der Schwingungs-
zahlen ist 1 zu 2, dann folgt die Quinte mit 2 zu 3, die Quarte mit
3 zu 4 und so weiter. Da nun die Tonschwingungen sich um so
weniger stören, die Wellen, wie man sagt, sich um so besser überein-
ander lagern, je einfacher das Verhältnis ihrer Zahlen ist, so be-
stätigt sich auch hierin das vorhin aufgestellte Gefetz.
Nun hindern sich bei einem Zusammenklang mehrerer Töne
die Schwingungen stets ein wenig, auch bei den vollkommensten Har-
monien. Wer also die letzte Konsequenz zöge, der müßte verlangen,
daß aus unserer Musik die Harmonie gcstrichen und die Melodie nur
von einer Stimme vorgetragen würde. Das wäre heutzutage eine
paradoxe Forderung; und doch hat es ein künstlerisch hochbegabtes
Volk gegeben, das solche Musik hatte, die Hellenen. Uin uns besser
in ihre Lage zu versetzen, müssen wir noch ein Gesetz der Kunstent-
wicklung betrachten, zu dem uns die Baukunst, und gerade die der
Griechen, ein vorzügliches Beispiel liefert. Zuerst sind die einfachsten
Formen geschaffen worden, so der dorische Tempel. Mit der häufigen
Betrachtung wcrden die Sinne gegen die Schönheit abgestumpft, das
ästhetische Vcrgnügen wird geringer; letztercs soll nun aber auf der-
selben Höhe bleiben, die Abstumpfung läßt sich nicht rückgängig machen;
folglich muß man zu stärkeren Reizen greifen. So nahm man statt
der dorischen Säulenordnung die jonische, noch spüter die korinthische;
also eine deutliche Entwicklung vom Naiven zum Komplizierteren.
Ruilstwnrt
versetzt, sie läßt den Steg mitschwingen, der Steg beeinflußt die Decke
und diese wirkt auf die umgebende Luft erregend. Schwingt nun die
Decke in ihrer ganzen Ausdehnung, so wird der Ton bei gegebener
Schwingung der Saite und des Steges stark, schwingt jedoch nur ein
Teil der Decke, so wird der Ton schwächer, obwohl auf seine Erregung
dieselbe Kraft verwendet wurde. Danach müßte bei guten Geigen die
ganze Deckc schwingen, bei schlechten nur ein Teil und zwar natürlich
die Umgebung des Steges. Jch habe dies auch durch viele, übrigens
sehr einfache, Versuche betätigen können. Man legt die Geige auf
den Tisch, streicht eine Saite, am besten die ä-Saite an, und setzt ein
Bleistück oder auch einen eisernen Schlüssel oder dergleichen auf die
Decke an verschiedenen Punkten leicht auf. Die Stelle, wo man das
Bleistück aufgesetzt hat, wird verhindert zu schwingen: war sie nun
so wie so in Ruhe, so bemerkt man keinen Unterschied, war sie aber
vorher in Schwingung, so ändert sich deutlich die Klangfarbe und
Stärke des Tones. Hierdurch hat man ein Mittel, genau festzustellen,
ein wie großes Stück der Decke mitschwingt, und man wird finden,
daß stets bei der besseren Geige ein größerer Teil schwingt. Ein
Blcistück ist für den Versuch am geeignetsten, weil das Blei unelastisch
und spezifisch sehr schwer ist.
Treffen die Schwingungen zweier fast gleich hoher Töne zu-
sammen, so stören sie sich erheblich; wir hören die Störung als
Dissonanz, bei sehr geringem Unterschied der Tonhöhen als Schwe-
bung. Liegen dic Töne weiter auseinander, so gilt das bekannte Ge-
setz, daß die Konsonanz um so vollkommener ist, in je einfacherem
Vcrhältnis die Schwingungszahlen stehen. Vollkommenste Konsonanz
nächst dem Einklaug ist die Oktave; das Verhältnis der Schwingungs-
zahlen ist 1 zu 2, dann folgt die Quinte mit 2 zu 3, die Quarte mit
3 zu 4 und so weiter. Da nun die Tonschwingungen sich um so
weniger stören, die Wellen, wie man sagt, sich um so besser überein-
ander lagern, je einfacher das Verhältnis ihrer Zahlen ist, so be-
stätigt sich auch hierin das vorhin aufgestellte Gefetz.
Nun hindern sich bei einem Zusammenklang mehrerer Töne
die Schwingungen stets ein wenig, auch bei den vollkommensten Har-
monien. Wer also die letzte Konsequenz zöge, der müßte verlangen,
daß aus unserer Musik die Harmonie gcstrichen und die Melodie nur
von einer Stimme vorgetragen würde. Das wäre heutzutage eine
paradoxe Forderung; und doch hat es ein künstlerisch hochbegabtes
Volk gegeben, das solche Musik hatte, die Hellenen. Uin uns besser
in ihre Lage zu versetzen, müssen wir noch ein Gesetz der Kunstent-
wicklung betrachten, zu dem uns die Baukunst, und gerade die der
Griechen, ein vorzügliches Beispiel liefert. Zuerst sind die einfachsten
Formen geschaffen worden, so der dorische Tempel. Mit der häufigen
Betrachtung wcrden die Sinne gegen die Schönheit abgestumpft, das
ästhetische Vcrgnügen wird geringer; letztercs soll nun aber auf der-
selben Höhe bleiben, die Abstumpfung läßt sich nicht rückgängig machen;
folglich muß man zu stärkeren Reizen greifen. So nahm man statt
der dorischen Säulenordnung die jonische, noch spüter die korinthische;
also eine deutliche Entwicklung vom Naiven zum Komplizierteren.
Ruilstwnrt