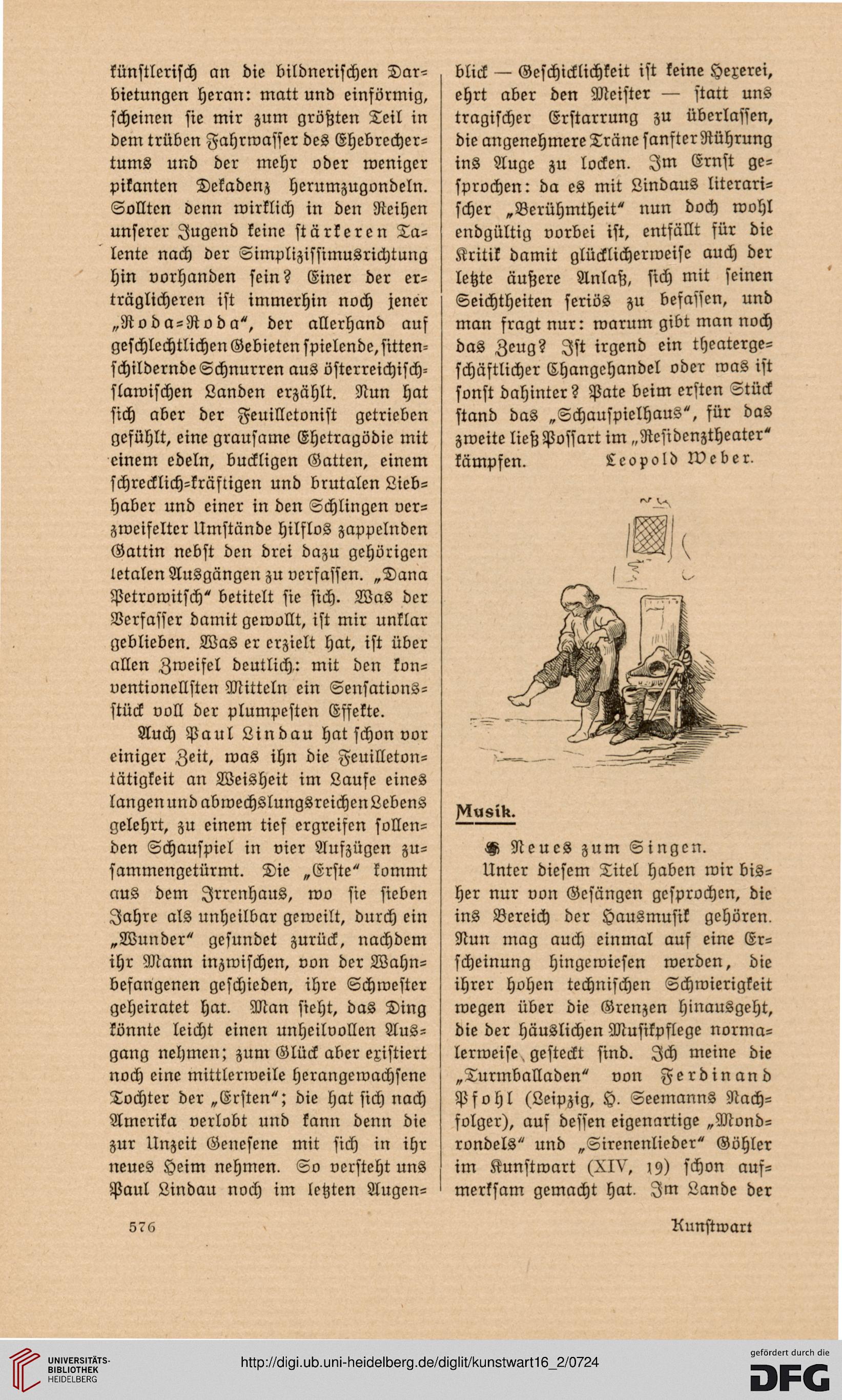künstlerisch an die bildnerischen Dar-
bietungen heran: matt und einförmig,
scheinen sie mir zum größten Teil in
dem trüben Fahrwasser des Ehebrecher-
tums und der mehr oder weniger
pikanten Dekadenz herumzugondeln.
Sollten denn wirklich in den Reihen
unserer Jugend keine stärkeren Ta-
lente nach üer Simplizissimusrichtung
hin vorhanden sein? Einer der er-
träglicheren ist immerhin noch jener
„Roda-Roda", der allerhand auf
geschlechtlichen Gebieten spielende,sitten-
schildernde Schnurren aus östcrreichisch-
slawischen Landen erzählt. Nun hat
sich aber der Feuilletonist getrieben
gefühlt, eine grausame Ehetragödie mit
einem edeln, buckligen Gatten, einem
schrecklich-kräfligen und brutalen Lieb-
haber und einer in den Schlingen ver-
zweifeltcr Umstände hilflos zappelnden
Gattin nebst den drei dazu gehörigen
tetalen Ausgängen zu verfassen. „Dana
Petrowitsch" betitelt sie sich. Was der
Verfasser damit gewollt, ist mir unklar
geblieben. Was er erzielt hat, ist über
allen Zweifel deutlich: mit den kon-
ventionellsten Mitteln ein Sensations-
stück voll der plumpesten Effekte.
Auch Paul Lindau hat schon vor
einiger Zeit, was ihn die Feuilleton-
tätigkeit an Weisheit im Laufe eines
langenundabwechslungsreichenLebens
gelehrt, zu einem tief ergreifen sollen-
den Schauspiel in vier Aufzügen zu-
sammengetürmt. Die „Erste" kommt
nus dem Jrrenhaus, wo sie sieben
Jahre als unheilbar geweilt, durch ein
„Wunder" gesundet zurück, nachdem
ihr Mann inzwischen, von der Wahn-
befangenen geschieden, ihre Schwester
geheiratet har. Man sieht, das Ding
könnte leicht einen unheilvollen Aus-
gang nehmen; zum Glück aber existiert
noch eine mittlerweile herangewachsene
Tochter der „Ersten"; die hat sich nach
Amerika verlobt und kann denn die
zur Unzeit Genesene mit sich in ihr
neues Heim nehmen. So versteht uns
Paul Lindau noch im letzten Augen-
blick — Geschicklichkeit ist keine Hexerei,
ehrt aber den Meister — statt uns
tragischer Erstarrung zu überlassen,
die angenehmereTräne sanfterRührung
ins Auge zu locken. Jm Ernst ge-
sprochen: da es mit Lindaus literari-
scher „Berühmtheit" nun doch wohl
endgültig vorbei ist, entfällt für die
Kritik damit glücklicherweise auch der
letzte äußere Anlaß, sich mit seinen
Seichtheiten seriös zu befassen, und
man fragt nur: warum gibt man noch
das Zeug? Jst irgend ein theaterge-
schäftlicher Changchandel oder was ist
sonst dahinter? Pate beim ersten Stück
stand das „Schauspielhaus", für das
zweite ließ Possart im „Residenztheater"
kämpfen. Leoxold weber.
jVlusik.
G Neues zum Singen.
Unter diesem Titel haben wir bis-
her nur von Gesängen gesprochen, die
ins Bereich der Hausmusik gehören.
Nun mag auch einmal auf eine Er-
scheinung hingewiesen werden, die
ihrer hohen technischen Schwierigkeit
wegen über die Grenzen hinausgeht,
die der häuslichen Musikpflege norma-
lerweise. gesteckt sind. Jch meine die
„Turmballaden" von Ferdinand
Pfohl (Leipzig, H. Seemanns Nach-
solger), auf dessen eigenartige „Mond-
rondels" und „Sirenenlieder" Göhler
im Kunstwart (XIV, 19) schon aus-
merksam gemacht hat. Jm Lande der
576
Aunstwart
bietungen heran: matt und einförmig,
scheinen sie mir zum größten Teil in
dem trüben Fahrwasser des Ehebrecher-
tums und der mehr oder weniger
pikanten Dekadenz herumzugondeln.
Sollten denn wirklich in den Reihen
unserer Jugend keine stärkeren Ta-
lente nach üer Simplizissimusrichtung
hin vorhanden sein? Einer der er-
träglicheren ist immerhin noch jener
„Roda-Roda", der allerhand auf
geschlechtlichen Gebieten spielende,sitten-
schildernde Schnurren aus östcrreichisch-
slawischen Landen erzählt. Nun hat
sich aber der Feuilletonist getrieben
gefühlt, eine grausame Ehetragödie mit
einem edeln, buckligen Gatten, einem
schrecklich-kräfligen und brutalen Lieb-
haber und einer in den Schlingen ver-
zweifeltcr Umstände hilflos zappelnden
Gattin nebst den drei dazu gehörigen
tetalen Ausgängen zu verfassen. „Dana
Petrowitsch" betitelt sie sich. Was der
Verfasser damit gewollt, ist mir unklar
geblieben. Was er erzielt hat, ist über
allen Zweifel deutlich: mit den kon-
ventionellsten Mitteln ein Sensations-
stück voll der plumpesten Effekte.
Auch Paul Lindau hat schon vor
einiger Zeit, was ihn die Feuilleton-
tätigkeit an Weisheit im Laufe eines
langenundabwechslungsreichenLebens
gelehrt, zu einem tief ergreifen sollen-
den Schauspiel in vier Aufzügen zu-
sammengetürmt. Die „Erste" kommt
nus dem Jrrenhaus, wo sie sieben
Jahre als unheilbar geweilt, durch ein
„Wunder" gesundet zurück, nachdem
ihr Mann inzwischen, von der Wahn-
befangenen geschieden, ihre Schwester
geheiratet har. Man sieht, das Ding
könnte leicht einen unheilvollen Aus-
gang nehmen; zum Glück aber existiert
noch eine mittlerweile herangewachsene
Tochter der „Ersten"; die hat sich nach
Amerika verlobt und kann denn die
zur Unzeit Genesene mit sich in ihr
neues Heim nehmen. So versteht uns
Paul Lindau noch im letzten Augen-
blick — Geschicklichkeit ist keine Hexerei,
ehrt aber den Meister — statt uns
tragischer Erstarrung zu überlassen,
die angenehmereTräne sanfterRührung
ins Auge zu locken. Jm Ernst ge-
sprochen: da es mit Lindaus literari-
scher „Berühmtheit" nun doch wohl
endgültig vorbei ist, entfällt für die
Kritik damit glücklicherweise auch der
letzte äußere Anlaß, sich mit seinen
Seichtheiten seriös zu befassen, und
man fragt nur: warum gibt man noch
das Zeug? Jst irgend ein theaterge-
schäftlicher Changchandel oder was ist
sonst dahinter? Pate beim ersten Stück
stand das „Schauspielhaus", für das
zweite ließ Possart im „Residenztheater"
kämpfen. Leoxold weber.
jVlusik.
G Neues zum Singen.
Unter diesem Titel haben wir bis-
her nur von Gesängen gesprochen, die
ins Bereich der Hausmusik gehören.
Nun mag auch einmal auf eine Er-
scheinung hingewiesen werden, die
ihrer hohen technischen Schwierigkeit
wegen über die Grenzen hinausgeht,
die der häuslichen Musikpflege norma-
lerweise. gesteckt sind. Jch meine die
„Turmballaden" von Ferdinand
Pfohl (Leipzig, H. Seemanns Nach-
solger), auf dessen eigenartige „Mond-
rondels" und „Sirenenlieder" Göhler
im Kunstwart (XIV, 19) schon aus-
merksam gemacht hat. Jm Lande der
576
Aunstwart