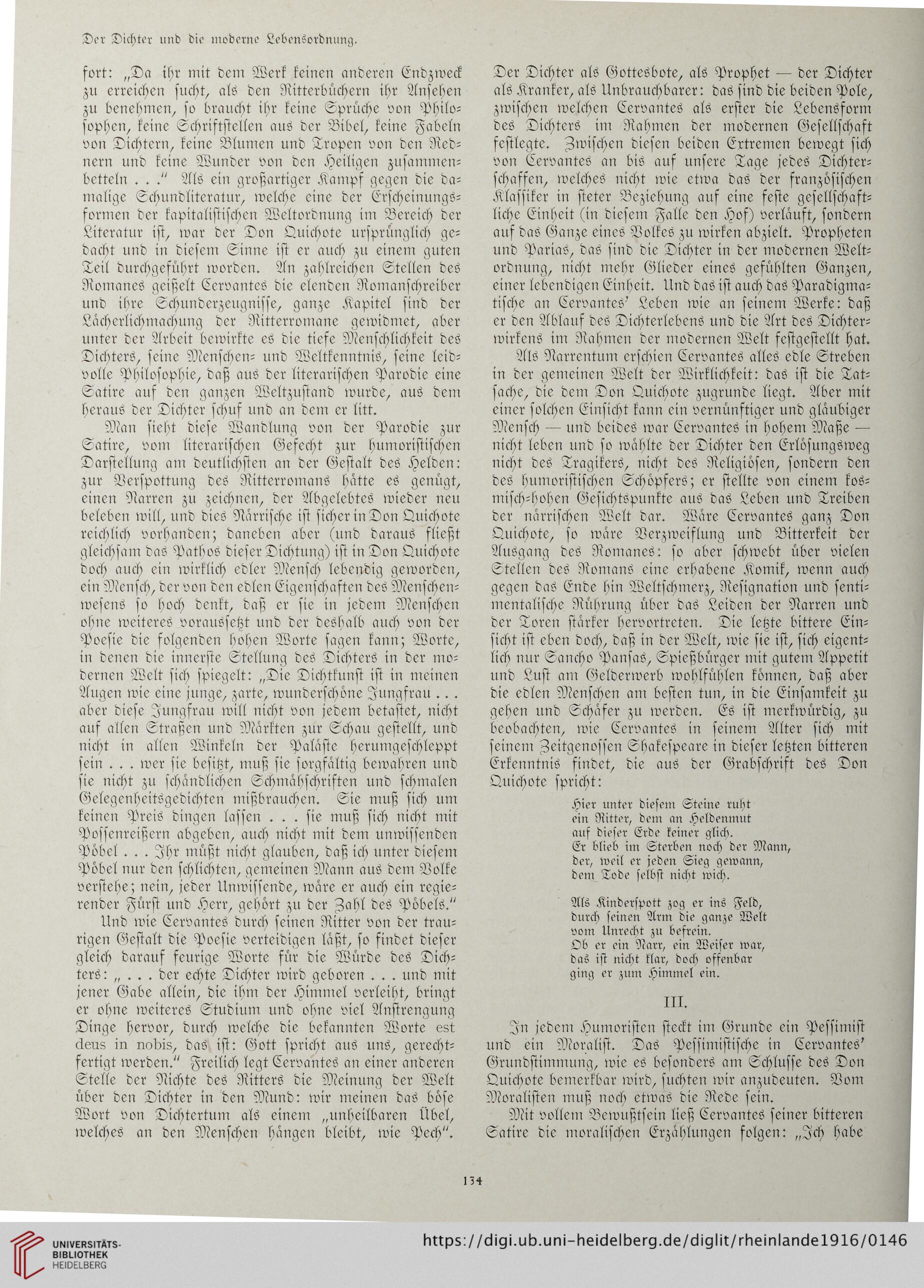Der Dichter und die moderne Lcbensordnung.
fort: „Da ihr mit dem Werk keinen anderen Endzweck
zu erreichen sucht, als den Nitterbüchern ihr Ansehen
zu benehmen, so braucht ihr keine Sprüche von Philo-
sophen, keine Schriftstellen aus der Bibel, keine Fabeln
von Dichtern, keine Blumen und Tropen von den Red-
nern und keine Wunder von den Heiligen zusammen-
betteln . . Als ein großartiger Kampf gegen die da-
malige Schundliteratur, welche eine der Erscheinungs-
formen der kapitalistischen Weltordnung im Bereich der
Literatur ist, war der Don Quichote ursprünglich ge-
dacht und in diesem Sinne ist er auch zu einem guten
Teil durchgeführt worden. An zahlreichen Stellen des
Nomanes geißelt Cervantes die elenden Nomanschreiber
und ihre Schunderzeugnisse, ganze Kapitel sind der
Lacherlichmachung der Nitterromane gewidmet, aber
unter der Arbeit bewirkte es die tiefe Menschlichkeit des
Dichters, seine Menschen- und Weltkenntnis, seine leid-
volle Philosophie, daß aus der literarischen Parodie eine
Satire auf den ganzen Weltzustand wurde, aus dem
heraus der Dichter schuf und an dem er litt.
Man sieht diese Wandlung von der Parodie zur
Satire, vom literarischen Gefecht zur humoristischen
Darstellung am deutlichsten an der Gestalt des Helden:
zur Verspottung des Nitterromans hatte es genügt,
einen Narren zu zeichnen, der Abgelebtes wieder neu
beleben will, und dies Narrische ist sicher in Don Quichote
reichlich vorhanden; daneben aber (und daraus fließt
gleichsam das Pathos dieser Dichtung) ist in Don Quichote
doch auch ein wirklich edler Mensch lebendig geworden,
ein Mensch, der von den edlen Eigenschaften des Menschen-
wesens so hoch denkt, daß er sie in jedem Menschen
ohne weiteres voraussetzt und der deshalb auch von der
Poesie die folgenden hohen Worte sagen kann; Worte,
in denen die innerste Stellung des Dichters in der mo-
dernen Welt sich spiegelt: „Die Dichtkunst ist in meinen
Augen wie eine junge, zarte, wunderschöne Jungfrau ...
aber diese Jungfrau will nicht von jedem betastet, nicht
auf allen Straßen und Markten zur Schau gestellt, und
nicht in allen Winkeln der Paläste herumgeschleppt
sein . . . wer sie besitzt, muß sie sorgfältig bewahren und
sie nicht zu schändlichen Schmähschriften und schmalen
Gelegenheitsgedichten mißbrauchen. Sie muß sich um
keinen Preis dingen lassen ... sie muß sich nicht mit
Possenreißern abgeben, auch nicht mit dem unwissenden
Pöbel . . . Ihr müßt nicht glauben, daß ich unter diesem
Pöbel nur den schlichten, gemeinen Mann aus dem Volke
verstehe; nein, jeder Unwissende, wäre er auch ein regie-
render Fürst und Herr, gehört zu der Zahl des Pöbels."
Und wie Cervantes durch seinen Ritter von der trau-
rigen Gestalt die Poesie verteidigen läßt, so findet dieser
gleich darauf feurige Worte für die Würde des Dich-
ters: „ . . . der echte Dichter wird geboren . . . und niit
jener Gabe allein, die ihm der Himmel verleiht, bringt
er ohne weiteres Studium und ohne viel Anstrengung
Dinge hervor, durch welche die bekannten Worte est
Ueu8 in nob>i8, das ist: Gott spricht aus uns, gerecht-
fertigt werden." Freilich legt Cervantes an einer anderen
Stelle der Nichte des Ritters die Meinung der Welt
über den Dichter in den Mund: wir meinen das böse
Wort von Dichterturn als einem „unheilbaren Übel,
welches an den Menschen hängen bleibt, wie Pech".
Der Dichter als Gottesbote, als Prophet — der Dichter
als Kranker, als Unbrauchbarer: das sind die beiden Pole,
zwischen welchen Cervantes als erster die Lebensform
des Dichters im Rahmen der modernen Gesellschaft
festlegte. Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich
von Cervantes an bis auf unsere Tage jedes Dichter-
schaffen, welches nicht wie etwa das der französischen
Klassiker in steter Beziehung auf eine feste gesellschaft-
liche Einheit (in diesem Falle den Hof) verläuft, sondern
auf das Ganze eines Volkes zu wirken abzielt. Propheten
und Parias, das sind die Dichter in der modernen Welt-
ordnung, nicht mehr Glieder eines gefühlten Ganzen,
einer lebendigen Einheit. Und das ist auch das Paradigma-
tische an Cervantes' Leben wie an seinem Werke: daß
er den Ablauf des Dichterlebens und die Art des Dichter-
wirkens im Nahmen der modernen Welt festgestellt hat.
Als Narrentum erschien Cervantes alles edle Streben
in der gemeinen Welt der Wirklichkeit: das ist die Tat-
sache, die dem Don Quichote zugrunde liegt. Aber mit
einer solchen Einsicht kann ein vernünftiger und gläubiger
Mensch — und beides war Cervantes in hohem Maße —
nicht leben und so wählte der Dichter den Erlösungsweg
nicht des Tragikers, nicht des Religiösen, sondern den
des humoristischen Schöpfers; er stellte von einem kos-
misch-hohen Gesichtspunkte aus das Leben und Treiben
der närrischen Welt dar. Wäre Cervantes ganz Don
Quichote, so wäre Verzweiflung und Bitterkeit der
Ausgang des Romanes: so aber schwebt über vielen
Stellen des Romans eine erhabene Komik, wenn auch
gegen das Ende hin Weltschmerz, Resignation und senti-
mentalische Rührung über das Leiden der Narren und
der Toren stärker hervortrcten. Die letzte bittere Ein-
sicht ist eben doch, daß in der Welt, wie sie ist, sich eigent-
lich nur Sancho Pansas, Spießbürger mit gutem Appetit
und Lust am Gelderwerb wohlfühlen können, daß aber
die edlen Menschen am besten tun, in die Einsamkeit zu
gehen und Schäfer zu werden. Es ist merkwürdig, zu
beobachten, wie Cervantes in seinem Alter sich mit
seinem Zeitgenossen Shakespeare in dieser letzten bitteren
Erkenntnis findet, die aus der Grabschrift des Don
Quichote spricht:
Hier unter diesem Steine ruht
ein Ritter, dem an Heldenmut
auf dieser Erde keiner glich.
Er blieb im Sterben noch der Mann,
der, weil er jeden Sieg gewann,
dem Tode selbst nicht wich.
Als Kinderspott zog er ins Feld,
durch seinen Arm die ganze Welt
vom Unrecht zu befrein.
Ob er ein Narr, ein Weiser war,
das ist nicht klar, doch offenbar
ging er zum Himmel ein.
III.
Ju jedem Humoristen steckt im Grunde ein Pessimist
und ein Moralist. Das Pessimistische in Cervantes'
Grundstimmung, wie es besonders am Schlüsse des Don
Quichote bemerkbar wird, suchten wir anzudeuten. Vom
Moralisten muß noch etwas die Rede sein.
Mit vollem Bewußtsein ließ Cervantes seiner bitteren
Satire die moralischen Erzählungen folgen: „Ich habe
fort: „Da ihr mit dem Werk keinen anderen Endzweck
zu erreichen sucht, als den Nitterbüchern ihr Ansehen
zu benehmen, so braucht ihr keine Sprüche von Philo-
sophen, keine Schriftstellen aus der Bibel, keine Fabeln
von Dichtern, keine Blumen und Tropen von den Red-
nern und keine Wunder von den Heiligen zusammen-
betteln . . Als ein großartiger Kampf gegen die da-
malige Schundliteratur, welche eine der Erscheinungs-
formen der kapitalistischen Weltordnung im Bereich der
Literatur ist, war der Don Quichote ursprünglich ge-
dacht und in diesem Sinne ist er auch zu einem guten
Teil durchgeführt worden. An zahlreichen Stellen des
Nomanes geißelt Cervantes die elenden Nomanschreiber
und ihre Schunderzeugnisse, ganze Kapitel sind der
Lacherlichmachung der Nitterromane gewidmet, aber
unter der Arbeit bewirkte es die tiefe Menschlichkeit des
Dichters, seine Menschen- und Weltkenntnis, seine leid-
volle Philosophie, daß aus der literarischen Parodie eine
Satire auf den ganzen Weltzustand wurde, aus dem
heraus der Dichter schuf und an dem er litt.
Man sieht diese Wandlung von der Parodie zur
Satire, vom literarischen Gefecht zur humoristischen
Darstellung am deutlichsten an der Gestalt des Helden:
zur Verspottung des Nitterromans hatte es genügt,
einen Narren zu zeichnen, der Abgelebtes wieder neu
beleben will, und dies Narrische ist sicher in Don Quichote
reichlich vorhanden; daneben aber (und daraus fließt
gleichsam das Pathos dieser Dichtung) ist in Don Quichote
doch auch ein wirklich edler Mensch lebendig geworden,
ein Mensch, der von den edlen Eigenschaften des Menschen-
wesens so hoch denkt, daß er sie in jedem Menschen
ohne weiteres voraussetzt und der deshalb auch von der
Poesie die folgenden hohen Worte sagen kann; Worte,
in denen die innerste Stellung des Dichters in der mo-
dernen Welt sich spiegelt: „Die Dichtkunst ist in meinen
Augen wie eine junge, zarte, wunderschöne Jungfrau ...
aber diese Jungfrau will nicht von jedem betastet, nicht
auf allen Straßen und Markten zur Schau gestellt, und
nicht in allen Winkeln der Paläste herumgeschleppt
sein . . . wer sie besitzt, muß sie sorgfältig bewahren und
sie nicht zu schändlichen Schmähschriften und schmalen
Gelegenheitsgedichten mißbrauchen. Sie muß sich um
keinen Preis dingen lassen ... sie muß sich nicht mit
Possenreißern abgeben, auch nicht mit dem unwissenden
Pöbel . . . Ihr müßt nicht glauben, daß ich unter diesem
Pöbel nur den schlichten, gemeinen Mann aus dem Volke
verstehe; nein, jeder Unwissende, wäre er auch ein regie-
render Fürst und Herr, gehört zu der Zahl des Pöbels."
Und wie Cervantes durch seinen Ritter von der trau-
rigen Gestalt die Poesie verteidigen läßt, so findet dieser
gleich darauf feurige Worte für die Würde des Dich-
ters: „ . . . der echte Dichter wird geboren . . . und niit
jener Gabe allein, die ihm der Himmel verleiht, bringt
er ohne weiteres Studium und ohne viel Anstrengung
Dinge hervor, durch welche die bekannten Worte est
Ueu8 in nob>i8, das ist: Gott spricht aus uns, gerecht-
fertigt werden." Freilich legt Cervantes an einer anderen
Stelle der Nichte des Ritters die Meinung der Welt
über den Dichter in den Mund: wir meinen das böse
Wort von Dichterturn als einem „unheilbaren Übel,
welches an den Menschen hängen bleibt, wie Pech".
Der Dichter als Gottesbote, als Prophet — der Dichter
als Kranker, als Unbrauchbarer: das sind die beiden Pole,
zwischen welchen Cervantes als erster die Lebensform
des Dichters im Rahmen der modernen Gesellschaft
festlegte. Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich
von Cervantes an bis auf unsere Tage jedes Dichter-
schaffen, welches nicht wie etwa das der französischen
Klassiker in steter Beziehung auf eine feste gesellschaft-
liche Einheit (in diesem Falle den Hof) verläuft, sondern
auf das Ganze eines Volkes zu wirken abzielt. Propheten
und Parias, das sind die Dichter in der modernen Welt-
ordnung, nicht mehr Glieder eines gefühlten Ganzen,
einer lebendigen Einheit. Und das ist auch das Paradigma-
tische an Cervantes' Leben wie an seinem Werke: daß
er den Ablauf des Dichterlebens und die Art des Dichter-
wirkens im Nahmen der modernen Welt festgestellt hat.
Als Narrentum erschien Cervantes alles edle Streben
in der gemeinen Welt der Wirklichkeit: das ist die Tat-
sache, die dem Don Quichote zugrunde liegt. Aber mit
einer solchen Einsicht kann ein vernünftiger und gläubiger
Mensch — und beides war Cervantes in hohem Maße —
nicht leben und so wählte der Dichter den Erlösungsweg
nicht des Tragikers, nicht des Religiösen, sondern den
des humoristischen Schöpfers; er stellte von einem kos-
misch-hohen Gesichtspunkte aus das Leben und Treiben
der närrischen Welt dar. Wäre Cervantes ganz Don
Quichote, so wäre Verzweiflung und Bitterkeit der
Ausgang des Romanes: so aber schwebt über vielen
Stellen des Romans eine erhabene Komik, wenn auch
gegen das Ende hin Weltschmerz, Resignation und senti-
mentalische Rührung über das Leiden der Narren und
der Toren stärker hervortrcten. Die letzte bittere Ein-
sicht ist eben doch, daß in der Welt, wie sie ist, sich eigent-
lich nur Sancho Pansas, Spießbürger mit gutem Appetit
und Lust am Gelderwerb wohlfühlen können, daß aber
die edlen Menschen am besten tun, in die Einsamkeit zu
gehen und Schäfer zu werden. Es ist merkwürdig, zu
beobachten, wie Cervantes in seinem Alter sich mit
seinem Zeitgenossen Shakespeare in dieser letzten bitteren
Erkenntnis findet, die aus der Grabschrift des Don
Quichote spricht:
Hier unter diesem Steine ruht
ein Ritter, dem an Heldenmut
auf dieser Erde keiner glich.
Er blieb im Sterben noch der Mann,
der, weil er jeden Sieg gewann,
dem Tode selbst nicht wich.
Als Kinderspott zog er ins Feld,
durch seinen Arm die ganze Welt
vom Unrecht zu befrein.
Ob er ein Narr, ein Weiser war,
das ist nicht klar, doch offenbar
ging er zum Himmel ein.
III.
Ju jedem Humoristen steckt im Grunde ein Pessimist
und ein Moralist. Das Pessimistische in Cervantes'
Grundstimmung, wie es besonders am Schlüsse des Don
Quichote bemerkbar wird, suchten wir anzudeuten. Vom
Moralisten muß noch etwas die Rede sein.
Mit vollem Bewußtsein ließ Cervantes seiner bitteren
Satire die moralischen Erzählungen folgen: „Ich habe