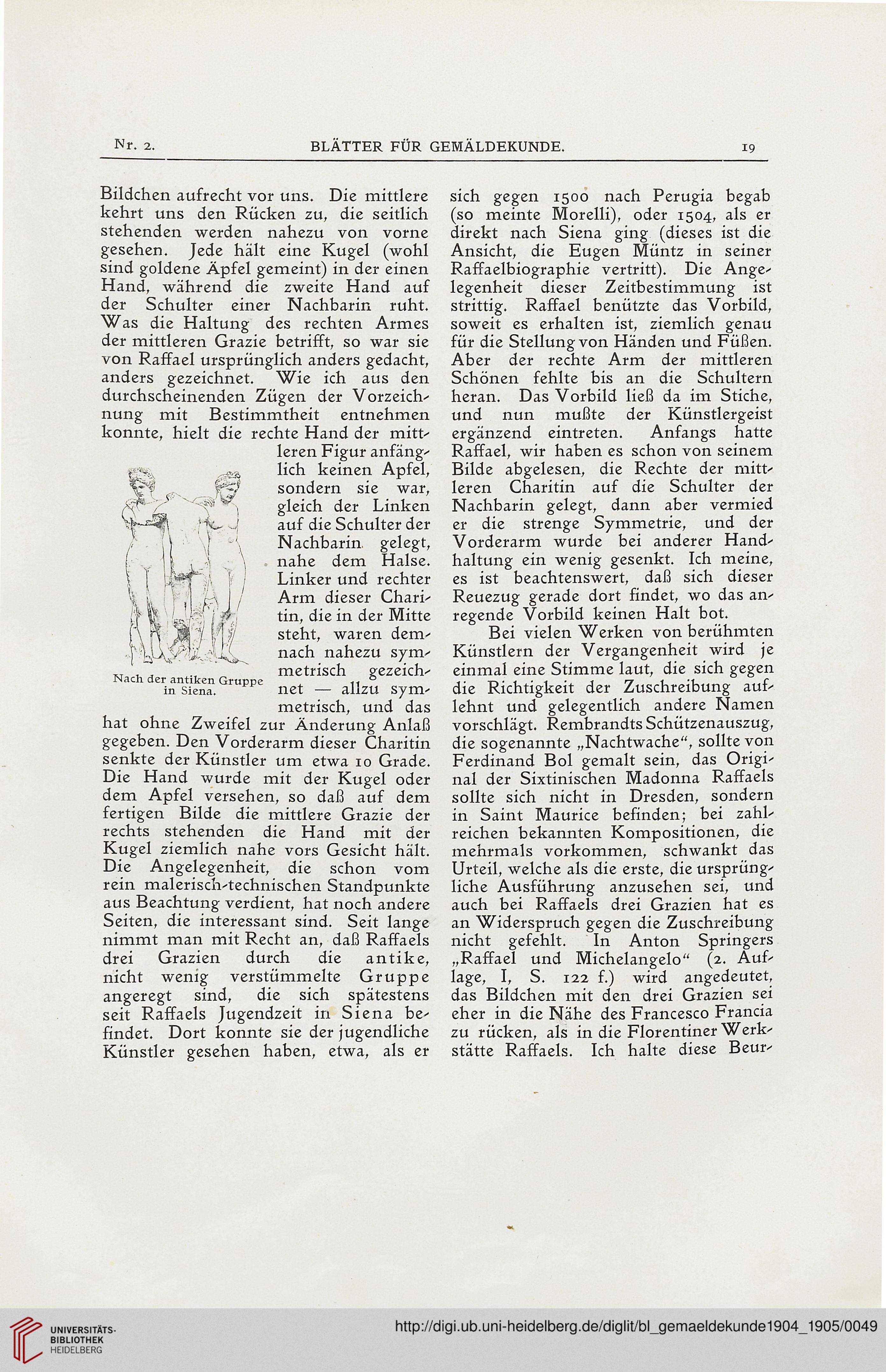Nr. 2.
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
19
Bildchen aufrecht vor uns. Die mittlere
kehrt uns den Rücken zu, die seitlich
stehenden werden nahezu von vorne
gesehen. Jede hält eine Kugel (wohl
sind goldene Äpfel gemeint) in der einen
Hand, während die zweite Hand auf
der Schulter einer Nachbarin ruht.
Was die Haltung des rechten Armes
der mittleren Grazie betrifft, so war sie
von Raffael ursprünglich anders gedacht,
anders gezeichnet. Wie ich aus den
durchscheinenden Zügen der Vorzeich-
nung mit Bestimmtheit entnehmen
konnte, hielt die rechte Hand der mitt-
leren Figur anfäng-
lieh keinen Apfel,
sondern sie war,
gleich der Linken
auf die Schulter der
Nachbarin gelegt,
nahe dem Halse.
Linker und rechter
Arm dieser Chari-
tin, die in der Mitte
steht, waren dem-
nach nahezu sym-
metrisch gezeich-
net — allzu sym-
metrisch, und das
hat ohne Zweifel zur Änderung Anlaß
gegeben. Den Vorderarm dieser Charitin
senkte der Künstler um etwa xo Grade.
Die Hand wurde mit der Kugel oder
dem Apfel versehen, so daß auf dem
fertigen Bilde die mittlere Grazie der
rechts stehenden die Hand mit der
Kugel ziemlich nahe vors Gesicht hält.
Die Angelegenheit, die schon vom
rein malerisch-technischen Standpunkte
aus Beachtung verdient, hat noch andere
Seiten, die interessant sind. Seit lange
nimmt man mit Recht an, daß Raffaels
drei Grazien durch die antike,
nicht wenig verstümmelte Gruppe
angeregt sind, die sich spätestens
seit Raffaels Jugendzeit in Siena be-
findet. Dort konnte sie der jugendliche
Künstler gesehen haben, etwa, als er
Nach der antiken Gruppe
in Siena.
sich gegen 1500 nach Perugia begab
(so meinte Morelli), oder 1504, als er
direkt nach Siena ging (dieses ist die
Ansicht, die Eugen Müntz in seiner
Raffaelbiographie vertritt). Die Ange-
legenheit dieser Zeitbestimmung ist
strittig. Raffael benützte das Vorbild,
soweit es erhalten ist, ziemlich genau
für die Stellung von Händen und Füßen.
Aber der rechte Arm der mittleren
Schönen fehlte bis an die Schultern
heran. Das Vorbild ließ da im Stiche,
und nun mußte der Künstlergeist
ergänzend eintreten. Anfangs hatte
Raffael, wir haben es schon von seinem
Bilde abgelesen, die Rechte der mitt-
leren Charitin auf die Schulter der
Nachbarin gelegt, dann aber vermied
er die strenge Symmetrie, und der
Vorderarm wurde bei anderer Hand-
haltung ein wenig gesenkt. Ich meine,
es ist beachtenswert, daß sich dieser
Reuezug gerade dort findet, wo das an-
regende Vorbild keinen Halt bot.
Bei vielen Werken von berühmten
Künstlern der Vergangenheit wird je
einmal eine Stimme laut, die sich gegen
die Richtigkeit der Zuschreibung auf-
lehnt und gelegentlich andere Namen
vorschlägt. Rembrandts Schützenauszug,
die sogenannte „Nachtwache“, sollte von
Ferdinand Bol gemalt sein, das Origi-
nal der Sixtinischen Madonna Raffaels
sollte sich nicht in Dresden, sondern
in Saint Maurice befinden; bei zahl-
reichen bekannten Kompositionen, die
mehrmals Vorkommen, schwankt das
Urteil, welche als die erste, die ursprüng-
liche Ausführung anzusehen sei, und
auch bei Raffaels drei Grazien hat es
an Widerspruch gegen die Zuschreibung
nicht gefehlt. In Anton Springers
„Raffael und Michelangelo“ (2. Auf-
lage, I, S. 122 f.) wird angedeutet,
das Bildchen mit den drei Grazien sei
eher in die Nähe des Francesco Francia
zu rücken, als in die Florentiner Werk-
stätte Raffaels. Ich halte diese Beur-
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
19
Bildchen aufrecht vor uns. Die mittlere
kehrt uns den Rücken zu, die seitlich
stehenden werden nahezu von vorne
gesehen. Jede hält eine Kugel (wohl
sind goldene Äpfel gemeint) in der einen
Hand, während die zweite Hand auf
der Schulter einer Nachbarin ruht.
Was die Haltung des rechten Armes
der mittleren Grazie betrifft, so war sie
von Raffael ursprünglich anders gedacht,
anders gezeichnet. Wie ich aus den
durchscheinenden Zügen der Vorzeich-
nung mit Bestimmtheit entnehmen
konnte, hielt die rechte Hand der mitt-
leren Figur anfäng-
lieh keinen Apfel,
sondern sie war,
gleich der Linken
auf die Schulter der
Nachbarin gelegt,
nahe dem Halse.
Linker und rechter
Arm dieser Chari-
tin, die in der Mitte
steht, waren dem-
nach nahezu sym-
metrisch gezeich-
net — allzu sym-
metrisch, und das
hat ohne Zweifel zur Änderung Anlaß
gegeben. Den Vorderarm dieser Charitin
senkte der Künstler um etwa xo Grade.
Die Hand wurde mit der Kugel oder
dem Apfel versehen, so daß auf dem
fertigen Bilde die mittlere Grazie der
rechts stehenden die Hand mit der
Kugel ziemlich nahe vors Gesicht hält.
Die Angelegenheit, die schon vom
rein malerisch-technischen Standpunkte
aus Beachtung verdient, hat noch andere
Seiten, die interessant sind. Seit lange
nimmt man mit Recht an, daß Raffaels
drei Grazien durch die antike,
nicht wenig verstümmelte Gruppe
angeregt sind, die sich spätestens
seit Raffaels Jugendzeit in Siena be-
findet. Dort konnte sie der jugendliche
Künstler gesehen haben, etwa, als er
Nach der antiken Gruppe
in Siena.
sich gegen 1500 nach Perugia begab
(so meinte Morelli), oder 1504, als er
direkt nach Siena ging (dieses ist die
Ansicht, die Eugen Müntz in seiner
Raffaelbiographie vertritt). Die Ange-
legenheit dieser Zeitbestimmung ist
strittig. Raffael benützte das Vorbild,
soweit es erhalten ist, ziemlich genau
für die Stellung von Händen und Füßen.
Aber der rechte Arm der mittleren
Schönen fehlte bis an die Schultern
heran. Das Vorbild ließ da im Stiche,
und nun mußte der Künstlergeist
ergänzend eintreten. Anfangs hatte
Raffael, wir haben es schon von seinem
Bilde abgelesen, die Rechte der mitt-
leren Charitin auf die Schulter der
Nachbarin gelegt, dann aber vermied
er die strenge Symmetrie, und der
Vorderarm wurde bei anderer Hand-
haltung ein wenig gesenkt. Ich meine,
es ist beachtenswert, daß sich dieser
Reuezug gerade dort findet, wo das an-
regende Vorbild keinen Halt bot.
Bei vielen Werken von berühmten
Künstlern der Vergangenheit wird je
einmal eine Stimme laut, die sich gegen
die Richtigkeit der Zuschreibung auf-
lehnt und gelegentlich andere Namen
vorschlägt. Rembrandts Schützenauszug,
die sogenannte „Nachtwache“, sollte von
Ferdinand Bol gemalt sein, das Origi-
nal der Sixtinischen Madonna Raffaels
sollte sich nicht in Dresden, sondern
in Saint Maurice befinden; bei zahl-
reichen bekannten Kompositionen, die
mehrmals Vorkommen, schwankt das
Urteil, welche als die erste, die ursprüng-
liche Ausführung anzusehen sei, und
auch bei Raffaels drei Grazien hat es
an Widerspruch gegen die Zuschreibung
nicht gefehlt. In Anton Springers
„Raffael und Michelangelo“ (2. Auf-
lage, I, S. 122 f.) wird angedeutet,
das Bildchen mit den drei Grazien sei
eher in die Nähe des Francesco Francia
zu rücken, als in die Florentiner Werk-
stätte Raffaels. Ich halte diese Beur-