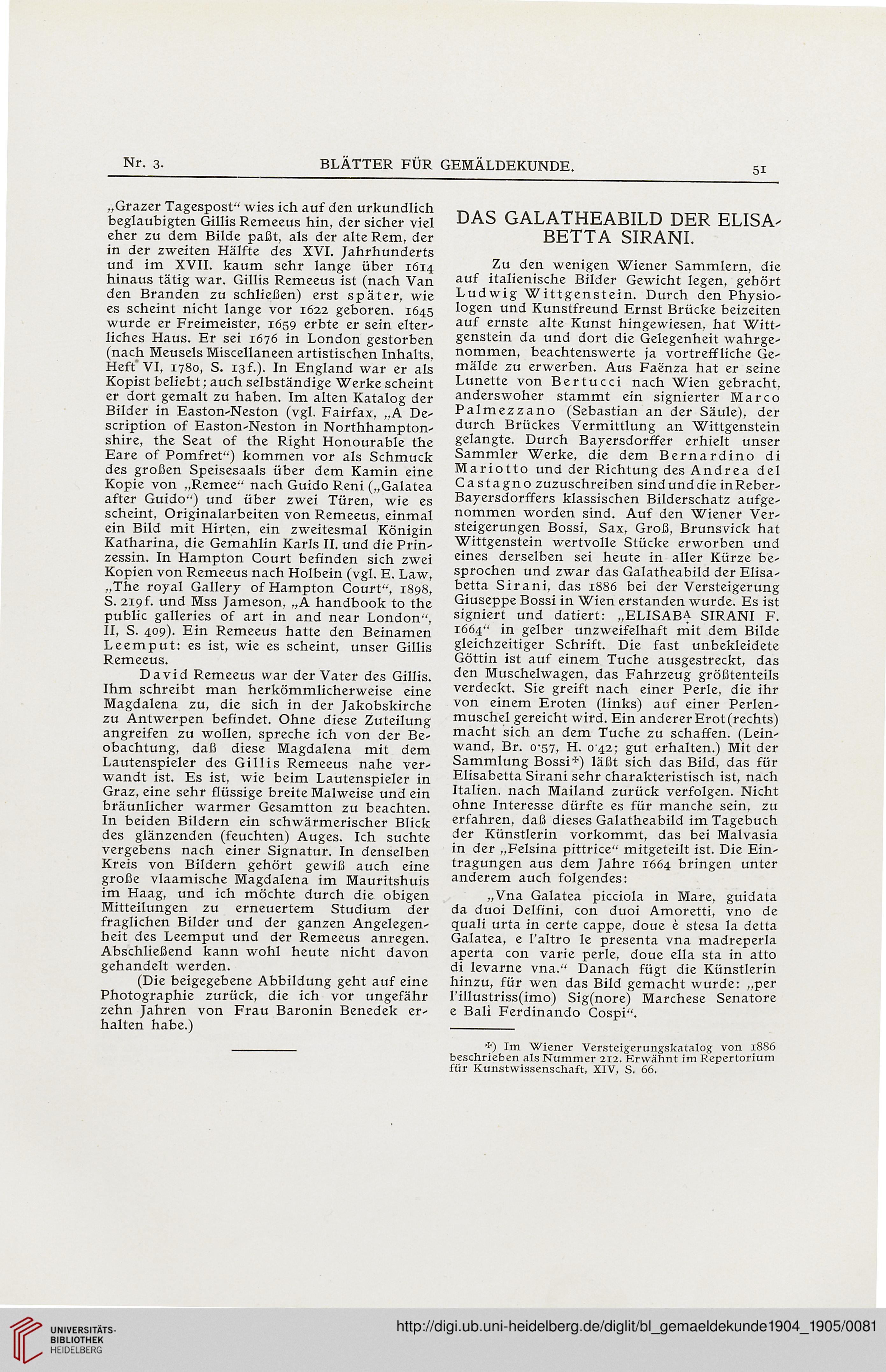Nr. 3.
5i
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
„Grazer Tagespost“ wies ich auf den urkundlich
beglaubigten Gillis Remeeus hin, der sicher viel
eher zu dem Bilde paßt, als der alte Rem, der
in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts
und im XVII. kaum sehr lange über 1614
hinaus tätig war. Gillis Remeeus ist (nach Van
den Branden zu schließen) erst später, wie
es scheint nicht lange vor 1622 geboren. 1645
wurde er Freimeister, 1659 erbte er sein elter-
liches Haus. Er sei 1676 in London gestorben
(nach Meusels Miscellaneen artistischen Inhalts,
Heft'VI, 1780, S. 13 f.). In England war er als
Kopist beliebt; auch selbständige Werke scheint
er dort gemalt zu haben. Im alten Katalog der
Bilder in Easton-Neston (vgl. Fairfax, „A De-
scription of Easton-Neston in Northhampton-
shire, the Seat of the Right Honourable the
Eare of Pomfret“) kommen vor als Schmuck
des großen Speisesaals über dem Kamin eine
Kopie von „Remee“ nach Guido Reni („Galatea
after Guido“) und über zwei Türen, wie es
scheint, Originalarbeiten von Remeeus, einmal
ein Bild mit Hirten, ein zweitesmal Königin
Katharina, die Gemahlin Karls II. und die Prin-
zessin. In Hampton Court befinden sich zwei
Kopien von Remeeus nach Holbein (vgl. E. Law,
„The royal Gallery of Hampton Court“, 1898,
S. 219L und Mss Jameson, „A handbook to the
public galleries of art in and near London“,
II, S. 409). Ein Remeeus hatte den Beinamen
Leemput: es ist, wie es scheint, unser Gillis
Remeeus.
David Remeeus war der Vater des Gillis.
Ihm schreibt man herkömmlicherweise eine
Magdalena zu, die sich in der Jakobskirche
zu Antwerpen befindet. Ohne diese Zuteilung
angreifen zu wollen, spreche ich von der Be-
obachtung, daß diese Magdalena mit dem
Lautenspieler des Gillis Remeeus nahe ver-
wandt ist. Es ist, wie beim Lautenspieler in
Graz, eine sehr flüssige breite Malweise und ein
bräunlicher warmer Gesamtton zu beachten.
In beiden Bildern ein schwärmerischer Blick
des glänzenden (feuchten) Auges. Ich suchte
vergebens nach einer Signatur. In denselben
Kreis von Bildern gehört gewiß auch eine
große vlaamische Magdalena im Mauritshuis
im Haag, und ich möchte durch die obigen
Mitteilungen zu erneuertem Studium der
fraglichen Bilder und der ganzen Angelegen-
heit des Leemput und der Remeeus anregen.
Abschließend kann wohl heute nicht davon
gehandelt werden.
(Die beigegebene Abbildung geht auf eine
Photographie zurück, die ich vor ungefähr
zehn Jahren von Frau Baronin Benedek er-
halten habe.)
DAS GALATHEABILD DER ELISA-
BETTA SIRANI.
Zu den wenigen Wiener Sammlern, die
auf italienische Bilder Gewicht legen, gehört
Ludwig Wittgenstein. Durch den Physio-
logen und Kunstfreund Ernst Brücke beizeiten
auf ernste alte Kunst hingewiesen, hat Witt-
genstein da und dort die Gelegenheit wahrge-
nommen, beachtenswerte ja vortreffliche Ge-
mälde zu erwerben. Aus Faenza hat er seine
Lünette von Bertucci nach Wien gebracht,
anderswoher stammt ein signierter Marco
Palmezzano (Sebastian an der Säule), der
durch Brückes Vermittlung an Wittgenstein
gelangte. Durch Bayersdorffer erhielt unser
Sammler Werke, die dem Bernardino di
Mariotto und der Richtung des Andrea del
Castagno zuzuschreiben sindunddieinReber-
Bayersdorffers klassischen Bilderschatz aufge-
nommen worden sind. Auf den Wiener Ver-
steigerungen Bossi, Sax, Groß, Brunsvick hat
Wittgenstein wertvolle Stücke erworben und
eines derselben sei heute in aller Kürze be-
sprochen und zwar das Galatheabild der Elisa-
betta Sirani, das 1886 bei der Versteigerung
Giuseppe Bossi in Wien erstanden wurde. Es ist
signiert und datiert: „ELISAB4 SIRANI F.
1664“ in gelber unzweifelhaft mit dem Bilde
gleichzeitiger Schrift. Die fast unbekleidete
Göttin ist auf einem Tuche ausgestreckt, das
den Muschelwagen, das Fahrzeug größtenteils
verdeckt. Sie greift nach einer Perle, die ihr
von einem Eroten (links) auf einer Perlen-
muschel gereicht wird. Ein anderer Erot (rechts)
macht sich an dem Tuche zu schaffen. (Lein-
wand, Br. o-57, H. 0 42; gut erhalten.) Mit der
Sammlung Bossi’1") läßt sich das Bild, das für
Elisabetta Sirani sehr charakteristisch ist, nach
Italien, nach Mailand zurück verfolgen. Nicht
ohne Interesse dürfte es für manche sein, zu
erfahren, daß dieses Galatheabild im Tagebuch
der Künstlerin vorkommt, das bei Malvasia
in der „Felsina pittrice“ mitgeteilt ist. Die Ein-
tragungen aus dem Jahre 1664 bringen unter
anderem auch folgendes:
„Vna Galatea picciola in Mare, guidata
da duoi Delfini, con duoi Amoretti, vno de
quali urta in certe cappe, doue e stesa la detta
Galatea, e l’altro le presenta vna madreperla
aperta con varie perle, doue ella sta in atto
di levarne vna.“ Danach fügt die Künstlerin
hinzu, für wen das Bild gemacht wurde: „per
l’illustriss(imo) Sig(nore) Marchese Senatore
e Bali Ferdinando Cospi“. *)
*) Im Wiener Versteigerungskatalog von 1886
beschrieben als Nummer 212. Erwähnt im Repertorium
für Kunstwissenschaft, XIV, S, 66.
5i
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
„Grazer Tagespost“ wies ich auf den urkundlich
beglaubigten Gillis Remeeus hin, der sicher viel
eher zu dem Bilde paßt, als der alte Rem, der
in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts
und im XVII. kaum sehr lange über 1614
hinaus tätig war. Gillis Remeeus ist (nach Van
den Branden zu schließen) erst später, wie
es scheint nicht lange vor 1622 geboren. 1645
wurde er Freimeister, 1659 erbte er sein elter-
liches Haus. Er sei 1676 in London gestorben
(nach Meusels Miscellaneen artistischen Inhalts,
Heft'VI, 1780, S. 13 f.). In England war er als
Kopist beliebt; auch selbständige Werke scheint
er dort gemalt zu haben. Im alten Katalog der
Bilder in Easton-Neston (vgl. Fairfax, „A De-
scription of Easton-Neston in Northhampton-
shire, the Seat of the Right Honourable the
Eare of Pomfret“) kommen vor als Schmuck
des großen Speisesaals über dem Kamin eine
Kopie von „Remee“ nach Guido Reni („Galatea
after Guido“) und über zwei Türen, wie es
scheint, Originalarbeiten von Remeeus, einmal
ein Bild mit Hirten, ein zweitesmal Königin
Katharina, die Gemahlin Karls II. und die Prin-
zessin. In Hampton Court befinden sich zwei
Kopien von Remeeus nach Holbein (vgl. E. Law,
„The royal Gallery of Hampton Court“, 1898,
S. 219L und Mss Jameson, „A handbook to the
public galleries of art in and near London“,
II, S. 409). Ein Remeeus hatte den Beinamen
Leemput: es ist, wie es scheint, unser Gillis
Remeeus.
David Remeeus war der Vater des Gillis.
Ihm schreibt man herkömmlicherweise eine
Magdalena zu, die sich in der Jakobskirche
zu Antwerpen befindet. Ohne diese Zuteilung
angreifen zu wollen, spreche ich von der Be-
obachtung, daß diese Magdalena mit dem
Lautenspieler des Gillis Remeeus nahe ver-
wandt ist. Es ist, wie beim Lautenspieler in
Graz, eine sehr flüssige breite Malweise und ein
bräunlicher warmer Gesamtton zu beachten.
In beiden Bildern ein schwärmerischer Blick
des glänzenden (feuchten) Auges. Ich suchte
vergebens nach einer Signatur. In denselben
Kreis von Bildern gehört gewiß auch eine
große vlaamische Magdalena im Mauritshuis
im Haag, und ich möchte durch die obigen
Mitteilungen zu erneuertem Studium der
fraglichen Bilder und der ganzen Angelegen-
heit des Leemput und der Remeeus anregen.
Abschließend kann wohl heute nicht davon
gehandelt werden.
(Die beigegebene Abbildung geht auf eine
Photographie zurück, die ich vor ungefähr
zehn Jahren von Frau Baronin Benedek er-
halten habe.)
DAS GALATHEABILD DER ELISA-
BETTA SIRANI.
Zu den wenigen Wiener Sammlern, die
auf italienische Bilder Gewicht legen, gehört
Ludwig Wittgenstein. Durch den Physio-
logen und Kunstfreund Ernst Brücke beizeiten
auf ernste alte Kunst hingewiesen, hat Witt-
genstein da und dort die Gelegenheit wahrge-
nommen, beachtenswerte ja vortreffliche Ge-
mälde zu erwerben. Aus Faenza hat er seine
Lünette von Bertucci nach Wien gebracht,
anderswoher stammt ein signierter Marco
Palmezzano (Sebastian an der Säule), der
durch Brückes Vermittlung an Wittgenstein
gelangte. Durch Bayersdorffer erhielt unser
Sammler Werke, die dem Bernardino di
Mariotto und der Richtung des Andrea del
Castagno zuzuschreiben sindunddieinReber-
Bayersdorffers klassischen Bilderschatz aufge-
nommen worden sind. Auf den Wiener Ver-
steigerungen Bossi, Sax, Groß, Brunsvick hat
Wittgenstein wertvolle Stücke erworben und
eines derselben sei heute in aller Kürze be-
sprochen und zwar das Galatheabild der Elisa-
betta Sirani, das 1886 bei der Versteigerung
Giuseppe Bossi in Wien erstanden wurde. Es ist
signiert und datiert: „ELISAB4 SIRANI F.
1664“ in gelber unzweifelhaft mit dem Bilde
gleichzeitiger Schrift. Die fast unbekleidete
Göttin ist auf einem Tuche ausgestreckt, das
den Muschelwagen, das Fahrzeug größtenteils
verdeckt. Sie greift nach einer Perle, die ihr
von einem Eroten (links) auf einer Perlen-
muschel gereicht wird. Ein anderer Erot (rechts)
macht sich an dem Tuche zu schaffen. (Lein-
wand, Br. o-57, H. 0 42; gut erhalten.) Mit der
Sammlung Bossi’1") läßt sich das Bild, das für
Elisabetta Sirani sehr charakteristisch ist, nach
Italien, nach Mailand zurück verfolgen. Nicht
ohne Interesse dürfte es für manche sein, zu
erfahren, daß dieses Galatheabild im Tagebuch
der Künstlerin vorkommt, das bei Malvasia
in der „Felsina pittrice“ mitgeteilt ist. Die Ein-
tragungen aus dem Jahre 1664 bringen unter
anderem auch folgendes:
„Vna Galatea picciola in Mare, guidata
da duoi Delfini, con duoi Amoretti, vno de
quali urta in certe cappe, doue e stesa la detta
Galatea, e l’altro le presenta vna madreperla
aperta con varie perle, doue ella sta in atto
di levarne vna.“ Danach fügt die Künstlerin
hinzu, für wen das Bild gemacht wurde: „per
l’illustriss(imo) Sig(nore) Marchese Senatore
e Bali Ferdinando Cospi“. *)
*) Im Wiener Versteigerungskatalog von 1886
beschrieben als Nummer 212. Erwähnt im Repertorium
für Kunstwissenschaft, XIV, S, 66.