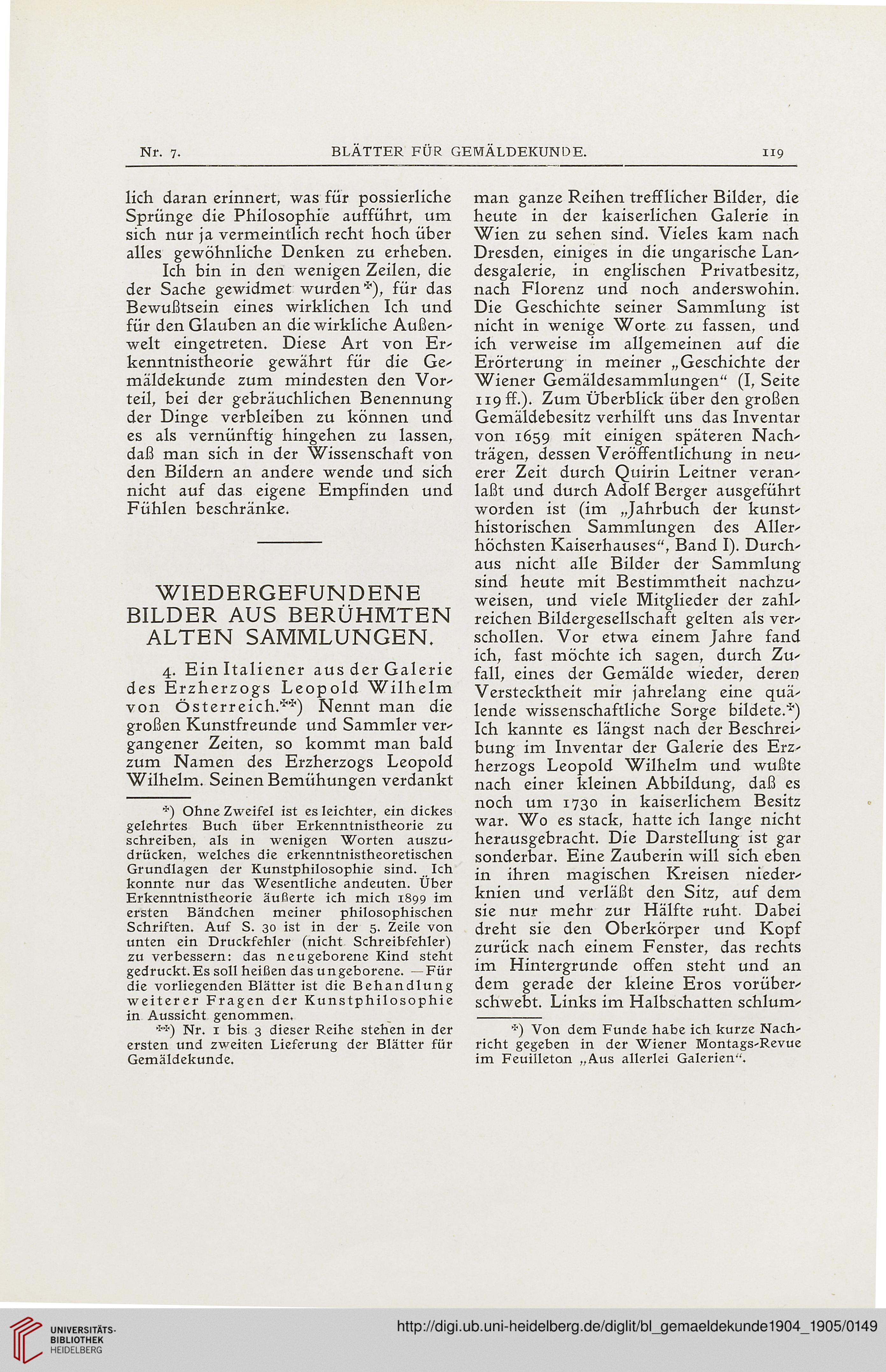Nr. 7.
119
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
lieh daran erinnert, was für possierliche
Sprünge die Philosophie aufführt, um
sich nur ja vermeintlich recht hoch über
alles gewöhnliche Denken zu erheben.
Ich bin in den wenigen Zeilen, die
der Sache gewidmet wurden'1'), für das
Bewußtsein eines wirklichen Ich und
für den Glauben an die wirkliche Äußern
weit eingetreten. Diese Art von Er-
kenntnistheorie gewährt für die Ge-
mäldekunde zum mindesten den Vor-
teil, bei der gebräuchlichen Benennung
der Dinge verbleiben zu können und
es als vernünftig hingehen zu lassen,
daß man sich in der Wissenschaft von
den Bildern an andere wende und sich
nicht auf das eigene Empfinden und
Fühlen beschränke.
WIEDERGEFUNDENE
BILDER AUS BERÜHMTEN
ALTEN SAMMLUNGEN.
4. Ein Italiener aus der Galerie
des Erzherzogs Leopold Wilhelm
von Österreich.**) Nennt man die
großen Kunstfreunde und Sammler ver-
gangener Zeiten, so kommt man bald
zum Namen des Erzherzogs Leopold
Wilhelm. Seinen Bemühungen verdankt
*) Ohne Zweifel ist es leichter, ein dickes
gelehrtes Buch über Erkenntnistheorie zu
schreiben, als in wenigen Worten auszu-
drücken, welches die erkenntnistheoretischen
Grundlagen der Kunstphilosophie sind. Ich
konnte nur das Wesentliche andeuten. Über
Erkenntnistheorie äußerte ich mich 1899 im
ersten Bändchen meiner philosophischen
Schriften. Auf S. 30 ist in der 5. Zeile von
unten ein Druckfehler (nicht Schreibfehler)
zu verbessern: das neugeborene Kind steht
gedruckt.Es soll heißen das ungeborene. —Für
die vorliegenden Blätter ist die Behandlung
weiterer Fragen der Kunstphilosophie
in Aussicht genommen.
**) Nr. 1 bis 3 dieser Reihe stehen in der
ersten und zweiten Lieferung der Blätter für
Gemäldekunde.
man ganze Reihen trefflicher Bilder, die
heute in der kaiserlichen Galerie in
Wien zu sehen sind. Vieles kam nach
Dresden, einiges in die ungarische Lan-
desgalerie, in englischen Privatbesitz,
nach Florenz und noch anderswohin.
Die Geschichte seiner Sammlung ist
nicht in wenige Worte zu fassen, und
ich verweise im allgemeinen auf die
Erörterung in meiner „Geschichte der
Wiener Gemäldesammlungen“ (I, Seite
ii9ff.). Zum Überblick über den großen
Gemäldebesitz verhilft uns das Inventar
von 1659 mit einigen späteren Nach'
trägen, dessen Veröffentlichung in neu-
erer Zeit durch Quirin Leitner veran-
laßt und durch Adolf Berger ausgeführt
worden ist (im „Jahrbuch der kunst-
historischen Sammlungen des Aller'
höchsten Kaiserhauses“, Band I). Durch'
aus nicht alle Bilder der Sammlung
sind heute mit Bestimmtheit nachzu'
weisen, und viele Mitglieder der zahl'
reichen Bildergesellschaft gelten als ver'
schollen. Vor etwa einem Jahre fand
ich, fast möchte ich sagen, durch Zu'
fall, eines der Gemälde wieder, deren
Verstecktheit mir jahrelang eine quä'
lende wissenschaftliche Sorge bildete.*)
Ich kannte es längst nach der Beschrei'
bung im Inventar der Galerie des Erz'
herzogs Leopold Wilhelm und wußte
nach einer kleinen Abbildung, daß es
noch um 1730 in kaiserlichem Besitz
war. Wo es stack, hatte ich lange nicht
herausgebracht. Die Darstellung ist gar
sonderbar. Eine Zauberin will sich eben
in ihren magischen Kreisen nieder'
knien und verläßt den Sitz, auf dem
sie nur mehr zur Hälfte ruht. Dabei
dreht sie den Oberkörper und Kopf
zurück nach einem Fenster, das rechts
im Hintergründe offen steht und an
dem gerade der kleine Eros vorüber'
schwebt. Links im Halbschatten schlum-
*) Von dem Funde habe ich kurze Nach-
richt gegeben in der Wiener Montags-Revue
im Feuilleton „Aus allerlei Galerien“.
119
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
lieh daran erinnert, was für possierliche
Sprünge die Philosophie aufführt, um
sich nur ja vermeintlich recht hoch über
alles gewöhnliche Denken zu erheben.
Ich bin in den wenigen Zeilen, die
der Sache gewidmet wurden'1'), für das
Bewußtsein eines wirklichen Ich und
für den Glauben an die wirkliche Äußern
weit eingetreten. Diese Art von Er-
kenntnistheorie gewährt für die Ge-
mäldekunde zum mindesten den Vor-
teil, bei der gebräuchlichen Benennung
der Dinge verbleiben zu können und
es als vernünftig hingehen zu lassen,
daß man sich in der Wissenschaft von
den Bildern an andere wende und sich
nicht auf das eigene Empfinden und
Fühlen beschränke.
WIEDERGEFUNDENE
BILDER AUS BERÜHMTEN
ALTEN SAMMLUNGEN.
4. Ein Italiener aus der Galerie
des Erzherzogs Leopold Wilhelm
von Österreich.**) Nennt man die
großen Kunstfreunde und Sammler ver-
gangener Zeiten, so kommt man bald
zum Namen des Erzherzogs Leopold
Wilhelm. Seinen Bemühungen verdankt
*) Ohne Zweifel ist es leichter, ein dickes
gelehrtes Buch über Erkenntnistheorie zu
schreiben, als in wenigen Worten auszu-
drücken, welches die erkenntnistheoretischen
Grundlagen der Kunstphilosophie sind. Ich
konnte nur das Wesentliche andeuten. Über
Erkenntnistheorie äußerte ich mich 1899 im
ersten Bändchen meiner philosophischen
Schriften. Auf S. 30 ist in der 5. Zeile von
unten ein Druckfehler (nicht Schreibfehler)
zu verbessern: das neugeborene Kind steht
gedruckt.Es soll heißen das ungeborene. —Für
die vorliegenden Blätter ist die Behandlung
weiterer Fragen der Kunstphilosophie
in Aussicht genommen.
**) Nr. 1 bis 3 dieser Reihe stehen in der
ersten und zweiten Lieferung der Blätter für
Gemäldekunde.
man ganze Reihen trefflicher Bilder, die
heute in der kaiserlichen Galerie in
Wien zu sehen sind. Vieles kam nach
Dresden, einiges in die ungarische Lan-
desgalerie, in englischen Privatbesitz,
nach Florenz und noch anderswohin.
Die Geschichte seiner Sammlung ist
nicht in wenige Worte zu fassen, und
ich verweise im allgemeinen auf die
Erörterung in meiner „Geschichte der
Wiener Gemäldesammlungen“ (I, Seite
ii9ff.). Zum Überblick über den großen
Gemäldebesitz verhilft uns das Inventar
von 1659 mit einigen späteren Nach'
trägen, dessen Veröffentlichung in neu-
erer Zeit durch Quirin Leitner veran-
laßt und durch Adolf Berger ausgeführt
worden ist (im „Jahrbuch der kunst-
historischen Sammlungen des Aller'
höchsten Kaiserhauses“, Band I). Durch'
aus nicht alle Bilder der Sammlung
sind heute mit Bestimmtheit nachzu'
weisen, und viele Mitglieder der zahl'
reichen Bildergesellschaft gelten als ver'
schollen. Vor etwa einem Jahre fand
ich, fast möchte ich sagen, durch Zu'
fall, eines der Gemälde wieder, deren
Verstecktheit mir jahrelang eine quä'
lende wissenschaftliche Sorge bildete.*)
Ich kannte es längst nach der Beschrei'
bung im Inventar der Galerie des Erz'
herzogs Leopold Wilhelm und wußte
nach einer kleinen Abbildung, daß es
noch um 1730 in kaiserlichem Besitz
war. Wo es stack, hatte ich lange nicht
herausgebracht. Die Darstellung ist gar
sonderbar. Eine Zauberin will sich eben
in ihren magischen Kreisen nieder'
knien und verläßt den Sitz, auf dem
sie nur mehr zur Hälfte ruht. Dabei
dreht sie den Oberkörper und Kopf
zurück nach einem Fenster, das rechts
im Hintergründe offen steht und an
dem gerade der kleine Eros vorüber'
schwebt. Links im Halbschatten schlum-
*) Von dem Funde habe ich kurze Nach-
richt gegeben in der Wiener Montags-Revue
im Feuilleton „Aus allerlei Galerien“.