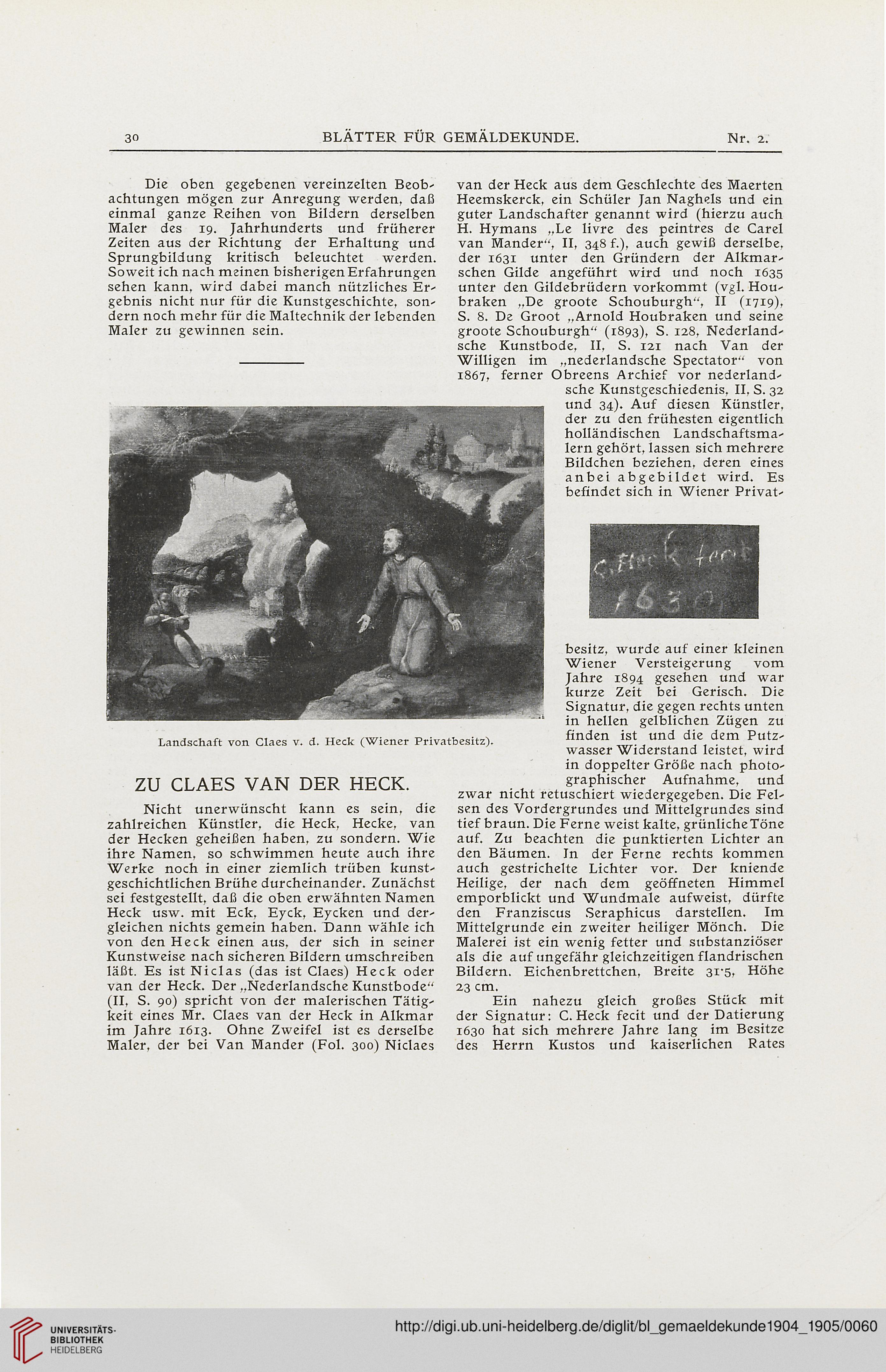30
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
Nr. 2.
Landschaft von Glaes v. d. Heck (Wiener Privatbesitz).
ZU CLAES VAN DER HECK.
Nicht unerwünscht kann es sein, die
zahlreichen Künstler, die Heck, Hecke, van
der Hecken geheißen haben, zu sondern. Wie
ihre Namen, so schwimmen heute auch ihre
Werke noch in einer ziemlich trüben kunst-
geschichtlichen Brühe durcheinander. Zunächst
sei festgestellt, daß die oben erwähnten Namen
Heck usw. mit Eck, Eyck, Eycken und der-
gleichen nichts gemein haben. Dann wähle ich
von den Heck einen aus, der sich in seiner
Kunstweise nach sicheren Bildern umschreiben
läßt. Es ist Niclas (das ist Claes) Heck oder
van der Heck. Der „Nederlandsche Kunstbode“
(II, S. 90) spricht von der malerischen Tätig-
keit eines Mr. Claes van der Heck in Alkmar
im Jahre 1613. Ohne Zweifel ist es derselbe
Maler, der bei Van Mander (Fol. 300) Nidaes
besitz, wurde auf einer kleinen
Wiener Versteigerung vom
Jahre 1894 gesehen und war
kurze Zeit bei Gerisch. Die
Signatur, die gegen rechts unten
in hellen gelblichen Zügen zu
finden ist und die dem Putz-
wasser Widerstand leistet, wird
in doppelter Größe nach photo-
graphischer Aufnahme, und
zwar nicht retuschiert wiedergegeben. Die Fel-
sen des Vordergrundes und Mittelgrundes sind
tief braun. Die Ferne weist kalte, grünlicheTöne
auf. Zu beachten die punktierten Lichter an
den Bäumen. In der Ferne rechts kommen
auch gestrichelte Lichter vor. Der kniende
Heilige, der nach dem geöffneten Himmel
emporblickt und Wundmale aufweist, dürfte
den Franziscus Seraphicus darstellen. Im
Mittelgründe ein zweiter heiliger Mönch. Die
Malerei ist ein wenig fetter und substanziöser
als die auf ungefähr gleichzeitigen flandrischen
Bildern. Eichenbrettchen, Breite 31-5, Höhe
23 cm.
Ein nahezu gleich großes Stück mit
der Signatur: C. Heck fecit und der Datierung
1630 hat sich mehrere Jahre lang im Besitze
des Herrn Kustos und kaiserlichen Rates
Die oben gegebenen vereinzelten Beob-
achtungen mögen zur Anregung werden, daß
einmal ganze Reihen von Bildern derselben
Maler des 19. Jahrhunderts und früherer
Zeiten aus der Richtung der Erhaltung und
Sprungbildung kritisch beleuchtet werden.
Soweit ich nach meinen bisherigen Erfahrungen
sehen kann, wird dabei manch nützliches Er-
gebnis nicht nur für die Kunstgeschichte, son-
dern noch mehr für die Maltechnik der lebenden
Maler zu gewinnen sein.
van der Heck aus dem Geschlechte des Maerten
Heemskerck, ein Schüler Jan Naghels und ein
guter Landschafter genannt wird (hierzu auch
H. Hymans „Le livre des peintres de Carel
van Mander“, II, 348 f.), auch gewiß derselbe,
der 1631 unter den Gründern der Alkmar-
schen Gilde angeführt wird und noch 1635
unter den Gildebrüdern vorkommt (vgl. Hou-
braken „De groote Schouburgh“, II (1719),
S. 8. De Groot „Arnold Houbraken und seine
groote Schouburgh“ (1893), S. 128, Nederland-
sche Kunstbode, II, S. 121 nach Van der
Willigen im „nederlandsche Spectator“ von
1867, ferner Obreens Archief vor nederland-
sche Kunstgeschiedenis, II, S. 32
und 34). Auf diesen Künstler,
der zu den frühesten eigentlich
holländischen Landschaftsma-
lern gehört, lassen sich mehrere
Bildchen beziehen, deren eines
anbei abgebildet wird. Es
befindet sich in Wiener Privat-
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
Nr. 2.
Landschaft von Glaes v. d. Heck (Wiener Privatbesitz).
ZU CLAES VAN DER HECK.
Nicht unerwünscht kann es sein, die
zahlreichen Künstler, die Heck, Hecke, van
der Hecken geheißen haben, zu sondern. Wie
ihre Namen, so schwimmen heute auch ihre
Werke noch in einer ziemlich trüben kunst-
geschichtlichen Brühe durcheinander. Zunächst
sei festgestellt, daß die oben erwähnten Namen
Heck usw. mit Eck, Eyck, Eycken und der-
gleichen nichts gemein haben. Dann wähle ich
von den Heck einen aus, der sich in seiner
Kunstweise nach sicheren Bildern umschreiben
läßt. Es ist Niclas (das ist Claes) Heck oder
van der Heck. Der „Nederlandsche Kunstbode“
(II, S. 90) spricht von der malerischen Tätig-
keit eines Mr. Claes van der Heck in Alkmar
im Jahre 1613. Ohne Zweifel ist es derselbe
Maler, der bei Van Mander (Fol. 300) Nidaes
besitz, wurde auf einer kleinen
Wiener Versteigerung vom
Jahre 1894 gesehen und war
kurze Zeit bei Gerisch. Die
Signatur, die gegen rechts unten
in hellen gelblichen Zügen zu
finden ist und die dem Putz-
wasser Widerstand leistet, wird
in doppelter Größe nach photo-
graphischer Aufnahme, und
zwar nicht retuschiert wiedergegeben. Die Fel-
sen des Vordergrundes und Mittelgrundes sind
tief braun. Die Ferne weist kalte, grünlicheTöne
auf. Zu beachten die punktierten Lichter an
den Bäumen. In der Ferne rechts kommen
auch gestrichelte Lichter vor. Der kniende
Heilige, der nach dem geöffneten Himmel
emporblickt und Wundmale aufweist, dürfte
den Franziscus Seraphicus darstellen. Im
Mittelgründe ein zweiter heiliger Mönch. Die
Malerei ist ein wenig fetter und substanziöser
als die auf ungefähr gleichzeitigen flandrischen
Bildern. Eichenbrettchen, Breite 31-5, Höhe
23 cm.
Ein nahezu gleich großes Stück mit
der Signatur: C. Heck fecit und der Datierung
1630 hat sich mehrere Jahre lang im Besitze
des Herrn Kustos und kaiserlichen Rates
Die oben gegebenen vereinzelten Beob-
achtungen mögen zur Anregung werden, daß
einmal ganze Reihen von Bildern derselben
Maler des 19. Jahrhunderts und früherer
Zeiten aus der Richtung der Erhaltung und
Sprungbildung kritisch beleuchtet werden.
Soweit ich nach meinen bisherigen Erfahrungen
sehen kann, wird dabei manch nützliches Er-
gebnis nicht nur für die Kunstgeschichte, son-
dern noch mehr für die Maltechnik der lebenden
Maler zu gewinnen sein.
van der Heck aus dem Geschlechte des Maerten
Heemskerck, ein Schüler Jan Naghels und ein
guter Landschafter genannt wird (hierzu auch
H. Hymans „Le livre des peintres de Carel
van Mander“, II, 348 f.), auch gewiß derselbe,
der 1631 unter den Gründern der Alkmar-
schen Gilde angeführt wird und noch 1635
unter den Gildebrüdern vorkommt (vgl. Hou-
braken „De groote Schouburgh“, II (1719),
S. 8. De Groot „Arnold Houbraken und seine
groote Schouburgh“ (1893), S. 128, Nederland-
sche Kunstbode, II, S. 121 nach Van der
Willigen im „nederlandsche Spectator“ von
1867, ferner Obreens Archief vor nederland-
sche Kunstgeschiedenis, II, S. 32
und 34). Auf diesen Künstler,
der zu den frühesten eigentlich
holländischen Landschaftsma-
lern gehört, lassen sich mehrere
Bildchen beziehen, deren eines
anbei abgebildet wird. Es
befindet sich in Wiener Privat-