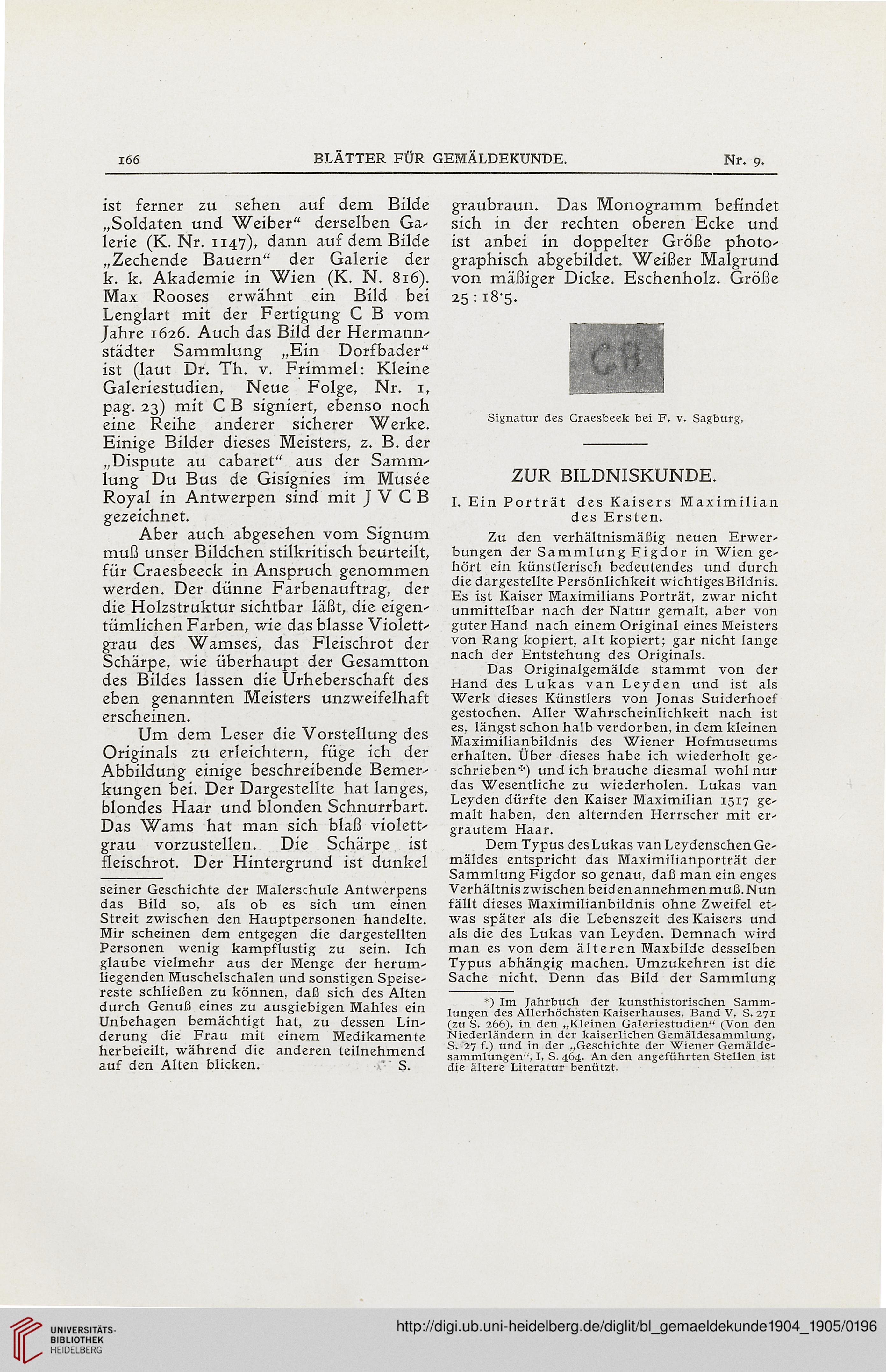166
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
Nr. 9.
ist ferner zu sehen auf dem Bilde
„Soldaten und Weiber“ derselben Ga-
lerie (K. Nr. 1147), dann auf dem Bilde
„Zechende Bauern“ der Galerie der
k. k. Akademie in Wien (K. N. 816).
Max Rooses erwähnt ein Bild bei
Lenglart mit der Fertigung C B vom
Jahre 1626. Auch das Bild der Hermann-
Städter Sammlung „Ein Dorfbader“
ist (laut Dr. Th. v. Frimmel: Kleine
Galeriestudien, Neue Folge, Nr. 1,
pag. 23) mit C B signiert, ebenso noch
eine Reihe anderer sicherer Werke.
Einige Bilder dieses Meisters, z. B. der
„Dispute au cabaret“ aus der Samm-
lung Du Bus de Gisignies im Musee
Royal in Antwerpen sind mit J V C B
gezeichnet.
Aber auch abgesehen vom Signum
muß unser Bildchen stilkritisch beurteilt,
für Craesbeeck in Anspruch genommen
werden. Der dünne Farbenauftrag, der
die Holzstruktur sichtbar läßt, die eigen-
tümlichen Farben, wie das blasse Violett-
grau des Wamses, das Fleischrot der
Schärpe, wie überhaupt der Gesamtton
des Bildes lassen die Urheberschaft des
eben genannten Meisters unzweifelhaft
erscheinen.
Um dem Leser die Vorstellung des
Originals zu erleichtern, füge ich der
Abbildung einige beschreibende Bemer-
kungen bei. Der Dargestellte hat langes,
blondes Haar und blonden Schnurrbart.
Das Wams hat man sich blaß violett-
grau vorzustellen. Die Schärpe ist
fleischrot. Der Hintergrund ist dunkel
seiner Geschichte der Malerschule Antwerpens
das Bild so, als ob es sich um einen
Streit zwischen den Hauptpersonen handelte.
Mir scheinen dem entgegen die dargestellten
Personen wenig kampflustig zu sein. Ich
glaube vielmehr aus der Menge der herum-
liegenden Muschelschalen und sonstigen Speise-
reste schließen zu können, daß sich des Alten
durch Genuß eines zu ausgiebigen Mahles ein
Unbehagen bemächtigt hat, zu dessen Lin-
derung die Frau mit einem Medikamente
herbeieilt, während die anderen teilnehmend
auf den Alten blicken. S.
graubraun. Das Monogramm befindet
sich in der rechten oberen Ecke und
ist anbei in doppelter Größe photo-
graphisch abgebildet. Weißer Malgrund
von mäßiger Dicke. Eschenholz. Größe
25:18-5.
Signatur des Graesbeek bei F. v. Sagburg,
ZUR BILDNISKUNDE.
I. Ein Porträt des Kaisers Maximilian
des Ersten.
Zu den verhältnismäßig neuen Erwer-
bungen der Sammlung Figdor in Wien ge-
hört ein künstlerisch bedeutendes und durch
die dargestellte Persönlichkeit wichtiges Bildnis.
Es ist Kaiser Maximilians Porträt, zwar nicht
unmittelbar nach der Natur gemalt, aber von
guter Hand nach einem Original eines Meisters
von Rang kopiert, alt kopiert; gar nicht lange
nach der Entstehung des Originals.
Das Originalgemälde stammt von der
Hand des Lukas van Leyden und ist als
Werk dieses Künstlers von Jonas Suiderhoef
gestochen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist
es, längst schon halb verdorben, in dem kleinen
Maximilianbildnis des Wiener Hofmuseums
erhalten. Über dieses habe ich wiederholt ge-
schrieben-1-) und ich brauche diesmal wohl nur
das Wesentliche zu wiederholen. Lukas van
Leyden dürfte den Kaiser Maximilian 1517 ge-
malt haben, den alternden Herrscher mit er-
grautem Haar.
Dem Typus des Lukas vanLeydenschen Ge-
mäldes entspricht das Maximilianporträt der
Sammlung Figdor so genau, daß man ein enges
Verhältnis zwischen beid en annehmen muß. Nun
fällt dieses Maximilianbildnis ohne Zweifel et-
was später als die Lebenszeit des Kaisers und
als die des Lukas van Leyden. Demnach wird
man es von dem älteren Maxbilde desselben
Typus abhängig machen. Umzukehren ist die
Sache nicht. Denn das Bild der Sammlung
*) Im Jahrbuch der kunsthistorischen Samm-
lungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Band V, S. 271
(zu S. 266), in den „Kleinen Galeriestudien“ (Von den
Niederländern in der kaiserlichen Gemäldesammlung,
S. 27 f.) und in der „Geschichte der Wiener Gemälde-
sammlungen“, I, S. 464. An den angeführten Stellen ist
die ältere Literatur benützt.
BLÄTTER FÜR GEMÄLDEKUNDE.
Nr. 9.
ist ferner zu sehen auf dem Bilde
„Soldaten und Weiber“ derselben Ga-
lerie (K. Nr. 1147), dann auf dem Bilde
„Zechende Bauern“ der Galerie der
k. k. Akademie in Wien (K. N. 816).
Max Rooses erwähnt ein Bild bei
Lenglart mit der Fertigung C B vom
Jahre 1626. Auch das Bild der Hermann-
Städter Sammlung „Ein Dorfbader“
ist (laut Dr. Th. v. Frimmel: Kleine
Galeriestudien, Neue Folge, Nr. 1,
pag. 23) mit C B signiert, ebenso noch
eine Reihe anderer sicherer Werke.
Einige Bilder dieses Meisters, z. B. der
„Dispute au cabaret“ aus der Samm-
lung Du Bus de Gisignies im Musee
Royal in Antwerpen sind mit J V C B
gezeichnet.
Aber auch abgesehen vom Signum
muß unser Bildchen stilkritisch beurteilt,
für Craesbeeck in Anspruch genommen
werden. Der dünne Farbenauftrag, der
die Holzstruktur sichtbar läßt, die eigen-
tümlichen Farben, wie das blasse Violett-
grau des Wamses, das Fleischrot der
Schärpe, wie überhaupt der Gesamtton
des Bildes lassen die Urheberschaft des
eben genannten Meisters unzweifelhaft
erscheinen.
Um dem Leser die Vorstellung des
Originals zu erleichtern, füge ich der
Abbildung einige beschreibende Bemer-
kungen bei. Der Dargestellte hat langes,
blondes Haar und blonden Schnurrbart.
Das Wams hat man sich blaß violett-
grau vorzustellen. Die Schärpe ist
fleischrot. Der Hintergrund ist dunkel
seiner Geschichte der Malerschule Antwerpens
das Bild so, als ob es sich um einen
Streit zwischen den Hauptpersonen handelte.
Mir scheinen dem entgegen die dargestellten
Personen wenig kampflustig zu sein. Ich
glaube vielmehr aus der Menge der herum-
liegenden Muschelschalen und sonstigen Speise-
reste schließen zu können, daß sich des Alten
durch Genuß eines zu ausgiebigen Mahles ein
Unbehagen bemächtigt hat, zu dessen Lin-
derung die Frau mit einem Medikamente
herbeieilt, während die anderen teilnehmend
auf den Alten blicken. S.
graubraun. Das Monogramm befindet
sich in der rechten oberen Ecke und
ist anbei in doppelter Größe photo-
graphisch abgebildet. Weißer Malgrund
von mäßiger Dicke. Eschenholz. Größe
25:18-5.
Signatur des Graesbeek bei F. v. Sagburg,
ZUR BILDNISKUNDE.
I. Ein Porträt des Kaisers Maximilian
des Ersten.
Zu den verhältnismäßig neuen Erwer-
bungen der Sammlung Figdor in Wien ge-
hört ein künstlerisch bedeutendes und durch
die dargestellte Persönlichkeit wichtiges Bildnis.
Es ist Kaiser Maximilians Porträt, zwar nicht
unmittelbar nach der Natur gemalt, aber von
guter Hand nach einem Original eines Meisters
von Rang kopiert, alt kopiert; gar nicht lange
nach der Entstehung des Originals.
Das Originalgemälde stammt von der
Hand des Lukas van Leyden und ist als
Werk dieses Künstlers von Jonas Suiderhoef
gestochen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist
es, längst schon halb verdorben, in dem kleinen
Maximilianbildnis des Wiener Hofmuseums
erhalten. Über dieses habe ich wiederholt ge-
schrieben-1-) und ich brauche diesmal wohl nur
das Wesentliche zu wiederholen. Lukas van
Leyden dürfte den Kaiser Maximilian 1517 ge-
malt haben, den alternden Herrscher mit er-
grautem Haar.
Dem Typus des Lukas vanLeydenschen Ge-
mäldes entspricht das Maximilianporträt der
Sammlung Figdor so genau, daß man ein enges
Verhältnis zwischen beid en annehmen muß. Nun
fällt dieses Maximilianbildnis ohne Zweifel et-
was später als die Lebenszeit des Kaisers und
als die des Lukas van Leyden. Demnach wird
man es von dem älteren Maxbilde desselben
Typus abhängig machen. Umzukehren ist die
Sache nicht. Denn das Bild der Sammlung
*) Im Jahrbuch der kunsthistorischen Samm-
lungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Band V, S. 271
(zu S. 266), in den „Kleinen Galeriestudien“ (Von den
Niederländern in der kaiserlichen Gemäldesammlung,
S. 27 f.) und in der „Geschichte der Wiener Gemälde-
sammlungen“, I, S. 464. An den angeführten Stellen ist
die ältere Literatur benützt.