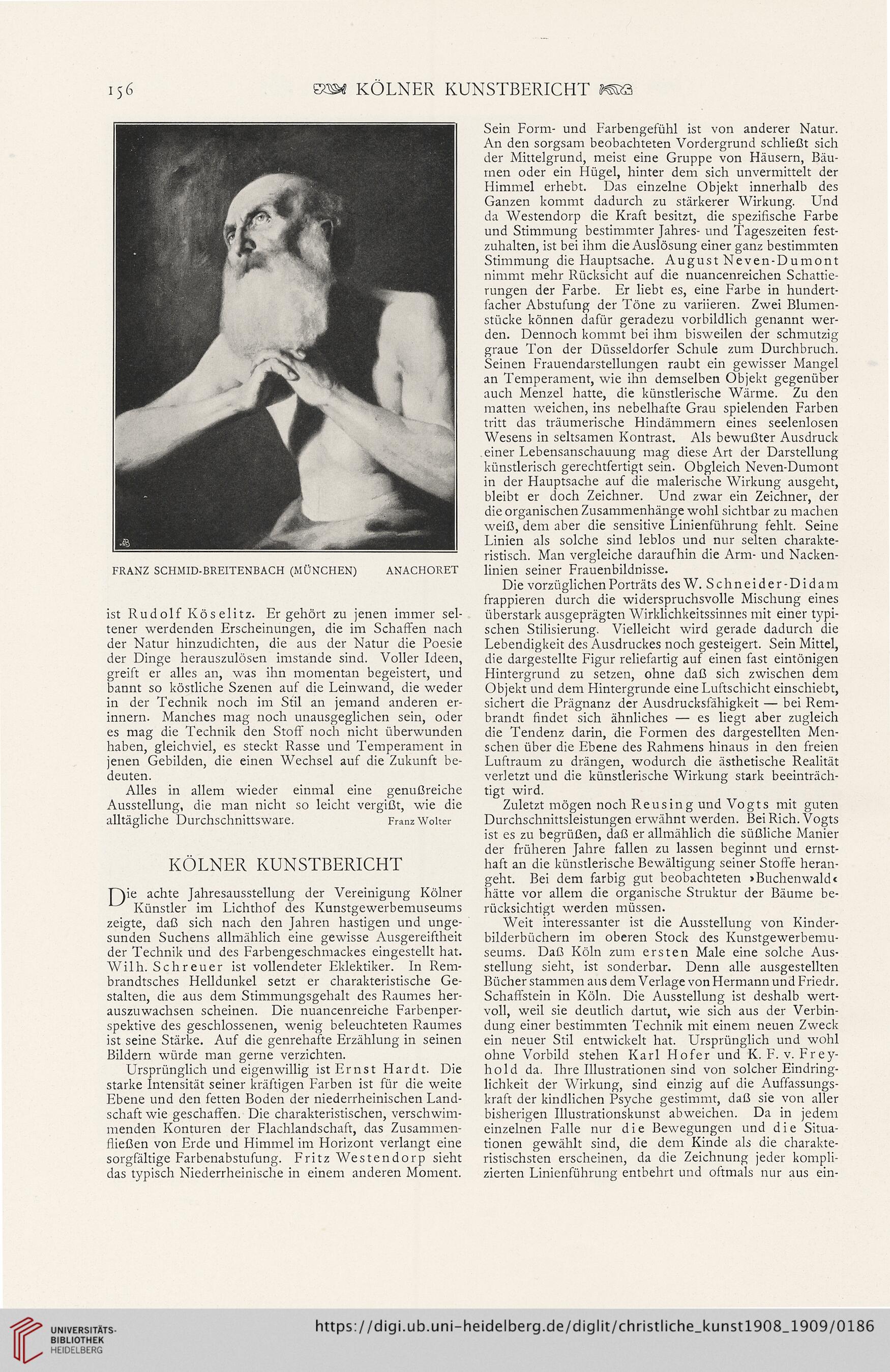156
SW KÖLNER KUNSTBERICHT ^2
FRANZ SCHMID-BREITENBACH (MÜNCHEN) ANACHORET
ist Rudolf Köselitz. Er gehört zu jenen immer sel-
tener werdenden Erscheinungen, die im Schaffen nach
der Natur hinzudichten, die aus der Natur die Poesie
der Dinge herauszulösen imstande sind. Voller Ideen,
greift er alles an, was ihn momentan begeistert, und
bannt so köstliche Szenen auf die Leinwand, die weder
in der Technik noch im Stil an jemand anderen er-
innern. Manches mag noch unausgeglichen sein, oder
es mag die Technik den Stoff noch nicht überwunden
haben, gleichviel, es steckt Rasse und Temperament in
jenen Gebilden, die einen Wechsel auf die Zukunft be-
deuten.
Alles in allem wieder einmal eine genußreiche
Ausstellung, die man nicht so leicht vergißt, wie die
alltägliche Durchschnittsware. Franz Wolter
KÖLNER KUNSTBERICHT
P )ie achte Jahresausstellung der Vereinigung Kölner
Künstler im Lichthof des Kunstgewerbemuseums
zeigte, daß sich nach den Jahren hastigen und unge-
sunden Suchens allmählich eine gewisse Ausgereiftheit
der Technik und des Farbengeschmackes eingestellt hat.
Wilh. Schreuer ist vollendeter Eklektiker. In Rem-
brandtsches Helldunkel setzt er charakteristische Ge-
stalten, die aus dem Stimmungsgehalt des Raumes her-
auszuwachsen scheinen. Die nuancenreiche Farbenper-
spektive des geschlossenen, wenig beleuchteten Raumes
ist seine Stärke. Auf die genrehafte Erzählung in seinen
Bildern würde man gerne verzichten.
Ursprünglich und eigenwillig ist Ernst Hardt. Die
starke Intensität seiner kräftigen Farben ist für die weite
Ebene und den fetten Boden der niederrheinischen Land-
schaft wie geschaffen. Die charakteristischen, verschwim-
menden Konturen der Flachlandschaft, das Zusammen-
fließen von Erde und Himmel im Horizont verlangt eine
sorgfältige Farbenabstufung. Fritz Westendorp sieht
das typisch Niederrheinische in einem anderen Moment.
Sein Form- und Farbengefühl ist von anderer Natur.
An den sorgsam beobachteten Vordergrund schließt sich
der Mittelgrund, meist eine Gruppe von Häusern, Bäu-
men oder ein Hügel, hinter dem sich unvermittelt der
Himmel erhebt. Das einzelne Objekt innerhalb des
Ganzen kommt dadurch zu stärkerer Wirkung. Und
da Westendorp die Kraft besitzt, die spezifische Farbe
und Stimmung bestimmter Jahres- und Tageszeiten fest-
zuhalten, ist bei ihm die Auslösung einer ganz bestimmten
Stimmung die Hauptsache. August Neven-Dumont
nimmt mehr Rücksicht auf die nuancenreichen Schattie-
rungen der Farbe. Er liebt es, eine Farbe in hundert-
facher Abstufung der Töne zu variieren. Zwei Blumen-
stücke können dafür geradezu vorbildlich genannt wer-
den. Dennoch kommt bei ihm bisweilen der schmutzig
graue Ton der Düsseldorfer Schule zum Durchbruch.
Seinen Frauendarstellungen raubt ein gewisser Mangel
an Temperament, wie ihn demselben Objekt gegenüber
auch Menzel hatte, die künstlerische Wärme. Zu den
matten weichen, ins nebelhafte Grau spielenden Farben
tritt das träumerische Hindämmern eines seelenlosen
Wesens in seltsamen Kontrast. Als bewußter Ausdruck
einer Lebensanschauung mag diese Art der Darstellung
künstlerisch gerechtfertigt sein. Obgleich Neven-Dumont
in der Hauptsache auf die malerische Wirkung ausgeht,
bleibt er doch Zeichner. Und zwar ein Zeichner, der
die organischen Zusammenhänge wohl sichtbar zu machen
weiß, dem aber die sensitive Linienführung fehlt. Seine
Linien als solche sind leblos und nur selten charakte-
ristisch. Man vergleiche daraufhin die Arm- und Nacken-
linien seiner Frauenbildnisse.
Die vorzüglichen Porträts des W. Schneider-Didam
frappieren durch die widerspruchsvolle Mischung eines
überstark ausgeprägten Wirklichkeitssinnes mit einer typi-
schen Stilisierung. Vielleicht wird gerade dadurch die
Lebendigkeit des Ausdruckes noch gesteigert. Sein Mittel,
die dargestellte Figur reliefartig auf einen fast eintönigen
Hintergrund zu setzen, ohne daß sich zwischen dem
Objekt und dem Hintergründe eine Luftschicht einschiebt,
sichert die Prägnanz der Ausdrucksfähigkeit — bei Rem-
brandt findet sich ähnliches — es liegt aber zugleich
die Tendenz darin, die Formen des dargestellten Men-
schen über die Ebene des Rahmens hinaus in den freien
Luftraum zu drängen, wodurch die ästhetische Realität
verletzt und die künstlerische Wirkung stark beeinträch-
tigt wird.
Zuletzt mögen noch Reusing und Vogts mit guten
Durchschnittsleistungen erwähnt werden. Bei Rich. Vogts
ist es zu begrüßen, daß er allmählich die süßliche Manier
der früheren Jahre fallen zu lassen beginnt und ernst-
haft an die künstlerische Bewältigung seiner Stoffe heran-
geht. Bei dem farbig gut beobachteten »Buchenwald«
hätte vor allem die organische Struktur der Bäume be-
rücksichtigt werden müssen.
Weit interessanter ist die Ausstellung von Kinder-
bilderbüchern im oberen Stock des Kunstgewerbemu-
seums. Daß Köln zum ersten Male eine solche Aus-
stellung sieht, ist sonderbar. Denn alle ausgestellten
Bücher stammen aus dem Verlage von Fiermann und Friedr.
Schaffstein in Köln. Die Ausstellung ist deshalb wert-
voll, weil sie deutlich dartut, wie sich aus der Verbin-
dung einer bestimmten Technik mit einem neuen Zweck
ein neuer Stil entwickelt hat. Ursprünglich und wohl
ohne Vorbild stehen Karl Hofer und K.F.v. Frey-
hold da. Ihre Illustrationen sind von solcher Eindring-
lichkeit der Wirkung, sind einzig auf die Auffassungs-
kraft der kindlichen Psyche gestimmt, daß sie von aller
bisherigen Illustrationskunst abweichen. Da in jedem
einzelnen Falle nur die Bewegungen und die Situa-
tionen gewählt sind, die dem Kinde als die charakte-
ristischsten erscheinen, da die Zeichnung jeder kompli-
zierten Linienführung entbehrt und oftmals nur aus ein-
SW KÖLNER KUNSTBERICHT ^2
FRANZ SCHMID-BREITENBACH (MÜNCHEN) ANACHORET
ist Rudolf Köselitz. Er gehört zu jenen immer sel-
tener werdenden Erscheinungen, die im Schaffen nach
der Natur hinzudichten, die aus der Natur die Poesie
der Dinge herauszulösen imstande sind. Voller Ideen,
greift er alles an, was ihn momentan begeistert, und
bannt so köstliche Szenen auf die Leinwand, die weder
in der Technik noch im Stil an jemand anderen er-
innern. Manches mag noch unausgeglichen sein, oder
es mag die Technik den Stoff noch nicht überwunden
haben, gleichviel, es steckt Rasse und Temperament in
jenen Gebilden, die einen Wechsel auf die Zukunft be-
deuten.
Alles in allem wieder einmal eine genußreiche
Ausstellung, die man nicht so leicht vergißt, wie die
alltägliche Durchschnittsware. Franz Wolter
KÖLNER KUNSTBERICHT
P )ie achte Jahresausstellung der Vereinigung Kölner
Künstler im Lichthof des Kunstgewerbemuseums
zeigte, daß sich nach den Jahren hastigen und unge-
sunden Suchens allmählich eine gewisse Ausgereiftheit
der Technik und des Farbengeschmackes eingestellt hat.
Wilh. Schreuer ist vollendeter Eklektiker. In Rem-
brandtsches Helldunkel setzt er charakteristische Ge-
stalten, die aus dem Stimmungsgehalt des Raumes her-
auszuwachsen scheinen. Die nuancenreiche Farbenper-
spektive des geschlossenen, wenig beleuchteten Raumes
ist seine Stärke. Auf die genrehafte Erzählung in seinen
Bildern würde man gerne verzichten.
Ursprünglich und eigenwillig ist Ernst Hardt. Die
starke Intensität seiner kräftigen Farben ist für die weite
Ebene und den fetten Boden der niederrheinischen Land-
schaft wie geschaffen. Die charakteristischen, verschwim-
menden Konturen der Flachlandschaft, das Zusammen-
fließen von Erde und Himmel im Horizont verlangt eine
sorgfältige Farbenabstufung. Fritz Westendorp sieht
das typisch Niederrheinische in einem anderen Moment.
Sein Form- und Farbengefühl ist von anderer Natur.
An den sorgsam beobachteten Vordergrund schließt sich
der Mittelgrund, meist eine Gruppe von Häusern, Bäu-
men oder ein Hügel, hinter dem sich unvermittelt der
Himmel erhebt. Das einzelne Objekt innerhalb des
Ganzen kommt dadurch zu stärkerer Wirkung. Und
da Westendorp die Kraft besitzt, die spezifische Farbe
und Stimmung bestimmter Jahres- und Tageszeiten fest-
zuhalten, ist bei ihm die Auslösung einer ganz bestimmten
Stimmung die Hauptsache. August Neven-Dumont
nimmt mehr Rücksicht auf die nuancenreichen Schattie-
rungen der Farbe. Er liebt es, eine Farbe in hundert-
facher Abstufung der Töne zu variieren. Zwei Blumen-
stücke können dafür geradezu vorbildlich genannt wer-
den. Dennoch kommt bei ihm bisweilen der schmutzig
graue Ton der Düsseldorfer Schule zum Durchbruch.
Seinen Frauendarstellungen raubt ein gewisser Mangel
an Temperament, wie ihn demselben Objekt gegenüber
auch Menzel hatte, die künstlerische Wärme. Zu den
matten weichen, ins nebelhafte Grau spielenden Farben
tritt das träumerische Hindämmern eines seelenlosen
Wesens in seltsamen Kontrast. Als bewußter Ausdruck
einer Lebensanschauung mag diese Art der Darstellung
künstlerisch gerechtfertigt sein. Obgleich Neven-Dumont
in der Hauptsache auf die malerische Wirkung ausgeht,
bleibt er doch Zeichner. Und zwar ein Zeichner, der
die organischen Zusammenhänge wohl sichtbar zu machen
weiß, dem aber die sensitive Linienführung fehlt. Seine
Linien als solche sind leblos und nur selten charakte-
ristisch. Man vergleiche daraufhin die Arm- und Nacken-
linien seiner Frauenbildnisse.
Die vorzüglichen Porträts des W. Schneider-Didam
frappieren durch die widerspruchsvolle Mischung eines
überstark ausgeprägten Wirklichkeitssinnes mit einer typi-
schen Stilisierung. Vielleicht wird gerade dadurch die
Lebendigkeit des Ausdruckes noch gesteigert. Sein Mittel,
die dargestellte Figur reliefartig auf einen fast eintönigen
Hintergrund zu setzen, ohne daß sich zwischen dem
Objekt und dem Hintergründe eine Luftschicht einschiebt,
sichert die Prägnanz der Ausdrucksfähigkeit — bei Rem-
brandt findet sich ähnliches — es liegt aber zugleich
die Tendenz darin, die Formen des dargestellten Men-
schen über die Ebene des Rahmens hinaus in den freien
Luftraum zu drängen, wodurch die ästhetische Realität
verletzt und die künstlerische Wirkung stark beeinträch-
tigt wird.
Zuletzt mögen noch Reusing und Vogts mit guten
Durchschnittsleistungen erwähnt werden. Bei Rich. Vogts
ist es zu begrüßen, daß er allmählich die süßliche Manier
der früheren Jahre fallen zu lassen beginnt und ernst-
haft an die künstlerische Bewältigung seiner Stoffe heran-
geht. Bei dem farbig gut beobachteten »Buchenwald«
hätte vor allem die organische Struktur der Bäume be-
rücksichtigt werden müssen.
Weit interessanter ist die Ausstellung von Kinder-
bilderbüchern im oberen Stock des Kunstgewerbemu-
seums. Daß Köln zum ersten Male eine solche Aus-
stellung sieht, ist sonderbar. Denn alle ausgestellten
Bücher stammen aus dem Verlage von Fiermann und Friedr.
Schaffstein in Köln. Die Ausstellung ist deshalb wert-
voll, weil sie deutlich dartut, wie sich aus der Verbin-
dung einer bestimmten Technik mit einem neuen Zweck
ein neuer Stil entwickelt hat. Ursprünglich und wohl
ohne Vorbild stehen Karl Hofer und K.F.v. Frey-
hold da. Ihre Illustrationen sind von solcher Eindring-
lichkeit der Wirkung, sind einzig auf die Auffassungs-
kraft der kindlichen Psyche gestimmt, daß sie von aller
bisherigen Illustrationskunst abweichen. Da in jedem
einzelnen Falle nur die Bewegungen und die Situa-
tionen gewählt sind, die dem Kinde als die charakte-
ristischsten erscheinen, da die Zeichnung jeder kompli-
zierten Linienführung entbehrt und oftmals nur aus ein-