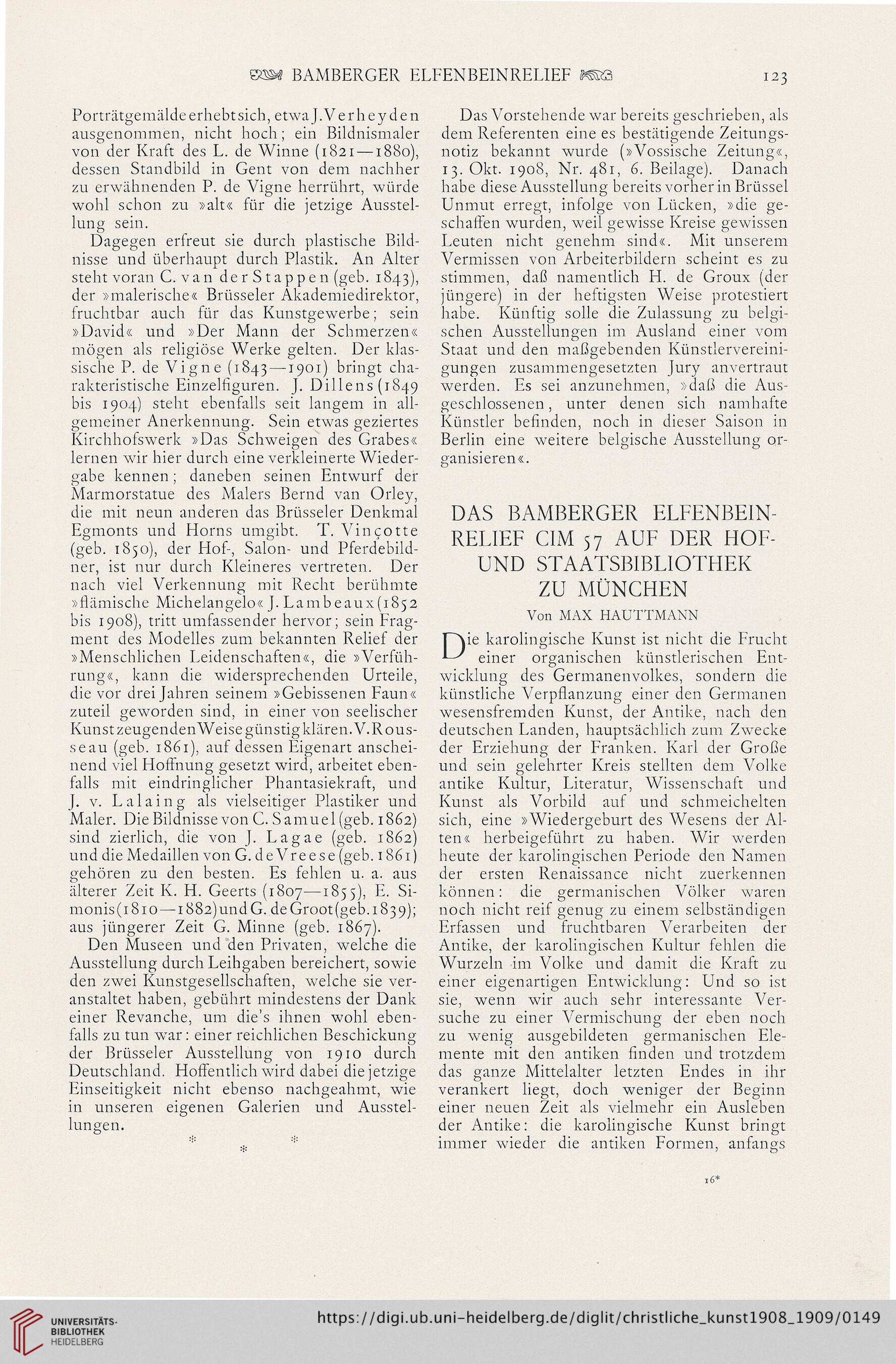»W? BAMBERGER ELFENBEINRELIEF
123
Porträtgemälde erhebt sich, etwa J.Ver hey den
ausgenommen, nicht hoch; ein Bildnismaler
von der Kraft des L. de Winne (1821 — 1880),
dessen Standbild in Gent von dem nachher
zu erwähnenden P. de Vigne herrührt, würde
wohl schon zu »alt« für die jetzige Ausstel-
lung sein.
Dagegen erfreut sie durch plastische Bild-
nisse und überhaupt durch Plastik. An Alter
steht voran C. van derStappen (geb. 1843),
der »malerische« Brüsseler Akademiedirektor,
fruchtbar auch für das Kunstgewerbe; sein
»David« und »Der Mann der Schmerzen«
mögen als religiöse Werke gelten. Der klas-
sische P. de Vigne (1843 —1901) bringt cha-
rakteristische Einzelfiguren. J. Dillens(r849
bis 1904) steht ebenfalls seit langem in all-
gemeiner Anerkennung. Sein etwas geziertes
Kirchhofswerk »Das Schweigen des Grabes«
lernen wir hier durch eine verkleinerte Wieder-
gabe kennen; daneben seinen Entwurf der
Marmorstatue des Malers Bernd van Orley,
die mit neun anderen das Brüsseler Denkmal
Egmonts und Horns umgibt. T. Vincotte
(geb. 1850), der Hof-, Salon- und Pferdebild-
ner, ist nur durch Kleineres vertreten. Der
nach viel Verkennung mit Recht berühmte
»flämische Michelangelo« J. Lambeaux(i852
bis 1908), tritt umfassender hervor; sein Frag-
ment des Modelles zum bekannten Relief der
»Menschlichen Leidenschaften«, die »Verfüh-
rung«, kann die widersprechenden Urteile,
die vor drei Jahren seinem »Gebissenen Faun«
zuteil geworden sind, in einer von seelischer
Kunst zeugenden Weise günstig klären. V. Rous-
seau (geb. 1861), auf dessen Eigenart anschei-
nend viel Hoffnung gesetzt wird, arbeitet eben-
falls mit eindringlicher Phantasiekraft, und
J. v. Lalaing als vielseitiger Plastiker und
Maler. Die Bildnisse von C. Samuel (geb. 1862)
sind zierlich, die von J. Lagae (geb. 1862)
und die Medaillen von G. de Vreese (geb. 1861)
gehören zu den besten. Es fehlen u. a. aus
älterer Zeit K. H. Geerts (1807—1855), E. Si-
monis (1810 —1882) undG.de Groot (geb. 1839);
aus jüngerer Zeit G. Minne (geb. 1867).
Den Museen und den Privaten, welche die
Ausstellung durch Leihgaben bereichert, sowie
den zwei Kunstgesellschaften, welche sie ver-
anstaltet haben, gebührt mindestens der Dank
einer Revanche, um die’s ihnen wohl eben-
falls zu tun war: einer reichlichen Beschickung
der Brüsseler Ausstellung von 1910 durch
Deutschland. Hoffentlich wird dabei die jetzige
Einseitigkeit nicht ebenso nachgeahmt, wie
in unseren eigenen Galerien und Ausstel-
lungen.
* *
*
Das Vorstehende war bereits geschrieben, als
dem Referenten eine es bestätigende Zeitungs-
notiz bekannt wurde (»Vossische Zeitung«,
13. Okt. 1908, Nr. 481, 6. Beilage). Danach
habe diese Ausstellung bereits vorher in Brüssel
Unmut erregt, infolge von Lücken, »die ge-
schaffen wurden, weil gewisse Kreise gewissen
Leuten nicht genehm sind«. Mit unserem
Vermissen von Arbeiterbildern scheint es zu
stimmen, daß namentlich H. de Groux (der
jüngere) in der heftigsten Weise protestiert
habe. Künftig solle die Zulassung zu belgi-
schen Ausstellungen im Ausland einer vom
Staat und den maßgebenden Künstlervereini-
gungen zusammengesetzten Jury anvertraut
werden. Es sei anzunehmen, »daß die Aus-
geschlossenen , unter denen sich namhafte
Künstler befinden, noch in dieser Saison in
Berlin eine weitere belgische Ausstellung or-
ganisieren«.
DAS BAMBERGER ELFENBEIN-
RELIEF CIM 57 AUF DER HOF-
UND STAATSBIBLIOTHEK
ZU MÜNCHEN
Von MAX HAUTTMANN
ie karolingische Kunst ist nicht die Frucht
einer organischen künstlerischen Ent-
wicklung des Germanenvolkes, sondern die
künstliche Verpflanzung einer den Germanen
wesensfremden Kunst, der Antike, nach den
deutschen Landen, hauptsächlich zum Zwecke
der Erziehung der Franken. Karl der Große
und sein gelehrter Kreis stellten dem Volke
antike Kultur, Literatur, Wissenschaft und
Kunst als Vorbild auf und schmeichelten
sich, eine »Wiedergeburt des Wesens der Al-
ten« herbeigeführt zu haben. Wir werden
heute der karolingischen Periode den Namen
der ersten Renaissance nicht zuerkennen
können: die germanischen Völker waren
noch nicht reif genug zu einem selbständigen
Erfassen und fruchtbaren Verarbeiten der
Antike, der karolingischen Kultur fehlen die
Wurzeln im Volke und damit die Kraft zu
einer eigenartigen Entwicklung: Und so ist
sie, wenn wir auch sehr interessante Ver-
suche zu einer Vermischung der eben noch
zu wenig ausgebildeten germanischen Ele-
mente mit den antiken finden und trotzdem
das ganze Mittelalter letzten Endes in ihr
verankert liegt, doch weniger der Beginn
einer neuen Zeit als vielmehr ein Ausleben
der Antike: die karolingische Kunst bringt
immer wieder die antiken Formen, anfangs
16*
123
Porträtgemälde erhebt sich, etwa J.Ver hey den
ausgenommen, nicht hoch; ein Bildnismaler
von der Kraft des L. de Winne (1821 — 1880),
dessen Standbild in Gent von dem nachher
zu erwähnenden P. de Vigne herrührt, würde
wohl schon zu »alt« für die jetzige Ausstel-
lung sein.
Dagegen erfreut sie durch plastische Bild-
nisse und überhaupt durch Plastik. An Alter
steht voran C. van derStappen (geb. 1843),
der »malerische« Brüsseler Akademiedirektor,
fruchtbar auch für das Kunstgewerbe; sein
»David« und »Der Mann der Schmerzen«
mögen als religiöse Werke gelten. Der klas-
sische P. de Vigne (1843 —1901) bringt cha-
rakteristische Einzelfiguren. J. Dillens(r849
bis 1904) steht ebenfalls seit langem in all-
gemeiner Anerkennung. Sein etwas geziertes
Kirchhofswerk »Das Schweigen des Grabes«
lernen wir hier durch eine verkleinerte Wieder-
gabe kennen; daneben seinen Entwurf der
Marmorstatue des Malers Bernd van Orley,
die mit neun anderen das Brüsseler Denkmal
Egmonts und Horns umgibt. T. Vincotte
(geb. 1850), der Hof-, Salon- und Pferdebild-
ner, ist nur durch Kleineres vertreten. Der
nach viel Verkennung mit Recht berühmte
»flämische Michelangelo« J. Lambeaux(i852
bis 1908), tritt umfassender hervor; sein Frag-
ment des Modelles zum bekannten Relief der
»Menschlichen Leidenschaften«, die »Verfüh-
rung«, kann die widersprechenden Urteile,
die vor drei Jahren seinem »Gebissenen Faun«
zuteil geworden sind, in einer von seelischer
Kunst zeugenden Weise günstig klären. V. Rous-
seau (geb. 1861), auf dessen Eigenart anschei-
nend viel Hoffnung gesetzt wird, arbeitet eben-
falls mit eindringlicher Phantasiekraft, und
J. v. Lalaing als vielseitiger Plastiker und
Maler. Die Bildnisse von C. Samuel (geb. 1862)
sind zierlich, die von J. Lagae (geb. 1862)
und die Medaillen von G. de Vreese (geb. 1861)
gehören zu den besten. Es fehlen u. a. aus
älterer Zeit K. H. Geerts (1807—1855), E. Si-
monis (1810 —1882) undG.de Groot (geb. 1839);
aus jüngerer Zeit G. Minne (geb. 1867).
Den Museen und den Privaten, welche die
Ausstellung durch Leihgaben bereichert, sowie
den zwei Kunstgesellschaften, welche sie ver-
anstaltet haben, gebührt mindestens der Dank
einer Revanche, um die’s ihnen wohl eben-
falls zu tun war: einer reichlichen Beschickung
der Brüsseler Ausstellung von 1910 durch
Deutschland. Hoffentlich wird dabei die jetzige
Einseitigkeit nicht ebenso nachgeahmt, wie
in unseren eigenen Galerien und Ausstel-
lungen.
* *
*
Das Vorstehende war bereits geschrieben, als
dem Referenten eine es bestätigende Zeitungs-
notiz bekannt wurde (»Vossische Zeitung«,
13. Okt. 1908, Nr. 481, 6. Beilage). Danach
habe diese Ausstellung bereits vorher in Brüssel
Unmut erregt, infolge von Lücken, »die ge-
schaffen wurden, weil gewisse Kreise gewissen
Leuten nicht genehm sind«. Mit unserem
Vermissen von Arbeiterbildern scheint es zu
stimmen, daß namentlich H. de Groux (der
jüngere) in der heftigsten Weise protestiert
habe. Künftig solle die Zulassung zu belgi-
schen Ausstellungen im Ausland einer vom
Staat und den maßgebenden Künstlervereini-
gungen zusammengesetzten Jury anvertraut
werden. Es sei anzunehmen, »daß die Aus-
geschlossenen , unter denen sich namhafte
Künstler befinden, noch in dieser Saison in
Berlin eine weitere belgische Ausstellung or-
ganisieren«.
DAS BAMBERGER ELFENBEIN-
RELIEF CIM 57 AUF DER HOF-
UND STAATSBIBLIOTHEK
ZU MÜNCHEN
Von MAX HAUTTMANN
ie karolingische Kunst ist nicht die Frucht
einer organischen künstlerischen Ent-
wicklung des Germanenvolkes, sondern die
künstliche Verpflanzung einer den Germanen
wesensfremden Kunst, der Antike, nach den
deutschen Landen, hauptsächlich zum Zwecke
der Erziehung der Franken. Karl der Große
und sein gelehrter Kreis stellten dem Volke
antike Kultur, Literatur, Wissenschaft und
Kunst als Vorbild auf und schmeichelten
sich, eine »Wiedergeburt des Wesens der Al-
ten« herbeigeführt zu haben. Wir werden
heute der karolingischen Periode den Namen
der ersten Renaissance nicht zuerkennen
können: die germanischen Völker waren
noch nicht reif genug zu einem selbständigen
Erfassen und fruchtbaren Verarbeiten der
Antike, der karolingischen Kultur fehlen die
Wurzeln im Volke und damit die Kraft zu
einer eigenartigen Entwicklung: Und so ist
sie, wenn wir auch sehr interessante Ver-
suche zu einer Vermischung der eben noch
zu wenig ausgebildeten germanischen Ele-
mente mit den antiken finden und trotzdem
das ganze Mittelalter letzten Endes in ihr
verankert liegt, doch weniger der Beginn
einer neuen Zeit als vielmehr ein Ausleben
der Antike: die karolingische Kunst bringt
immer wieder die antiken Formen, anfangs
16*