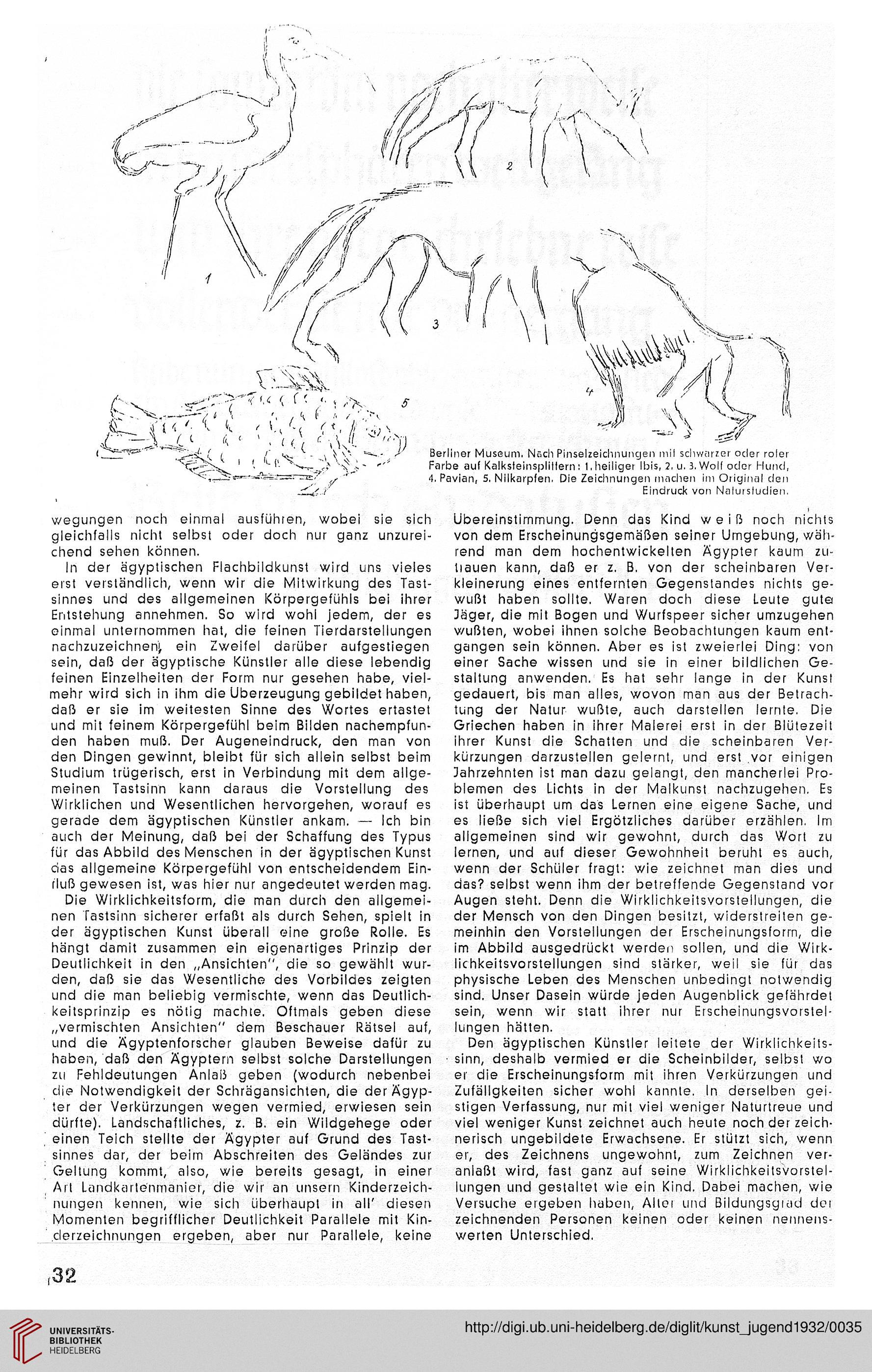t
V .
£ i 1 < ' \ (I,
(i (i,
^r< '•< < f • ;• , /X
/ i \ ', / \ l1 A / '.
'■ < K /».,'•« '«,*
1 ‘ 4 < ( c \\ V-
Berliner Museum. Nach Pinselzeichnuncjen mil schwarzer oder roler
Farbe auf Kalksteinsplitlern: I, heiliger Ibis, 2. u. 3. Wolf oder Hund,
4. Pavian, 5. Nilkarpfen. Die Zeichnungen machen im Original den
Eindruck von Nalursludien.
wegungen noch einmal ausführen, wobei sie sich
gleichfalls nicht selbst oder doch nur ganz unzurei-
chend sehen können.
In der ägyptischen Flachbildkunst wird uns vieles
erst verständlich, wenn wir die Mitwirkung des Tast-
sinnes und des allgemeinen Körpergefühls bei ihrer
Entstehung annehmen. So wird wohl Jedem, der es
einmal unternommen hat, die feinen Tierdarstellungen
nachzuzeichnen! ein Zweifel darüber aufgestiegen
sein, daß der ägyptische Künstler alle diese lebendig
feinen Einzelheiten der Form nur gesehen habe, viel-
mehr wird sich in ihm die Überzeugung gebildet haben,
daß er sie im weitesten Sinne des Wortes ertastet
und mit feinem Körpergefühl beim Bilden nachempfun-
den haben muß. Der Augeneindruck, den man von
den Dingen gewinnt, bleibt für sich allein selbst beim
Studium trügerisch, erst in Verbindung mit dem allge-
meinen Tastsinn kann daraus die Vorstellung des
Wirklichen und Wesentlichen hervorgehen, worauf es
gerade dem ägyptischen Künstler ankam. — Ich bin
auch der Meinung, daß bei der Schaffung des Typus
für das Abbild des Menschen in der ägyptischen Kunst
das allgemeine Körpergefühl von entscheidendem Ein-
fluß gewesen ist, was hier nur angedeutet werden mag.
Die Wirklichkeitsform, die man durch den allgemei-
nen Tastsinn sicherer erfaßt als durch Sehen, spielt in
der ägyptischen Kunst überall eine große Rolle. Es
hängt damit zusammen ein eigenartiges Prinzip der
Deutlichkeit in den „Ansichten", die so gewählt wur-
den, daß sie das Wesentliche des Vorbildes zeigten
und die man beliebig vermischte, wenn das Deutlich-
keitsprinzip es nötig machte. Oftmals geben diese
„vermischten Ansichten" dem Beschauer Rätsel auf,
und die Ägyptenforscher glauben Beweise dafür zu
haben, daß den Ägyptern selbst solche Darstellungen
zu Fehldeutungen Anlaß geben (wodurch nebenbei
die Notwendigkeit der Schrägansichten, die der Ägyp-
ter der Verkürzungen wegen vermied, erwiesen sein
dürfte). Landschaftliches, z. B. ein Wildgehege oder
einen Teich stellte der Ägypter auf Grund des Tast-
sinnes dar, der beim Abschreiten des Geländes zur
Geltung kommt, also, wie bereits gesagt, in einer
Art Landkartenmanier, die wir an unsern Kinderzeich-
nungen kennen, wie sich überhaupt in all' diesen
Momenten begrifflicher Deutlichkeit Parallele mit Kin-
derzeichnungen ergeben, aber nur Parallele, keine
Übereinstimmung. Denn das Kind weiß noch nichts
von dem Erscheinungsgemäßen seiner Umgebung, wäh-
rend man dem hochentwickelten Ägypter kaum zu-
tiauen kann, daß er z. B. von der scheinbaren Ver-
kleinerung eines entfernten Gegenstandes nichts ge-
wußt haben sollte. Waren doch diese Leute gute
Jäger, die mit Bogen und Wurfspeer sicher umzugehen
wußten, wobei ihnen solche Beobachtungen kaum ent-
gangen sein können. Aber es ist zweierlei Ding: von
einer Sache wissen und sie in einer bildlichen Ge-
staltung anwenden. Es hat sehr lange In der Kunst
gedauert, bis man alles, wovon man aus der Betrach-
tung der Natur wußte, auch darstellen lernte. Die
Griechen haben in ihrer Malerei erst in der Blütezeit
ihrer Kunst die Schatten und die scheinbaren Ver-
kürzungen darzusteilen gelernt, und erst vor einigen
Jahrzehnten ist man dazu gelangt, den mancherlei Pro-
blemen des Lichts in der Malkunst nachzugehen. Es
ist überhaupt um das Lernen eine eigene Sache, und
es ließe sich viel Ergötzliches darüber erzählen. Im
allgemeinen sind wir gewohnt, durch das Wort zu
lernen, und auf dieser Gewohnheit beruht es auch,
wenn der Schüler fragt: wie zeichnet man dies und
das? selbst wenn ihm der betreffende Gegenstand vor
Augen steht. Denn die Wirklichkeitsvorstellungen, die
der Mensch von den Dingen besitzt, widerstreiten ge-
meinhin den Vorstellungen der Erscheinungsform, die
im Abbild ausgedrückt werden sollen, und die Wirk-
lichkeitsvorstellungen sind stärker, weil sie für das
physische Leben des Menschen unbedingt notwendig
sind. Unser Dasein würde jeden Augenblick gefährdet
sein, wenn wir statt ihrer nur Erscheinungsvorstel-
lungen hätten.
Den ägyptischen Künstler leitete der Wirklichkeits-
sinn, deshalb vermied er die Scheinbilder, selbst wo
er die Erscheinungsform mit ihren Verkürzungen und
Zufällgkeiten sicher wohl kannte. In derselben gei-
stigen Verfassung, nur mit viel weniger Naturtreue und
viel weniger Kunst zeichnet auch heute noch der zeich-
nerisch ungebildete Erwachsene. Er stützt sich, wenn
er, des Zeichnens ungewohnt, zum Zeichnen ver-
anlaßt wird, fast ganz auf seine Wirklichkeitsvorstel-
lungen und gestaltet wie ein Kind. Dabei machen, wie
Versuche ergeben haben, Alloi und Bildungsgiad dei
zeichnenden Personen keinen oder keinen nennens-
werten Unterschied.
,32