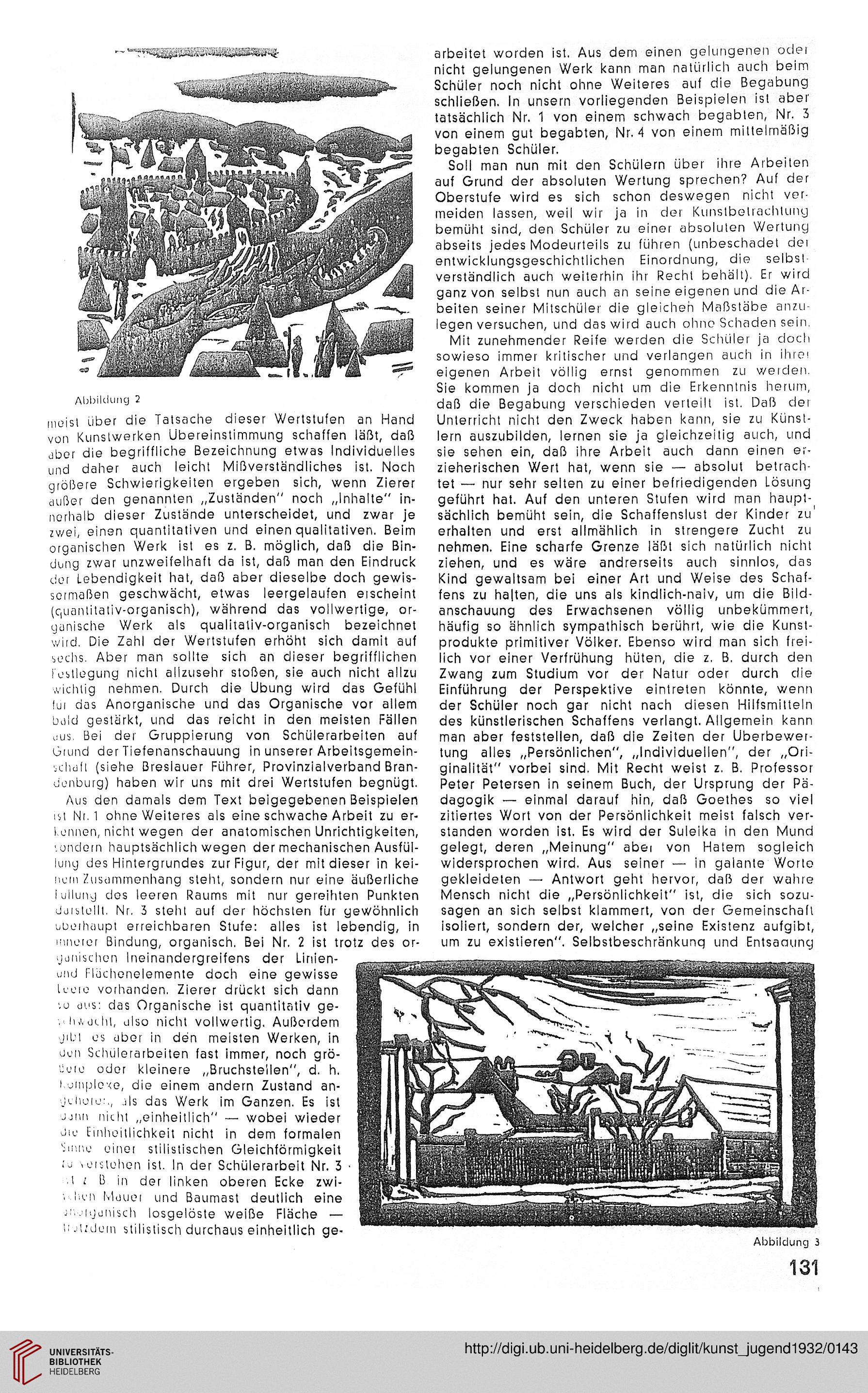Abbildung 2
muist über die Tatsache dieser Wertstufen an Hand
von Kunstwerken Übereinstimmung schaffen läßt, daß
über die begriffliche Bezeichnung etwas Individuelles
und daher auch leicht Mißverständliches ist. Noch
größere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn Zierer
außer den genannten „Zuständen" noch „Inhalte" in-
nerhalb dieser Zustände unterscheidet, und zwar je
zv/ei, einen quantitativen und einen qualitativen. Beim
organischen Werk ist es z. B. möglich, daß die Bin-
dung zwar unzweifelhaft da ist, daß man den Eindruck
der Lebendigkeit hat, daß aber dieselbe doch gewis-
sermaßen geschwächt, etwas leergelaufen eischeint
(quantitativ-organisch), während das vollwertige, or-
ganische Werk als qualitativ-organisch bezeichnet
wird. Die Zahl der Wertstufen erhöht sich damit auf
sechs. Aber man sollte sich an dieser begrifflichen
Festlegung nicht allzusehr stoßen, sie auch nicht allzu
wichtig nehmen. Durch die Übung wird das Gefühl
lur das Anorganische und das Organische vor allem
bald gestärkt, und das reicht in den meisten Fällen
aus. Bei der Gruppierung von Schülerarbeiten auf
Giund der Tiefenanschauung in unserer Arbeitsgemein-
schaft (siehe Breslauer Führer, Provinzialverband Bran-
denburg) haben wir uns mit drei Wertstufen begnügt.
Aus den damals dem Text beigegebenen Beispielen
ist Nr. 1 ohne Weiteres als eine schwache Arbeit zu er-
kennen, nicht wegen der anatomischen Unrichtigkeiten,
sondern hauptsächlich wegen der mechanischen Ausfül-
lung des Hintergrundes zur Figur, der mit dieser in kei-
nem Zusammenhang steht, sondern nur eine äußerliche
iullung des leeren Raums mit nur gereihten Punkten
daistellt. Nr. 3 steht auf der höchsten für gewöhnlich
überhaupt erreichbaren Stufe: alles ist lebendig, in
innerer Bindung, organisch. Bei Nr. 2 ist trotz des or-
ganischon Ineinandergreifens der Linien-
und Flachenelemente doch eine gewisse
leere vorhanden. Zierer drückt sich dann
so aus: das Organische ist quantitativ ge-
■ ' hwacht, also nicht vollwertig, Außerdem
gibt es aber in den meisten Werken, in
uen Schülerarbeiten fast immer, noch grö-
ßere oder kleinere „Bruchsteilen", d. h.
komplexe, die einem andern Zustand an-
gvholen, als das Werk im Ganzen. Es ist
ooim nicht „einheitlich" — wobei wieder
die Einheitlichkeit nicht in dem formalen
Same einer stilistischen Gleichförmigkeit
re Noistohon ist. In der Schülerarbeit Nr. 3 •
t i ß in der linken oberen Ecke zwi-
■. Iren Mauer und Baumast deutlich eine
jnoiganisch losgelöste weiße Fläche —
w jUdom stilistisch durchaus einheitlich ge-
arbeitet worden ist. Aus dem einen gelungenen odei
nicht gelungenen Werk kann man natürlich auch beim
Schüler noch nicht ohne Weiteres auf die Begabung
schließen. In unsern vorliegenden Beispielen ist aber
tatsächlich Nr. 1 von einem schwach begabten, Nr. 3
von einem gut begabten, Nr. 4 von einem mittelmäßig
begabten Schüler.
Soll man nun mit den Schülern über ihre Arbeiten
auf Grund der absoluten Wertung sprechen? Auf der
Oberstufe wird es sich schon deswegen nicht ver-
meiden lassen, weil wir ja in der Kunstbetrachtung
bemüht sind, den Schüler zu einer absoluten Wertung
abseits jedes Modeurteils zu führen (unbeschadet der
entwicklungsgeschichtlichen Einordnung, die selbst
verständlich auch weiterhin ihr Recht behält). Er wird
ganz von selbst nun auch an seine eigenen und die Ar-
beiten seiner Mitschüler die gleichen Maßstäbe anzu-
legen versuchen, und das wird auch ohne Schaden sein.
Mit zunehmender Reife werden die Schüler ja doch
sowieso immer kritischer und verlangen auch in ihrer
eigenen Arbeit völlig ernst genommen zu werden.
Sie kommen ja doch nicht um die Erkenntnis herum,
daß die Begabung verschieden verteilt ist. Daß der
Unterricht nicht den Zweck haben kann, sie zu Künst-
lern auszubilden, lernen sie ja gleichzeitig auch, und
sie sehen ein, daß ihre Arbeit auch dann einen er-
zieherischen Wert hat, wenn sie — absolut betrach-
tet — nur sehr selten zu einer befriedigenden Lösung
geführt hat. Auf den unteren Stufen wird man haupt-
sächlich bemüht sein, die Schaffenslust der Kinder zu'
erhalten und erst allmählich in strengere Zucht zu
nehmen. Eine scharfe Grenze läßt sich natürlich nicht
ziehen, und es wäre andrerseits auch sinnlos, das
Kind gewaltsam bei einer Art und Weise des Schaf-
fens zu halten, die uns als kindlich-naiv, um die Bild-
anschauung des Erwachsenen völlig unbekümmert,
häufig so ähnlich sympathisch berührt, wie die Kunst-
produkte primitiver Völker. Ebenso wird man sich frei-
lich vor einer Verfrühung hüten, die z. B. durch den
Zwang zum Studium vor der Natur oder durch die
Einführung der Perspektive eintreten könnte, wenn
der Schüler noch gar nicht nach diesen Hilfsmitteln
des künstlerischen Schaffens verlangt. Allgemein kann
man aber feststellen, daß die Zeiten der Überbewer-
tung alles „Persönlichen", „Individuellen", der „Ori-
ginalität" vorbei sind. Mit Recht weist z. B. Professor
Peter Petersen in seinem Buch, der Ursprung der Pä-
dagogik — einmal darauf hin, daß Goethes so viel
zitiertes Wort von der Persönlichkeit meist falsch ver-
standen worden ist. Es wird der Suleika in den Mund
gelegt, deren „Meinung" abei von Hatem sogleich
widersprochen wird. Aus seiner — in galante Worte
gekleideten — Antwort geht hervor, daß der wahre
Mensch nicht die „Persönlichkeit" ist, die sich sozu-
sagen an sich selbst klammert, von der Gemeinschaft
isoliert, sondern der, welcher „seine Existenz aufgibt,
um zu existieren". Selbstbeschränkunq und Entsaaung
Abbildung 3