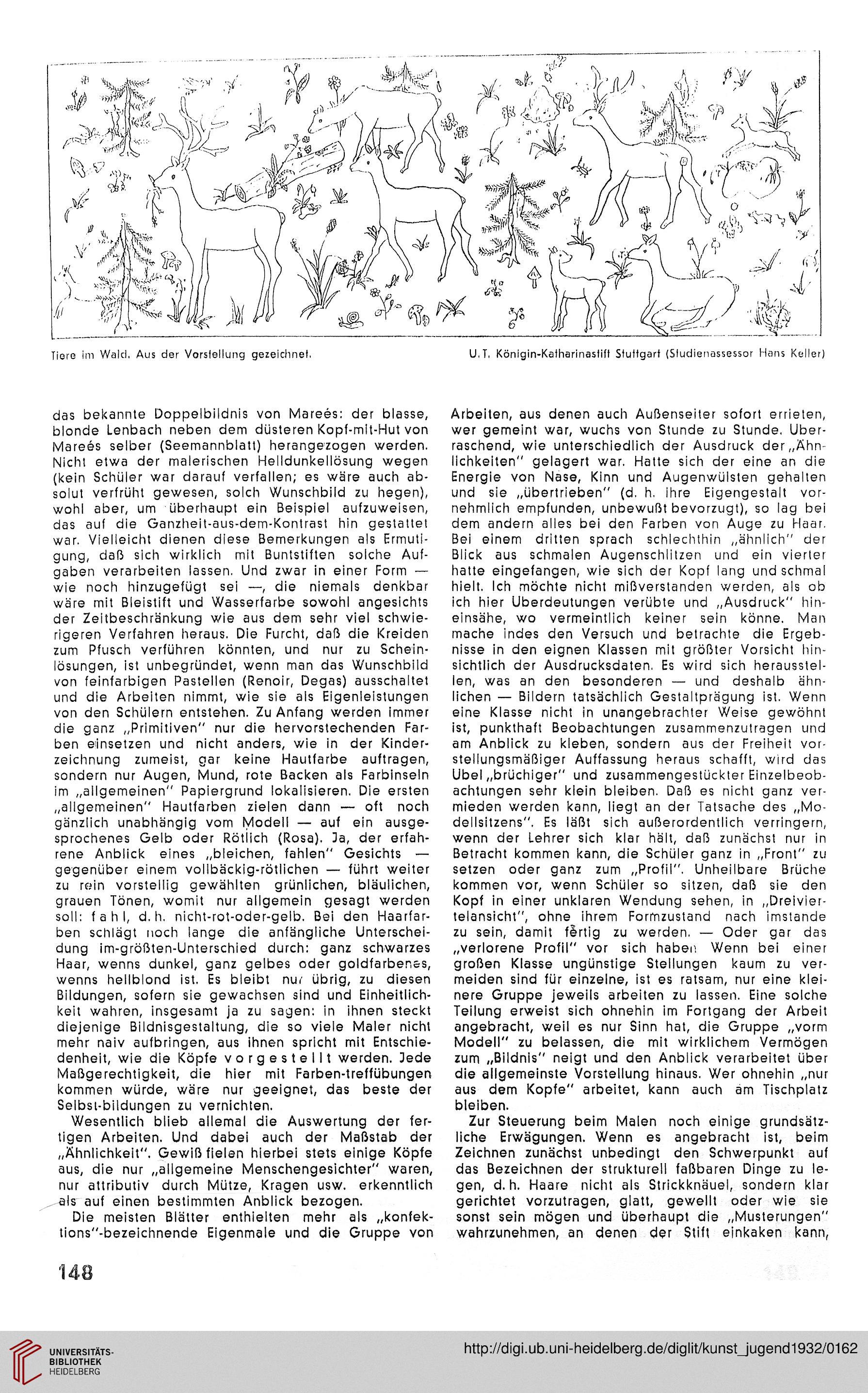das bekannte Doppelbildnis von Marees: der blasse,
blonde Lenbach neben dem düsteren Kopf-mit-Hut von
Marees selber (Seemannblatt) herangezogen werden.
Nicht etwa der malerischen Helldunkellösung wegen
(kein Schüler war darauf verfallen; es wäre auch ab-
solut verfrüht gewesen, solch Wunschbild zu hegen),
wohl aber, um überhaupt ein Beispiel aufzuweisen,
das auf die Ganzheit-aus-dem-Kontrast hin gestattet
war. Vielleicht dienen diese Bemerkungen als Ermuti-
gung, daß sich wirklich mit Buntstiften solche Auf-
gaben verarbeiten lassen. Und zwar in einer Form —
wie noch hinzugefügt sei —, die niemals denkbar
wäre mit Bleistift und Wasserfarbe sowohl angesichts
der Zeitbeschränkung wie aus dem sehr viel schwie-
rigeren Verfahren heraus. Die Furcht, daß die Kreiden
zum Pfusch verführen könnten, und nur zu Schein-
lösungen, ist unbegründet, wenn man das Wunschbild
von feinfarbigen Pastellen (Renoir, Degas) ausschaltet
und die Arbeiten nimmt, wie sie als Eigenleistungen
von den Schülern entstehen. Zu Anfang werden immer
die ganz „Primitiven'' nur die hervorstechenden Far-
ben efnsetzen und nicht anders, wie in der Kinder-
zeichnung zumeist, gar keine Hautfarbe auftragen,
sondern nur Augen, Mund, rote Backen als Farbinseln
im „allgemeinen" Papiergrund lokalisieren. Die ersten
„allgemeinen" Hautfarben zielen dann — oft noch
gänzlich unabhängig vom Modell — auf ein ausge-
sprochenes Gelb oder Rötiich (Rosa). 3a, der erfah-
rene Anblick eines „bleichen, fahlen" Gesichts —
gegenüber einem vollbäckig-rötlichen — führt weiter
zu rein vorstellig gewählten grünlichen, bläulichen,
grauen Tönen, womit nur allgemein gesagt werden
soll: fahl, d. h. nicht-rot-oder-gelb. Bei den Haarfar-
ben schlägt noch lange die anfängliche Unterschei-
dung im-größten-Unterschied durch: ganz schwarzes
Haar, wenns dunkel, ganz gelbes oder goldfarbenes,
wenns hellblond ist. Es bleibt nur übrig, zu diesen
Bildungen, sofern sie gewachsen sind und Einheitlich-
keit wahren, insgesamt ja zu sagen: in ihnen steckt
diejenige Bildnisgestaltung, die so viele Maler nicht
mehr naiv aufbringen, aus ihnen spricht mit Entschie-
denheit, wie die Köpfe v o r g e s t e 111 werden. 3ede
Maßgerechtigkeit, die hier mit Farben-treffübungen
kommen würde, wäre nur geeignet, das beste der
Selbst-bildungen zu vernichten.
Wesentlich blieb allemal die Auswertung der fer-
tigen Arbeiten. Und dabei auch der Maßstab der
„Ähnlichkeit". Gewiß fielen hierbei stets einige Köpfe
aus, die nur „allgemeine Menschengesichter" waren,
nur attributiv durch Mütze, Kragen usw. erkenntlich
„eis auf einen bestimmten Anblick bezogen.
Die meisten Blätter enthielten mehr als „konfek-
tions"-bezeichnende Eigenmale und die Gruppe von
Arbeiten, aus denen auch Außenseiter sofort errieten,
wer gemeint war, wuchs von Stunde zu Stunde. Über-
raschend, wie unterschiedlich der Ausdruck der „Ähn-
lichkeiten" gelagert war. Hatte sich der eine an die
Energie von Nase, Kinn und Augenwülsten gehalten
und sie „übertrieben" (d. h. ihre Eigengestalt vor-
nehmlich empfunden, unbewußt bevorzugt), so lag bei
dem andern alles bei den Farben von Auge zu Haar.
Bei einem dritten sprach schlechthin „ähnlich” der
Blick aus schmalen Augenschlitzen und ein vierter
hatte eingefangen, wie sich der Kopf lang und schmal
hielt. Ich möchte nicht mißverstanden werden, als ob
ich hier Uberdeutungen verübte und „Ausdruck" hin-
einsähe, wo vermeintlich keiner sein könne. Man
mache Indes den Versuch und betrachte die Ergeb-
nisse in den eignen Klassen mit größter Vorsicht hin-
sichtlich der Ausdrucksdaten. Es wird sich herausstei-
len, was an den besonderen — und deshalb ähn-
lichen — Bildern tatsächlich Gestaltprägung ist. Wenn
eine Klasse nicht in unangebrachter Weise gewöhnt
ist, punkthaft Beobachtungen zusammenzutragen und
am Anblick zu kleben, sondern aus der Freiheit vor-
stellungsmäßiger Auffassung heraus schafft, wird das
Übel „brüchiger" und zusammengestückter Einzelbeob-
achtungen sehr klein bleiben. Daß es nicht ganz ver-
mieden werden kann, liegt an der Tatsache des „Mo-
dellsitzens". Es läßt sich außerordentlich verringern,
wenn der Lehrer sich klar hält, daß zunächst nur in
Betracht kommen kann, die Schüler ganz in „Front" zu
setzen oder ganz zum „Profil". Unheilbare Brüche
kommen vor, wenn Schüler so sitzen, daß sie den
Kopf in einer unklaren Wendung sehen, in „Dreivier-
telansicht", ohne ihrem Formzustand nach imstande
zu sein, damit firtig zu werden. — Oder gar das
„verlorene Profil" vor sich haben. Wenn bei einer
großen Klasse ungünstige Stellungen kaum zu ver-
meiden sind für einzelne, ist es ratsam, nur eine klei-
nere Gruppe jeweils arbeiten zu lassen. Eine solche
Teilung erweist sich ohnehin im Fortgang der Arbeit
angebracht, weil es nur Sinn hat, die Gruppe „vorm
Modell" zu belassen, die mit wirklichem Vermögen
zum „Bildnis" neigt und den Anblick verarbeitet über
die allgemeinste Vorstellung hinaus. Wer ohnehin „nur
aus dem Kopfe" arbeitet, kann auch am Tischplatz
bleiben.
Zur Steuerung beim Malen noch einige grundsätz-
liche Erwägungen. Wenn es angebracht ist, beim
Zeichnen zunächst unbedingt den Schwerpunkt auf
das Bezeichnen der strukturell faßbaren Dinge zu le-
gen, d. h. Haare nicht als Strickknäuel, sondern klar
gerichtet vorzutragen, glatt, gewellt oder wie sie
sonst sein mögen und überhaupt die „Musterungen"
wahrzunehmen, an denen der Stift einkaken kann,
148