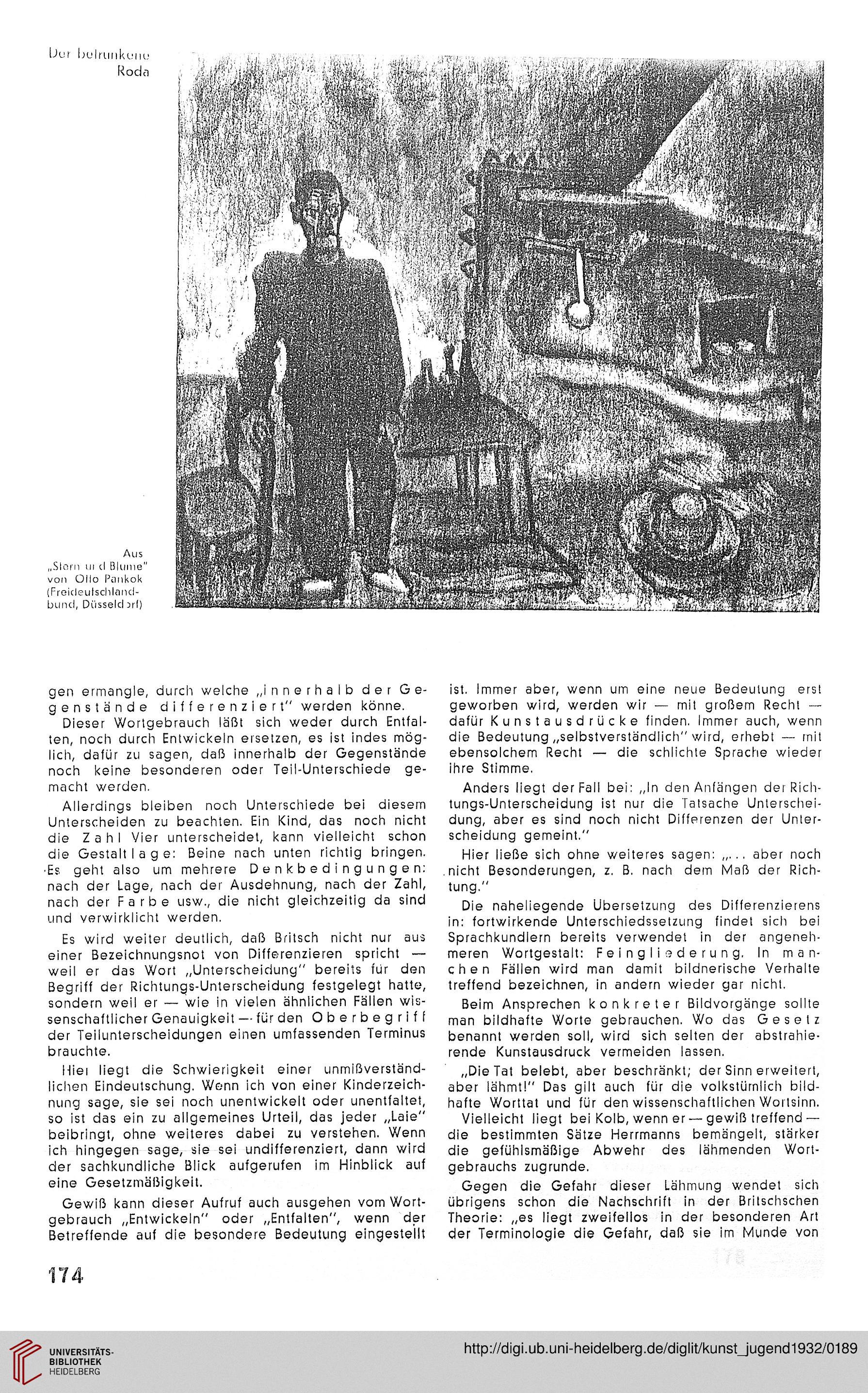Uur bulmnkuiK*
Roda
Aus
„Storn ui cl Blume"
von Ollo Pankok
(Freicleufschland-
bund, Düsseid Drf)
gen ermangle, durch welche „innerhalb der Ge-
genstände differenziert“ werden könne.
Dieser Wortgebrauch laßt sich weder durch Entfal-
ten, noch durch Entwickeln ersetzen, es ist indes mög-
lich, dafür zu sagen, daß innerhalb der Gegenstände
noch keine besonderen oder Teil-Unterschiede ge-
macht werden.
Allerdings bleiben noch Unterschiede bei diesem
Unterscheiden zu beachten. Ein Kind, das noch nicht
die Zahl Vier unterscheidet, kann vielleicht schon
die Gestalt läge: Beine nach unten richtig bringen.
•Es geht also um mehrere Denkbedingungen:
nach der Lage, nach der Ausdehnung, nach der Zahl,
nach der Farbe usw., die nicht gleichzeitig da sind
und verwirklicht werden.
Es wird weiter deutlich, daß Britsch nicht nur aus
einer Bezeichnungsnot von Differenzieren spricht —
weil er das Wort „Unterscheidung" bereits für den
Begriff der Richtungs-Unterscheidung festgelegt hatte,
sondern weil er — wie in vielen ähnlichen Fällen wis-
senschaftlicher Genauigkeit —• für den Oberbegriff
der Teilunterscheidungen einen umfassenden Terminus
brauchte.
Hiet liegt die Schwierigkeit einer unmißverständ-
lichen Eindeutschung. Wenn ich von einer Kinderzeich-
nung sage, sie sei noch unentwickelt oder unentfaltet,
so ist das ein zu allgemeines Urteil, das jeder „Laie"
beibringt, ohne weiteres dabei zu verstehen. Wenn
ich hingegen sage, sie sei undifferenziert, dann wird
der sachkundliche Blick aufgerufen im Hinblick auf
eine Gesetzmäßigkeit.
Gewiß kann dieser Aufruf auch ausgehen vom Wort-
gebrauch „Entwickeln" oder „Entfalten", wenn der
Betreffende auf die besondere Bedeutung eingestellt
ist. Immer aber, wenn um eine neue Bedeutung erst
geworben wird, werden wir — mit großem Recht —
dafür Kunstausdrücke finden. Immer auch, wenn
die Bedeutung „selbstverständlich" wird, erhebt — mit
ebensolchem Recht — die schlichte Sprache wieder
ihre Stimme.
Anders liegt der Fall bei: „In den Anfängen der Rich-
tungs-Unterscheidung ist nur die Tatsache Unterschei-
dung, aber es sind noch nicht Differenzen der Unter-
scheidung gemeint."
Hier ließe sich ohne weiteres sagen: „... aber noch
nicht Besonderungen, z. B. nach dem Maß der Rich-
tung."
Die naheliegende Übersetzung des Differenzierens
in: fortwirkende Unterschiedssetzung findet sich bei
Sprachkundlern bereits verwendet in der angeneh-
meren Wortgestalt: Feingliederung. In man-
chen Fällen wird man damit bildnerische Verhalte
treffend bezeichnen, in andern wieder gar nicht.
Beim Ansprechen konkreter Bildvorgänge sollte
man bildhafte Worte gebrauchen. Wo das Gesetz
benannt werden soll, wird sich selten der abstrahie-
rende Kunstausdruck vermeiden lassen.
„Die Tat belebt, aber beschränkt; der Sinn erweitert,
aber lähmt!" Das gilt auch für die volkstümlich bild-
hafte Worttat und für den wissenschaftlichen Wortsinn.
Vielleicht liegt bei Kolb, wenn er — gewiß treffend —-
die bestimmten Sätze Herrmanns bemängelt, stärker
die gefühlsmäßige Abwehr des lähmenden Wort-
gebrauchs zugrunde.
Gegen die Gefahr dieser Lähmung wendet sich
übrigens schon die Nachschrift in der Britschschen
Theorie: „es liegt zweifellos in der besonderen Art
der Terminologie die Gefahr, daß sie im Munde von
174
Roda
Aus
„Storn ui cl Blume"
von Ollo Pankok
(Freicleufschland-
bund, Düsseid Drf)
gen ermangle, durch welche „innerhalb der Ge-
genstände differenziert“ werden könne.
Dieser Wortgebrauch laßt sich weder durch Entfal-
ten, noch durch Entwickeln ersetzen, es ist indes mög-
lich, dafür zu sagen, daß innerhalb der Gegenstände
noch keine besonderen oder Teil-Unterschiede ge-
macht werden.
Allerdings bleiben noch Unterschiede bei diesem
Unterscheiden zu beachten. Ein Kind, das noch nicht
die Zahl Vier unterscheidet, kann vielleicht schon
die Gestalt läge: Beine nach unten richtig bringen.
•Es geht also um mehrere Denkbedingungen:
nach der Lage, nach der Ausdehnung, nach der Zahl,
nach der Farbe usw., die nicht gleichzeitig da sind
und verwirklicht werden.
Es wird weiter deutlich, daß Britsch nicht nur aus
einer Bezeichnungsnot von Differenzieren spricht —
weil er das Wort „Unterscheidung" bereits für den
Begriff der Richtungs-Unterscheidung festgelegt hatte,
sondern weil er — wie in vielen ähnlichen Fällen wis-
senschaftlicher Genauigkeit —• für den Oberbegriff
der Teilunterscheidungen einen umfassenden Terminus
brauchte.
Hiet liegt die Schwierigkeit einer unmißverständ-
lichen Eindeutschung. Wenn ich von einer Kinderzeich-
nung sage, sie sei noch unentwickelt oder unentfaltet,
so ist das ein zu allgemeines Urteil, das jeder „Laie"
beibringt, ohne weiteres dabei zu verstehen. Wenn
ich hingegen sage, sie sei undifferenziert, dann wird
der sachkundliche Blick aufgerufen im Hinblick auf
eine Gesetzmäßigkeit.
Gewiß kann dieser Aufruf auch ausgehen vom Wort-
gebrauch „Entwickeln" oder „Entfalten", wenn der
Betreffende auf die besondere Bedeutung eingestellt
ist. Immer aber, wenn um eine neue Bedeutung erst
geworben wird, werden wir — mit großem Recht —
dafür Kunstausdrücke finden. Immer auch, wenn
die Bedeutung „selbstverständlich" wird, erhebt — mit
ebensolchem Recht — die schlichte Sprache wieder
ihre Stimme.
Anders liegt der Fall bei: „In den Anfängen der Rich-
tungs-Unterscheidung ist nur die Tatsache Unterschei-
dung, aber es sind noch nicht Differenzen der Unter-
scheidung gemeint."
Hier ließe sich ohne weiteres sagen: „... aber noch
nicht Besonderungen, z. B. nach dem Maß der Rich-
tung."
Die naheliegende Übersetzung des Differenzierens
in: fortwirkende Unterschiedssetzung findet sich bei
Sprachkundlern bereits verwendet in der angeneh-
meren Wortgestalt: Feingliederung. In man-
chen Fällen wird man damit bildnerische Verhalte
treffend bezeichnen, in andern wieder gar nicht.
Beim Ansprechen konkreter Bildvorgänge sollte
man bildhafte Worte gebrauchen. Wo das Gesetz
benannt werden soll, wird sich selten der abstrahie-
rende Kunstausdruck vermeiden lassen.
„Die Tat belebt, aber beschränkt; der Sinn erweitert,
aber lähmt!" Das gilt auch für die volkstümlich bild-
hafte Worttat und für den wissenschaftlichen Wortsinn.
Vielleicht liegt bei Kolb, wenn er — gewiß treffend —-
die bestimmten Sätze Herrmanns bemängelt, stärker
die gefühlsmäßige Abwehr des lähmenden Wort-
gebrauchs zugrunde.
Gegen die Gefahr dieser Lähmung wendet sich
übrigens schon die Nachschrift in der Britschschen
Theorie: „es liegt zweifellos in der besonderen Art
der Terminologie die Gefahr, daß sie im Munde von
174