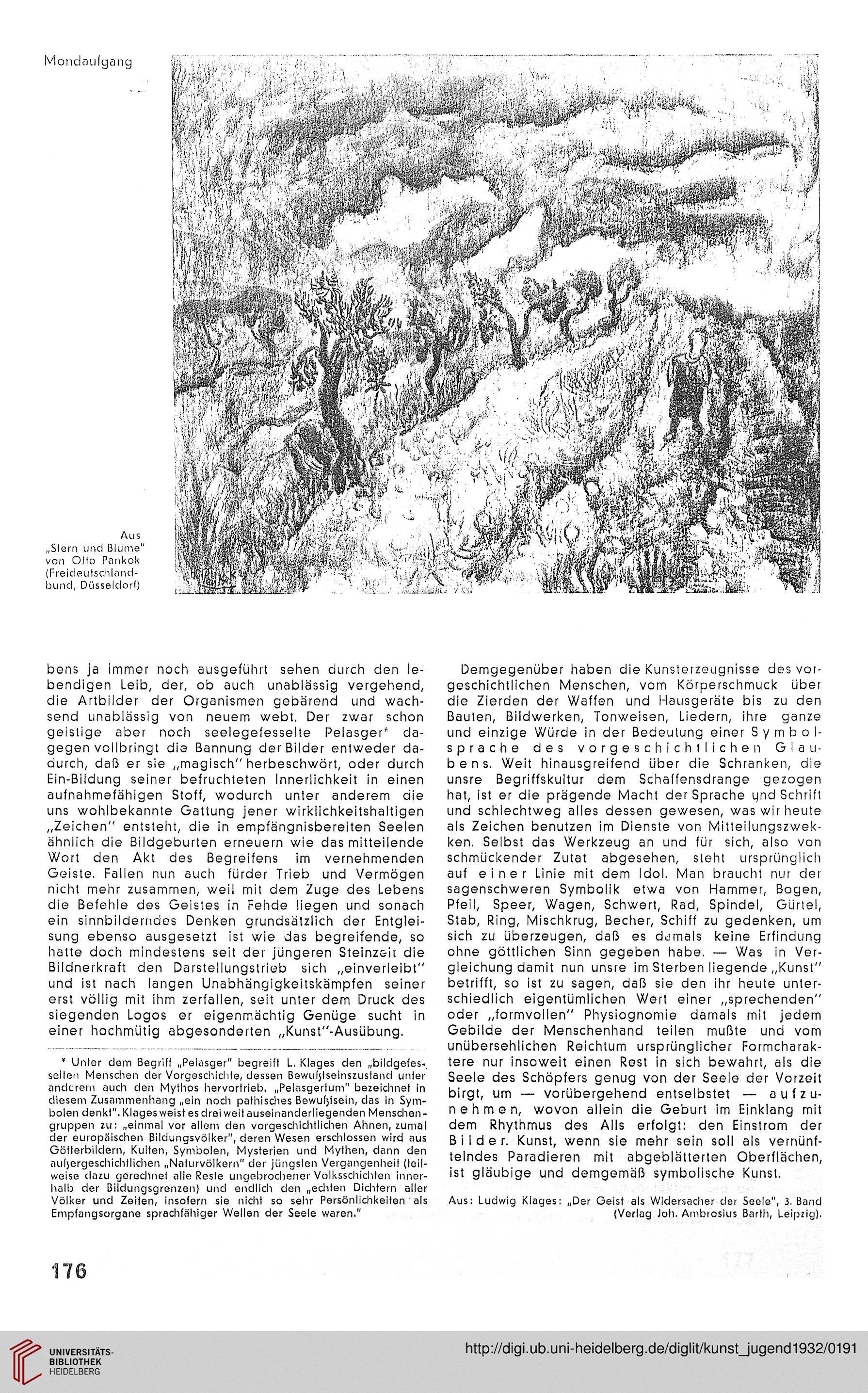Mondaulgang
Aus
„Stern und Blume'
von Otto Pankok
(Freideulschland-
bund, Düsseldorf)
bens ja immer noch ausgeführt sehen durch den le-
bendigen Leib, der, ob auch unablässig vergehend,
die Artbilder der Organismen gebärend und wach-
send unablässig von neuem webt. Der zwar schon
geistige aber noch seelegefesselte Pelasger* da-
gegen vollbringt die Bannung der Bilder entweder da-
durch, daß er sie „magisch" herbeschwört, oder durch
Ein-Bildung seiner befruchteten Innerlichkeit in einen
aufnahmefähigen Stoff, wodurch unter anderem die
uns wohlbekannte Gattung jener wirklichkeitshaltigen
„Zeichen" entsteht, die in empfängnisbereiten Seelen
ähnlich die Bildgeburten erneuern wie das mitteilende
Wort den Akt des Begreifens im vernehmenden
Geiste. Fallen nun auch fürder Trieb und Vermögen
nicht mehr zusammen, weil mit dem Zuge des Lebens
die Befehle des Geistes in Fehde liegen und sonach
ein sinnbilderndes Denken grundsätzlich der Entglei-
sung ebenso ausgesetzt ist wie das begreifende, so
hatte doch mindestens seit der jüngeren Steinzeit die
Bildnerkraft den Darstellungstrieb sich „einverleibt"
und ist nach langen Unabhängigkeitskämpfen seiner
erst völlig mit ihm zerfallen, seit unter dem Druck des
siegenden Logos er eigenmächtig Genüge sucht in
einer hochmütig abgesonderten „Kunst"-Ausübung.
* Unter dem Begriff „Pelasger" begreift L. Klages den „bildgefes-
sellen Menschen der Vorgesdlidile, dessen Bewufjtseinszustand unter
anderem auch den Mythos hervortrieb. „Pelasgerlum" bezeichnet in
diesem Zusammenhang „ein nodi pathisches Bewußtsein, das in Sym-
bolen denkt1'. Klages weist es drei weit auseinanderliegenden Menschen -
gruppen zu: „einmal vor allem den vorgeschichtlidien Ahnen, zumal
der europäischen Bildungsvölker", deren Wesen erschlossen wird aus
Götterbildern, Kulten, Symbolen, Mysterien und Mythen, dann den
außergeschichtlichen „Naturvölkern" der jüngsten Vergangenheit (teil-
weise dazu gerechnet alle Resle ungebrochener Volksschichten inner-
halb der Bildungsgrenzen) und endlidi den „editen Diditern aller
Völker und Zeiten, insofern sie nidit so sehr Persönlichkeiten als
Emptangsorgane sprachfähiger Wellen der Seele waren.'1
Demgegenüber haben die Kunsterzeugnisse des vor-
geschichtlichen Menschen, vom Körperschmuck über
die Zierden der Waffen und Hausgeräte bis zu den
Bauten, Bildwerken, Tonweisen, Liedern, ihre ganze
und einzige Würde in der Bedeutung einer Symbol-
sprache des vorgeschichtlichen Glau-
bens. Weit hinausgreifend über die Schranken, die
unsre Begriffskultur dem Schaffensdrange gezogen
hat, ist er die prägende Macht der Sprache gnd Schrift
und schlechtweg alles dessen gewesen, was wir heute
als Zeichen benutzen im Dienste von Mitteilungszwek-
ken. Selbst das Werkzeug an und für sich, also von
schmückender Zutat abgesehen, steht ursprünglich
auf einer Linie mit dem Idol. Man braucht nur der
sagenschweren Symbolik etwa von Hammer, Bogen,
Pfeil, Speer, Wagen, Schwert, Rad, Spindel, Gürtel,
Stab, Ring, Mischkrug, Becher, Schiff zu gedenken, um
sich zu überzeugen, daß es djmals keine Erfindung
ohne göttlichen Sinn gegeben habe. — Was in Ver-
gleichung damit nun unsre im Sterben liegende „Kunst"
betrifft, so ist zu sagen, daß sie den ihr heute unter-
schiedlich eigentümlichen Wert einer „sprechenden"
oder „formvollen" Physiognomie damals mit jedem
Gebilde der Menschenhand teilen mußte und vom
unübersehlichen Reichtum ursprünglicher Formcharak-
tere nur insoweit einen Rest in sich bewahrt, als die
Seele des Schöpfers genug von der Seele der Vorzeit
birgt, um — vorübergehend entselbstet — aufzu-
nehmen, wovon allein die Geburt im Einklang mit
dem Rhythmus des Alls erfolgt: den Einstrom der
Bilder. Kunst, wenn sie mehr sein soll als vernünf-
telndes Paradieren mit abgeblätterten Oberflächen,
ist gläubige und demgemäß symbolische Kunst.
Aus: Ludwig Klages: „Der Geist als Widersacher der Seele", 3. Band
(Verlag Jot). Ambiosius Barth, Leipzig).
176
Aus
„Stern und Blume'
von Otto Pankok
(Freideulschland-
bund, Düsseldorf)
bens ja immer noch ausgeführt sehen durch den le-
bendigen Leib, der, ob auch unablässig vergehend,
die Artbilder der Organismen gebärend und wach-
send unablässig von neuem webt. Der zwar schon
geistige aber noch seelegefesselte Pelasger* da-
gegen vollbringt die Bannung der Bilder entweder da-
durch, daß er sie „magisch" herbeschwört, oder durch
Ein-Bildung seiner befruchteten Innerlichkeit in einen
aufnahmefähigen Stoff, wodurch unter anderem die
uns wohlbekannte Gattung jener wirklichkeitshaltigen
„Zeichen" entsteht, die in empfängnisbereiten Seelen
ähnlich die Bildgeburten erneuern wie das mitteilende
Wort den Akt des Begreifens im vernehmenden
Geiste. Fallen nun auch fürder Trieb und Vermögen
nicht mehr zusammen, weil mit dem Zuge des Lebens
die Befehle des Geistes in Fehde liegen und sonach
ein sinnbilderndes Denken grundsätzlich der Entglei-
sung ebenso ausgesetzt ist wie das begreifende, so
hatte doch mindestens seit der jüngeren Steinzeit die
Bildnerkraft den Darstellungstrieb sich „einverleibt"
und ist nach langen Unabhängigkeitskämpfen seiner
erst völlig mit ihm zerfallen, seit unter dem Druck des
siegenden Logos er eigenmächtig Genüge sucht in
einer hochmütig abgesonderten „Kunst"-Ausübung.
* Unter dem Begriff „Pelasger" begreift L. Klages den „bildgefes-
sellen Menschen der Vorgesdlidile, dessen Bewufjtseinszustand unter
anderem auch den Mythos hervortrieb. „Pelasgerlum" bezeichnet in
diesem Zusammenhang „ein nodi pathisches Bewußtsein, das in Sym-
bolen denkt1'. Klages weist es drei weit auseinanderliegenden Menschen -
gruppen zu: „einmal vor allem den vorgeschichtlidien Ahnen, zumal
der europäischen Bildungsvölker", deren Wesen erschlossen wird aus
Götterbildern, Kulten, Symbolen, Mysterien und Mythen, dann den
außergeschichtlichen „Naturvölkern" der jüngsten Vergangenheit (teil-
weise dazu gerechnet alle Resle ungebrochener Volksschichten inner-
halb der Bildungsgrenzen) und endlidi den „editen Diditern aller
Völker und Zeiten, insofern sie nidit so sehr Persönlichkeiten als
Emptangsorgane sprachfähiger Wellen der Seele waren.'1
Demgegenüber haben die Kunsterzeugnisse des vor-
geschichtlichen Menschen, vom Körperschmuck über
die Zierden der Waffen und Hausgeräte bis zu den
Bauten, Bildwerken, Tonweisen, Liedern, ihre ganze
und einzige Würde in der Bedeutung einer Symbol-
sprache des vorgeschichtlichen Glau-
bens. Weit hinausgreifend über die Schranken, die
unsre Begriffskultur dem Schaffensdrange gezogen
hat, ist er die prägende Macht der Sprache gnd Schrift
und schlechtweg alles dessen gewesen, was wir heute
als Zeichen benutzen im Dienste von Mitteilungszwek-
ken. Selbst das Werkzeug an und für sich, also von
schmückender Zutat abgesehen, steht ursprünglich
auf einer Linie mit dem Idol. Man braucht nur der
sagenschweren Symbolik etwa von Hammer, Bogen,
Pfeil, Speer, Wagen, Schwert, Rad, Spindel, Gürtel,
Stab, Ring, Mischkrug, Becher, Schiff zu gedenken, um
sich zu überzeugen, daß es djmals keine Erfindung
ohne göttlichen Sinn gegeben habe. — Was in Ver-
gleichung damit nun unsre im Sterben liegende „Kunst"
betrifft, so ist zu sagen, daß sie den ihr heute unter-
schiedlich eigentümlichen Wert einer „sprechenden"
oder „formvollen" Physiognomie damals mit jedem
Gebilde der Menschenhand teilen mußte und vom
unübersehlichen Reichtum ursprünglicher Formcharak-
tere nur insoweit einen Rest in sich bewahrt, als die
Seele des Schöpfers genug von der Seele der Vorzeit
birgt, um — vorübergehend entselbstet — aufzu-
nehmen, wovon allein die Geburt im Einklang mit
dem Rhythmus des Alls erfolgt: den Einstrom der
Bilder. Kunst, wenn sie mehr sein soll als vernünf-
telndes Paradieren mit abgeblätterten Oberflächen,
ist gläubige und demgemäß symbolische Kunst.
Aus: Ludwig Klages: „Der Geist als Widersacher der Seele", 3. Band
(Verlag Jot). Ambiosius Barth, Leipzig).
176