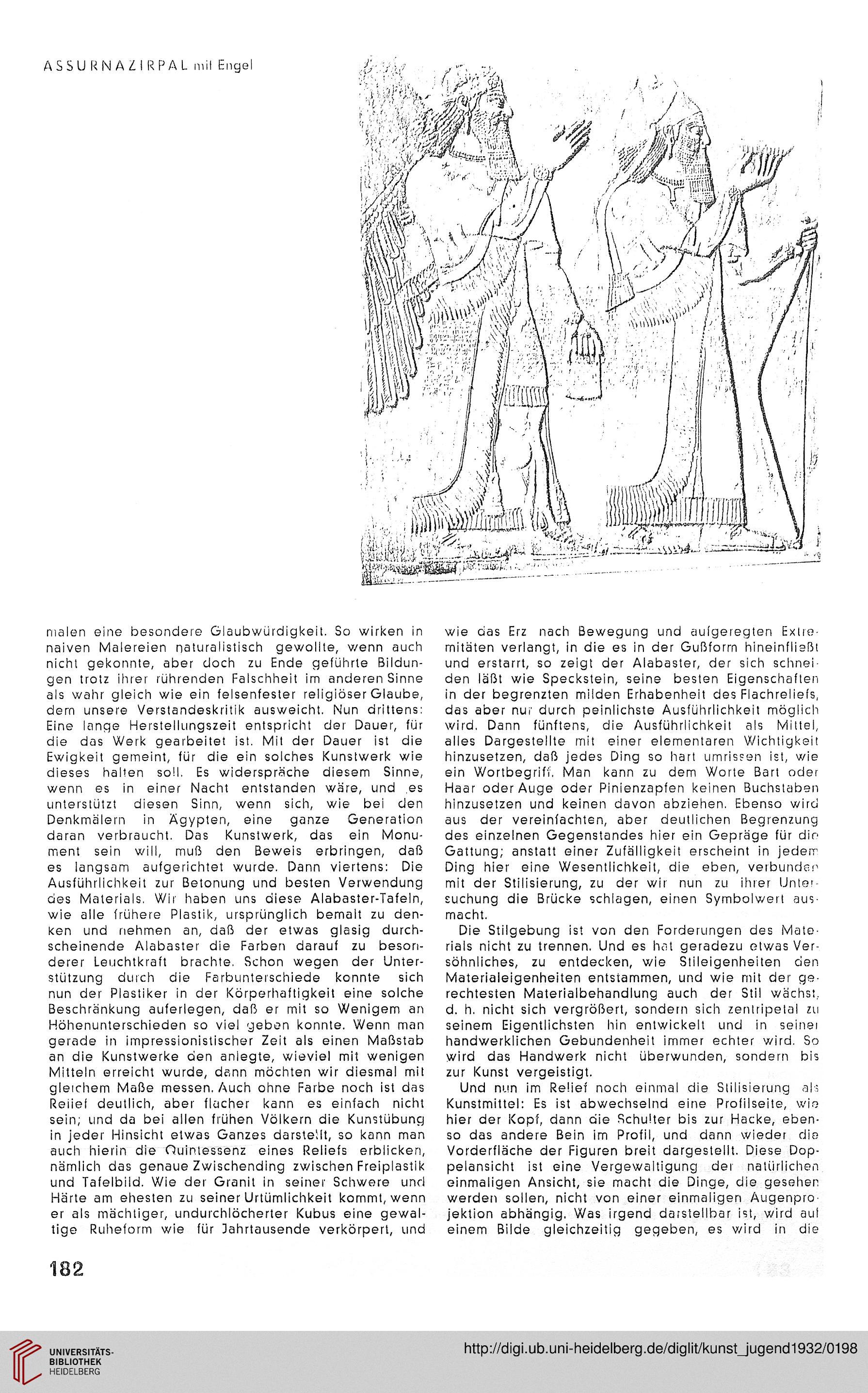ASSURNAZIRPAL mil Engel
malen eine besondere Glaubwürdigkeit. So wirken in
naiven Malereien naturalistisch gewollte, v/enn auch
nicht gekonnte, aber doch zu Ende geführte Bildun-
gen trotz ihrer rührenden Falschheit im anderen Sinne
als wahr gleich wie ein felsenfester religiöser Glaube,
dern unsere Verstandeskritik ausweicht. Nun drittens:
Eine lange Herstellungszeit entspricht der Dauer, für
die das Werk gearbeitet ist. Mit der Dauer ist die
Ewigkeit gemeint, für die ein solches Kunstwerk wie
dieses halten soll. Es widerspräche diesem Sinne,
wenn es in einer Nacht entstanden wäre, und es
unterstützt diesen Sinn, wenn sich, wie bei den
Denkmälern in Ägypten, eine ganze Generation
daran verbraucht. Das Kunstwerk, das ein Monu-
ment sein will, muß den Beweis erbringen, daß
es langsam aufgerichtet wurde. Dann viertens: Die
Ausführlichkeit zur Betonung und besten Verwendung
des Materials, Wir haben uns diese Alabaster-Tafeln,
wie alle frühere Plastik, ursprünglich bemalt zu den-
ken und nehmen an, daß der etwas glasig durch-
scheinende Alabaster die Farben darauf zu beson-
derer Leuchtkraft brachte. Schon wegen der Unter-
stützung durch die Farbunterschiede konnte sich
nun der Plastiker in der Körperhaftigkeit eine solche
Beschränkung auferlegen, daß er mit so Wenigem an
Höhenunterschieden so viel geben konnte. Wenn man
gerade in impressionistischer Zeit als einen Maßstab
an die Kunstwerke den anlegte, wieviel mit wenigen
Mitteln erreicht wurde, dann möchten wir diesmal mit
gleichem Maße messen. Auch ohne Farbe noch ist das
Reiief deutlich, aber flacher kann es einfach nicht
sein; und da bei allen frühen Völkern die Kunstübung
in jeder Hinsicht etwas Ganzes darste'lt, so kann man
auch hierin die Quintessenz eines Reliefs erblicken,
nämlich das genaue Zwischending zwischen Freiplastik
und Tafelbild. Wie der Granit in seiner Schwere und
Härte am ehesten zu seiner Urtümlichkeit kommt, wenn
er als mächtiger, undurchlöcherter Kubus eine gewal-
tige Ruheform wie für Jahrtausende verkörpert, und
wie das Erz nach Bewegung und auigeregten Extre-
mitäten verlangt, in die es in der Gußform hineinfließt
und erstarrt, so zeigt der Alabaster, der sich schnei-
den läßt wie Speckstein, seine besten Eigenschaften
in der begrenzten milden Erhabenheit des Flachreliefs,
das aber nur durch peinlichste Ausführlichkeit möglich
wird, Dann fünftens, die Ausführlichkeit als Mittel,
alles Dargestellte mit einer elementaren Wichtigkeit
hinzusetzen, daß jedes Ding so hart Umrissen ist, wie
ein Wortbegriff. Man kann zu dem Worte Bart oder
Haar oder Auge oder Pinienzapfen keinen Buchstaben
hinzusetzen und keinen davon abziehen. Ebenso wird
aus der vereinfachten, aber deutlichen Begrenzung
des einzelnen Gegenstandes hier ein Gepräge für din
Gattung; anstatt einer Zufälligkeit erscheint in jedem
Ding hier eine Wesentlichkeit, die eben, verbunden
mit der Stilisierung, zu der wir nun zu ihrer Unter-
suchung die Brücke schlagen, einen Symbolwert aus-
macht.
Die Stilgebung ist von den Forderungen des Mate-
rials nicht zu trennen. Und es hat geradezu etwas Ver-
söhnliches, zu entdecken, wie Stileigenheiten den
Materiaieigenheiten entstammen, und wie mit der ge-
rechtesten Materialbehandlung auch der Stil wächst,
d. h. nicht sich vergrößert, sondern sich zentripetal zu
seinem Eigentlichsten hin entwickelt und in seinei
handwerklichen Gebundenheit immer echter wird. So
wird das Handwerk nicht überwunden, sondern bis
zur Kunst vergeistigt.
Und nun im Relief noch einmal die Stilisierung als
Kunstmittel: Es ist abwechselnd eine Profilseite, wie
hier der Kopf, dann die Schulter bis zur Hacke, eben-
so das andere Bein im Profil, und dann wieder die
Vorderfläche der Figuren breit dargestellt. Diese Dop-
pelansicht ist eine Vergewaltigung der natürlichen
einmaligen Ansicht, sie macht die Dinge, die gesehen
werden sollen, nicht von einer einmaligen Augenpro-
jektion abhängig. Was irgend darstellbar ist, wird aul
einem Bilde gleichzeitig gegeben, es wird in die
182
malen eine besondere Glaubwürdigkeit. So wirken in
naiven Malereien naturalistisch gewollte, v/enn auch
nicht gekonnte, aber doch zu Ende geführte Bildun-
gen trotz ihrer rührenden Falschheit im anderen Sinne
als wahr gleich wie ein felsenfester religiöser Glaube,
dern unsere Verstandeskritik ausweicht. Nun drittens:
Eine lange Herstellungszeit entspricht der Dauer, für
die das Werk gearbeitet ist. Mit der Dauer ist die
Ewigkeit gemeint, für die ein solches Kunstwerk wie
dieses halten soll. Es widerspräche diesem Sinne,
wenn es in einer Nacht entstanden wäre, und es
unterstützt diesen Sinn, wenn sich, wie bei den
Denkmälern in Ägypten, eine ganze Generation
daran verbraucht. Das Kunstwerk, das ein Monu-
ment sein will, muß den Beweis erbringen, daß
es langsam aufgerichtet wurde. Dann viertens: Die
Ausführlichkeit zur Betonung und besten Verwendung
des Materials, Wir haben uns diese Alabaster-Tafeln,
wie alle frühere Plastik, ursprünglich bemalt zu den-
ken und nehmen an, daß der etwas glasig durch-
scheinende Alabaster die Farben darauf zu beson-
derer Leuchtkraft brachte. Schon wegen der Unter-
stützung durch die Farbunterschiede konnte sich
nun der Plastiker in der Körperhaftigkeit eine solche
Beschränkung auferlegen, daß er mit so Wenigem an
Höhenunterschieden so viel geben konnte. Wenn man
gerade in impressionistischer Zeit als einen Maßstab
an die Kunstwerke den anlegte, wieviel mit wenigen
Mitteln erreicht wurde, dann möchten wir diesmal mit
gleichem Maße messen. Auch ohne Farbe noch ist das
Reiief deutlich, aber flacher kann es einfach nicht
sein; und da bei allen frühen Völkern die Kunstübung
in jeder Hinsicht etwas Ganzes darste'lt, so kann man
auch hierin die Quintessenz eines Reliefs erblicken,
nämlich das genaue Zwischending zwischen Freiplastik
und Tafelbild. Wie der Granit in seiner Schwere und
Härte am ehesten zu seiner Urtümlichkeit kommt, wenn
er als mächtiger, undurchlöcherter Kubus eine gewal-
tige Ruheform wie für Jahrtausende verkörpert, und
wie das Erz nach Bewegung und auigeregten Extre-
mitäten verlangt, in die es in der Gußform hineinfließt
und erstarrt, so zeigt der Alabaster, der sich schnei-
den läßt wie Speckstein, seine besten Eigenschaften
in der begrenzten milden Erhabenheit des Flachreliefs,
das aber nur durch peinlichste Ausführlichkeit möglich
wird, Dann fünftens, die Ausführlichkeit als Mittel,
alles Dargestellte mit einer elementaren Wichtigkeit
hinzusetzen, daß jedes Ding so hart Umrissen ist, wie
ein Wortbegriff. Man kann zu dem Worte Bart oder
Haar oder Auge oder Pinienzapfen keinen Buchstaben
hinzusetzen und keinen davon abziehen. Ebenso wird
aus der vereinfachten, aber deutlichen Begrenzung
des einzelnen Gegenstandes hier ein Gepräge für din
Gattung; anstatt einer Zufälligkeit erscheint in jedem
Ding hier eine Wesentlichkeit, die eben, verbunden
mit der Stilisierung, zu der wir nun zu ihrer Unter-
suchung die Brücke schlagen, einen Symbolwert aus-
macht.
Die Stilgebung ist von den Forderungen des Mate-
rials nicht zu trennen. Und es hat geradezu etwas Ver-
söhnliches, zu entdecken, wie Stileigenheiten den
Materiaieigenheiten entstammen, und wie mit der ge-
rechtesten Materialbehandlung auch der Stil wächst,
d. h. nicht sich vergrößert, sondern sich zentripetal zu
seinem Eigentlichsten hin entwickelt und in seinei
handwerklichen Gebundenheit immer echter wird. So
wird das Handwerk nicht überwunden, sondern bis
zur Kunst vergeistigt.
Und nun im Relief noch einmal die Stilisierung als
Kunstmittel: Es ist abwechselnd eine Profilseite, wie
hier der Kopf, dann die Schulter bis zur Hacke, eben-
so das andere Bein im Profil, und dann wieder die
Vorderfläche der Figuren breit dargestellt. Diese Dop-
pelansicht ist eine Vergewaltigung der natürlichen
einmaligen Ansicht, sie macht die Dinge, die gesehen
werden sollen, nicht von einer einmaligen Augenpro-
jektion abhängig. Was irgend darstellbar ist, wird aul
einem Bilde gleichzeitig gegeben, es wird in die
182