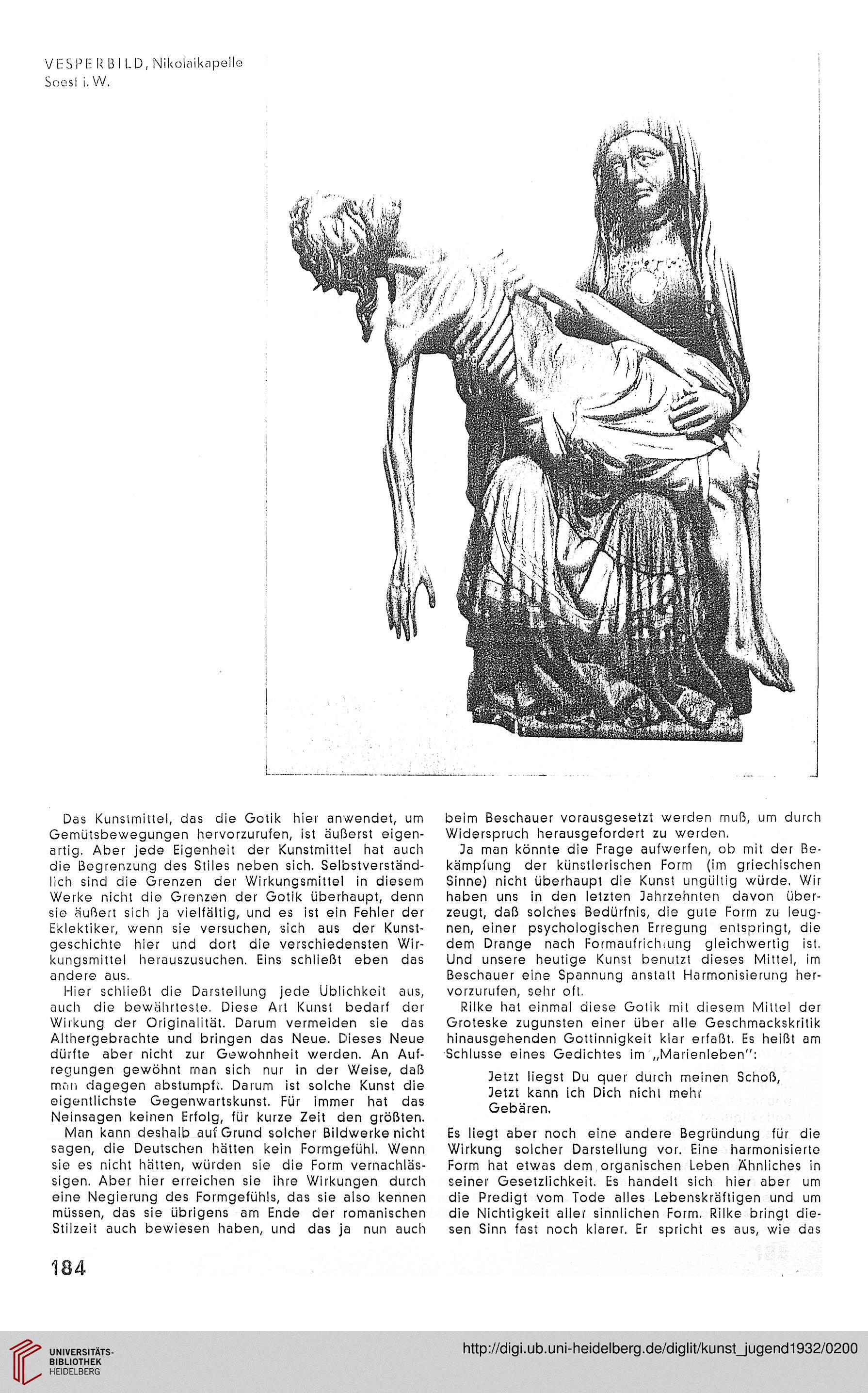VESPER BILD, Nikolaikapelle
Soesl i. VV.
Das Kunslmittel, das die Gotik hier anwendet, um
Gemütsbewegungen hervorzurufen, ist äußerst eigen-
artig. Aber jede Eigenheit der Kunstmittel hat auch
die Begrenzung des Stiles neben sich. Selbstverständ-
lich sind die Grenzen der Wirkungsmittel in diesem
Werke nicht die Grenzen der Gotik überhaupt, denn
sie äußert sich ja vielfältig, und es ist ein Fehler der
Eklektiker, wenn sie versuchen, sich aus der Kunst-
geschichte hier und dort die verschiedensten Wir-
kungsmittel herauszusuchen. Eins schließt eben das
andere aus.
Hier schließt die Darstellung jede Ublichkeit aus,
auch die bewährteste. Diese Art Kunst bedarf der
Wirkung der Originalität. Darum vermeiden sie das
Althergebrachte und bringen das Neue. Dieses Neue
dürfte aber nicht zur Gewohnheit werden. An Auf-
regungen gewöhnt man sich nur in der Weise, daß
man dagegen abstumpft. Darum ist solche Kunst die
eigentlichste Gegenwartskunst. Für immer hat das
Neinsagen keinen Erfolg, für kurze Zeit den größten.
Man kann deshalb auf Grund solcher Bildwerke nicht
sagen, die Deutschen hätten kein Formgefühl. Wenn
sie es nicht hätten, würden sie die Form vernachläs-
sigen. Aber hier erreichen sie ihre Wirkungen durch
eine Negierung des Formgefühls, das sie also kennen
müssen, das sie übrigens am Ende der romanischen
Stilzeit auch bewiesen haben, und das ja nun auch
beim Beschauer vorausgesetzt werden muß, um durch
Widerspruch herausgefordert zu werden.
Ja man könnte die Frage aufwerfen, ob mit der Be-
kämpfung der künstlerischen Form (im griechischen
Sinne) nicht überhaupt die Kunst ungültig würde. Wir
haben uns in den letzten Jahrzehnten davon über-
zeugt, daß solches Bedürfnis, die gute Form zu leug-
nen, einer psychologischen Erregung entspringt, die
dem Drange nach Formaufrichiung gleichwertig ist.
Und unsere heutige Kunst benutzt dieses Mittel, im
Beschauer eine Spannung anstatt Harmonisierung her-
vorzurufen, sehr oft.
Rilke hat einmal diese Gotik mit diesem Mittel der
Groteske zugunsten einer über alle Geschmackskritik
hinausgehenden Gottinnigkeit klar erfaßt. Es heißt am
Schlüsse eines Gedichtes im „Marienleben":
Jetzt liegst Du quer durch meinen Schoß,
Jetzt kann ich Dich nicht mehr
Gebären.
Es liegt aber noch eine andere Begründung für die
Wirkung solcher Darstellung vor. Eine harmonisierte
Form hat etwas dem organischen Leben Ähnliches in
seiner Gesetzlichkeit. Es handelt sich hier aber um
die Predigt vom Tode alles Lebenskräftigen und um
die Nichtigkeit aller sinnlichen Form. Rilke bringt die-
sen Sinn fast noch klarer. Er spricht es aus, wie das
184
Soesl i. VV.
Das Kunslmittel, das die Gotik hier anwendet, um
Gemütsbewegungen hervorzurufen, ist äußerst eigen-
artig. Aber jede Eigenheit der Kunstmittel hat auch
die Begrenzung des Stiles neben sich. Selbstverständ-
lich sind die Grenzen der Wirkungsmittel in diesem
Werke nicht die Grenzen der Gotik überhaupt, denn
sie äußert sich ja vielfältig, und es ist ein Fehler der
Eklektiker, wenn sie versuchen, sich aus der Kunst-
geschichte hier und dort die verschiedensten Wir-
kungsmittel herauszusuchen. Eins schließt eben das
andere aus.
Hier schließt die Darstellung jede Ublichkeit aus,
auch die bewährteste. Diese Art Kunst bedarf der
Wirkung der Originalität. Darum vermeiden sie das
Althergebrachte und bringen das Neue. Dieses Neue
dürfte aber nicht zur Gewohnheit werden. An Auf-
regungen gewöhnt man sich nur in der Weise, daß
man dagegen abstumpft. Darum ist solche Kunst die
eigentlichste Gegenwartskunst. Für immer hat das
Neinsagen keinen Erfolg, für kurze Zeit den größten.
Man kann deshalb auf Grund solcher Bildwerke nicht
sagen, die Deutschen hätten kein Formgefühl. Wenn
sie es nicht hätten, würden sie die Form vernachläs-
sigen. Aber hier erreichen sie ihre Wirkungen durch
eine Negierung des Formgefühls, das sie also kennen
müssen, das sie übrigens am Ende der romanischen
Stilzeit auch bewiesen haben, und das ja nun auch
beim Beschauer vorausgesetzt werden muß, um durch
Widerspruch herausgefordert zu werden.
Ja man könnte die Frage aufwerfen, ob mit der Be-
kämpfung der künstlerischen Form (im griechischen
Sinne) nicht überhaupt die Kunst ungültig würde. Wir
haben uns in den letzten Jahrzehnten davon über-
zeugt, daß solches Bedürfnis, die gute Form zu leug-
nen, einer psychologischen Erregung entspringt, die
dem Drange nach Formaufrichiung gleichwertig ist.
Und unsere heutige Kunst benutzt dieses Mittel, im
Beschauer eine Spannung anstatt Harmonisierung her-
vorzurufen, sehr oft.
Rilke hat einmal diese Gotik mit diesem Mittel der
Groteske zugunsten einer über alle Geschmackskritik
hinausgehenden Gottinnigkeit klar erfaßt. Es heißt am
Schlüsse eines Gedichtes im „Marienleben":
Jetzt liegst Du quer durch meinen Schoß,
Jetzt kann ich Dich nicht mehr
Gebären.
Es liegt aber noch eine andere Begründung für die
Wirkung solcher Darstellung vor. Eine harmonisierte
Form hat etwas dem organischen Leben Ähnliches in
seiner Gesetzlichkeit. Es handelt sich hier aber um
die Predigt vom Tode alles Lebenskräftigen und um
die Nichtigkeit aller sinnlichen Form. Rilke bringt die-
sen Sinn fast noch klarer. Er spricht es aus, wie das
184