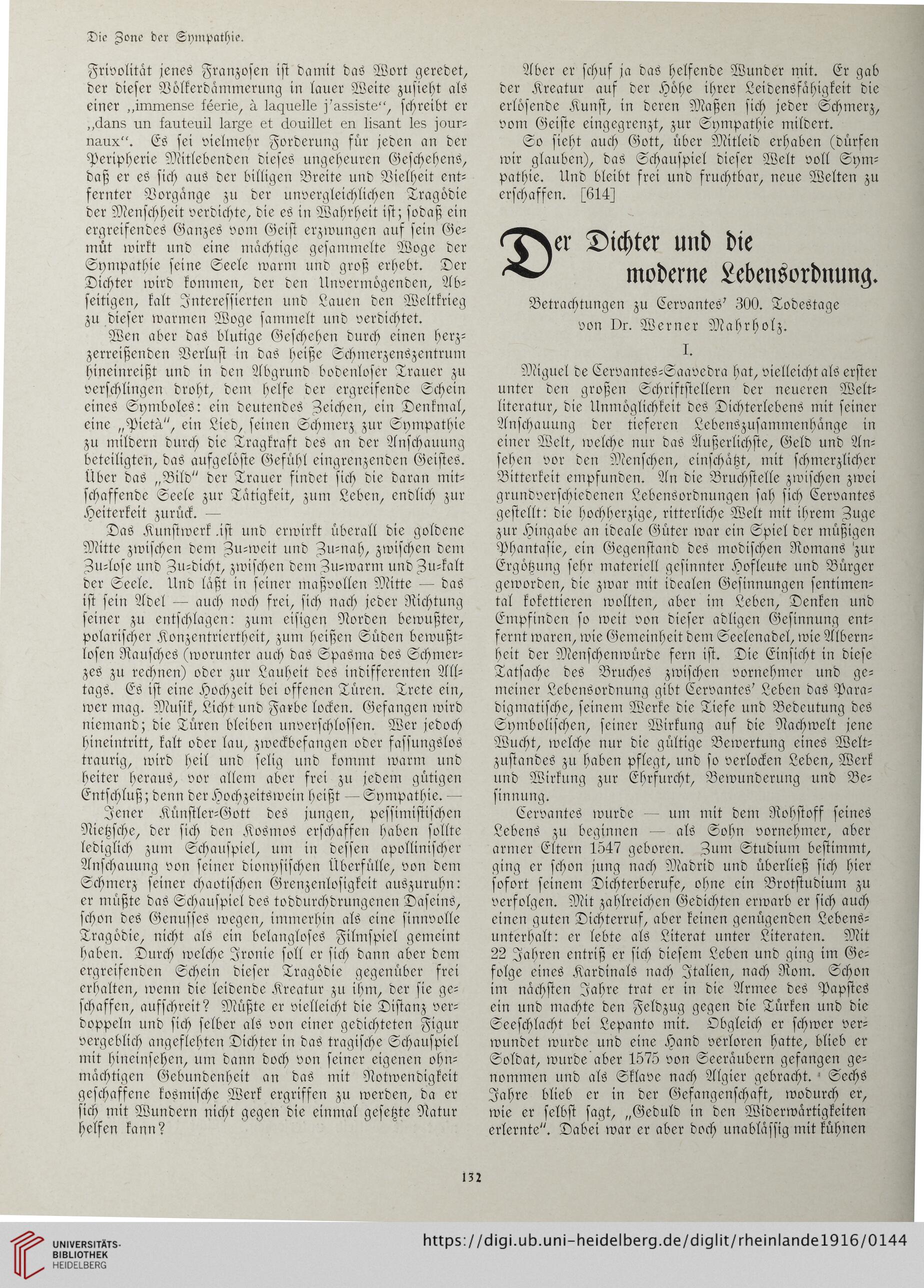Die Zone der Sympathie.
Frivolität jenes Franzosen ist damit das Wort geredet,
der dieser Völkerdämmerung in lauer Weite zusieht als
einer ,,imnrenss teeris, a lagueike s'assists", schreibt er
„ttans nn lautem! large et clonillet en lisartt les sour-
nLux". Es sei vielmehr Forderung für jeden an der
Peripherie Mitlebenden dieses ungeheuren Geschehens,
daß er es sich aus der billigen Breite und Vielheit ent-
fernter Vorgänge zu der unvergleichlichen Tragödie
der Menschheit verdichte, die es in Wahrheit ist; sodaß ein
ergreifendes Ganzes vom Geist erzwungen auf sein Ge-
müt wirkt und eine mächtige gesammelte Woge der
Sympathie seine Seele warnt und groß erhebt. Der
Dichter wird kommen, der den Unvermögenden, Ab-
seitigen, kalt Interessierten und Lauen den Weltkrieg
zu dieser warmen Woge sammelt und verdichtet.
Wen aber das blutige Geschehen durch einen herz-
zerreißenden Verlust in das heiße Schmerzenszentrum
hineinreißt und in den Abgrund bodenloser Trauer zu
verschlingen droht, dem helfe der ergreifende Schein
eines Syntboles: ein deutendes Zeichen, ein Denkmal,
eine „Pieta", ein Lied, seinen Schmerz zur Sympathie
zu mildern durch die Tragkraft des an der Anschauung
beteiligten, das aufgelöste Gefühl eingrenzenden Geistes.
Über das „Bild" der Trauer findet sich die daran mit-
schaffende Seele zur Tätigkeit, zum Leben, endlich zur
Heiterkeit zurück. —
Das Kunstwerk.ist und erwirkt überall die goldene
Mitte zwischen dem Zu-weit und Zu-nah, zwischen den:
Zu-lose und Zu-dicht, zwischen dem Zu-warm und Zu-kalt
der Seele. Und läßt in seiner maßvollen Mitte — das
ist sein Adel — auch noch frei, sich nach jeder Richtung
seiner zu entschlagen: zum eisigen Norden bewußter,
polarischer Konzentrierthcit, zum heißen Süden bewußt-
losen Rausches (worunter auch das Spasma des Schmer-
zes zu rechnen) oder zur Lauheit des indifferenten All-
tags. Es ist eine Hochzeit bei offenen Türen. Trete ein,
wer mag. Musik, Licht und Farbe locken. Gefangen wird
niemand; die Türen bleiben unverschlossen. Wer jedoch
hineintritt, kalt oder lau, zweckbefangen oder fassungslos
traurig, wird heil und selig und kommt warm und
heiter heraus, vor allem aber frei zu jedem gütigen
Entschluß; denn der Hochzeitswein heißt — Sympathie. —
Jener Künstler-Gott des jungen, pessimistischen
Nietzsche, der sich den Kosmos erschaffen haben sollte
lediglich zum Schauspiel, um in dessen apollinischer
Anschauung von seiner dionysischen Überfülle, von dem
Schmerz seiner chaotischen Grenzenlosigkeit auszurubn:
er müßte das Schauspiel des toddurchdrungenen Daseins,
schon des Genusses wegen, immerhin als eine sinnvolle
Tragödie, nicht als ein belangloses Filmspiel gemeint
haben. Durch welche Ironie soll er sich dann aber dem
ergreifenden Schein dieser Tragödie gegenüber frei
erhalten, wenn die leidende Kreatur zu ihm, der sie ge-
schaffen, aufschreit? Müßte er vielleicht die Distanz ver-
doppeln und sich selber als von einer gedichteten Figur
vergeblich angeflehten Dichter in das tragische Schauspiel
mit hineinsehen, um dann doch von seiner eigenen ohn-
mächtigen Gebundenheit an das mit Notwendigkeit
geschaffene kosmische Werk ergriffen zu werden, da er
sich mit Wundern nicht gegen die einmal gesetzte Natur
helfen kann?
nr
Aber er schuf ja das helfende Wunder mit. Er gab
der Kreatur auf der Höhe ihrer Leidensfähigkeit die
erlösende Kunst, in deren Maßen sich jeder Schmerz,
vom Geiste eingegrenzt, zur Sympathie mildert.
So sieht auch Gott, über Mitleid erhaben (dürfen
wir glauben), das Schauspiel dieser Welt voll Sym-
pathie. Und bleibt frei und fruchtbar, neue Welten zu
erschaffen. (614)
er Dichter und die
moderne Lebensordnung.
Betrachtungen zu Cervantes' 300. Todestage
von I)r. Werner Mahrholz.
I.
Miguel de Cervantes-Saavedra hat, vielleicht als erster-
unter den großen Schriftstellern der neueren Welt-
literatur, die Unmöglichkeit des Dichterlebens mit seiner
Anschauung der tieferen Lebenszusammenhänge in
einer Welt, welche nur das Äußerlichste, Geld und An-
sehen vor den Menschen, einschätzt, mit schmerzlicher
Bitterkeit empfunden. An die Bruchstelle zwischen zwei
grundverschiedenen Lebensordnungen sah sich Cervantes
gestellt: die hochherzige, ritterliche Welt mit ihrem Zuge
zur Hingabe an ideale Güter war ein Spiel der müßigen
Phantasie, ein Gegenstand des modischen Romans Pir
Ergötzung sehr materiell gesinnter Hofleute und Bürger
geworden, die zwar mit idealen Gesinnungen sentimen-
tal kokettieren wollten, aber im Leben, Denken und
Empfinden so weit von dieser adligen Gesinnung ent-
fernt waren, wie Gemeinheit dem Seelenadel, wie Albern-
heit der Menschenwürde fern ist. Die Einsicht in diese
Tatsache des Bruches zwischen vornehmer und ge-
meiner Lebensordnung gibt Cervantes' Leben das Para-
digmatische, seinenc Werke die Tiefe und Bedeutung des
Symbolischen, seiner Wirkung auf die Nachwelt jene
Wucht, welche nur die gültige Bewertung eines Welt-
zustandes zu haben pflegt, und so verlocken Leben, Werk
und Wirkung zur Ehrfurcht, Bewunderung und Be-
sinnung.
Cervantes wurde — um mit dem Rohstoff seines
Lebens zu beginnen — als Sohn vornehmer, aber
armer Eltern 1547 geboren. Zum Studium bestimmt,
ging er schon jung nach Madrid und überließ sich hier
sofort seinem Dichterberufe, ohne ein Brotstudium zu
verfolgen. Mit zahlreichen Gedichten erwarb er sich auch
einen guten Dichterruf, aber keinen genügenden Lebens-
unterhalt: er lebte als Literat unter Literaten. Mit
22 Jahren entriß er sich diesem Leben und ging im Ge-
folge eines Kardinals nach Italien, nach Rom. Schon
im nächsten Jahre trat er in die Armee des Papstes
ein und machte den Feldzug gegen die Türken und die
Seeschlacht bei Lepanto mit. Obgleich er schwer ver-
wundet wurde und eine Hand verloren hatte, blieb er
Soldat, wurde aber 1575 von Seeräubern gefangen ge-
nommen und als Sklave nach Algier gebracht.' Sechs
Jahre blieb er in der Gefangenschaft, wodurch er,
wie er selbst sagt, „Geduld in den Widerwärtigkeiten
erlernte". Dabei war er aber doch unablässig mit kühnen
Frivolität jenes Franzosen ist damit das Wort geredet,
der dieser Völkerdämmerung in lauer Weite zusieht als
einer ,,imnrenss teeris, a lagueike s'assists", schreibt er
„ttans nn lautem! large et clonillet en lisartt les sour-
nLux". Es sei vielmehr Forderung für jeden an der
Peripherie Mitlebenden dieses ungeheuren Geschehens,
daß er es sich aus der billigen Breite und Vielheit ent-
fernter Vorgänge zu der unvergleichlichen Tragödie
der Menschheit verdichte, die es in Wahrheit ist; sodaß ein
ergreifendes Ganzes vom Geist erzwungen auf sein Ge-
müt wirkt und eine mächtige gesammelte Woge der
Sympathie seine Seele warnt und groß erhebt. Der
Dichter wird kommen, der den Unvermögenden, Ab-
seitigen, kalt Interessierten und Lauen den Weltkrieg
zu dieser warmen Woge sammelt und verdichtet.
Wen aber das blutige Geschehen durch einen herz-
zerreißenden Verlust in das heiße Schmerzenszentrum
hineinreißt und in den Abgrund bodenloser Trauer zu
verschlingen droht, dem helfe der ergreifende Schein
eines Syntboles: ein deutendes Zeichen, ein Denkmal,
eine „Pieta", ein Lied, seinen Schmerz zur Sympathie
zu mildern durch die Tragkraft des an der Anschauung
beteiligten, das aufgelöste Gefühl eingrenzenden Geistes.
Über das „Bild" der Trauer findet sich die daran mit-
schaffende Seele zur Tätigkeit, zum Leben, endlich zur
Heiterkeit zurück. —
Das Kunstwerk.ist und erwirkt überall die goldene
Mitte zwischen dem Zu-weit und Zu-nah, zwischen den:
Zu-lose und Zu-dicht, zwischen dem Zu-warm und Zu-kalt
der Seele. Und läßt in seiner maßvollen Mitte — das
ist sein Adel — auch noch frei, sich nach jeder Richtung
seiner zu entschlagen: zum eisigen Norden bewußter,
polarischer Konzentrierthcit, zum heißen Süden bewußt-
losen Rausches (worunter auch das Spasma des Schmer-
zes zu rechnen) oder zur Lauheit des indifferenten All-
tags. Es ist eine Hochzeit bei offenen Türen. Trete ein,
wer mag. Musik, Licht und Farbe locken. Gefangen wird
niemand; die Türen bleiben unverschlossen. Wer jedoch
hineintritt, kalt oder lau, zweckbefangen oder fassungslos
traurig, wird heil und selig und kommt warm und
heiter heraus, vor allem aber frei zu jedem gütigen
Entschluß; denn der Hochzeitswein heißt — Sympathie. —
Jener Künstler-Gott des jungen, pessimistischen
Nietzsche, der sich den Kosmos erschaffen haben sollte
lediglich zum Schauspiel, um in dessen apollinischer
Anschauung von seiner dionysischen Überfülle, von dem
Schmerz seiner chaotischen Grenzenlosigkeit auszurubn:
er müßte das Schauspiel des toddurchdrungenen Daseins,
schon des Genusses wegen, immerhin als eine sinnvolle
Tragödie, nicht als ein belangloses Filmspiel gemeint
haben. Durch welche Ironie soll er sich dann aber dem
ergreifenden Schein dieser Tragödie gegenüber frei
erhalten, wenn die leidende Kreatur zu ihm, der sie ge-
schaffen, aufschreit? Müßte er vielleicht die Distanz ver-
doppeln und sich selber als von einer gedichteten Figur
vergeblich angeflehten Dichter in das tragische Schauspiel
mit hineinsehen, um dann doch von seiner eigenen ohn-
mächtigen Gebundenheit an das mit Notwendigkeit
geschaffene kosmische Werk ergriffen zu werden, da er
sich mit Wundern nicht gegen die einmal gesetzte Natur
helfen kann?
nr
Aber er schuf ja das helfende Wunder mit. Er gab
der Kreatur auf der Höhe ihrer Leidensfähigkeit die
erlösende Kunst, in deren Maßen sich jeder Schmerz,
vom Geiste eingegrenzt, zur Sympathie mildert.
So sieht auch Gott, über Mitleid erhaben (dürfen
wir glauben), das Schauspiel dieser Welt voll Sym-
pathie. Und bleibt frei und fruchtbar, neue Welten zu
erschaffen. (614)
er Dichter und die
moderne Lebensordnung.
Betrachtungen zu Cervantes' 300. Todestage
von I)r. Werner Mahrholz.
I.
Miguel de Cervantes-Saavedra hat, vielleicht als erster-
unter den großen Schriftstellern der neueren Welt-
literatur, die Unmöglichkeit des Dichterlebens mit seiner
Anschauung der tieferen Lebenszusammenhänge in
einer Welt, welche nur das Äußerlichste, Geld und An-
sehen vor den Menschen, einschätzt, mit schmerzlicher
Bitterkeit empfunden. An die Bruchstelle zwischen zwei
grundverschiedenen Lebensordnungen sah sich Cervantes
gestellt: die hochherzige, ritterliche Welt mit ihrem Zuge
zur Hingabe an ideale Güter war ein Spiel der müßigen
Phantasie, ein Gegenstand des modischen Romans Pir
Ergötzung sehr materiell gesinnter Hofleute und Bürger
geworden, die zwar mit idealen Gesinnungen sentimen-
tal kokettieren wollten, aber im Leben, Denken und
Empfinden so weit von dieser adligen Gesinnung ent-
fernt waren, wie Gemeinheit dem Seelenadel, wie Albern-
heit der Menschenwürde fern ist. Die Einsicht in diese
Tatsache des Bruches zwischen vornehmer und ge-
meiner Lebensordnung gibt Cervantes' Leben das Para-
digmatische, seinenc Werke die Tiefe und Bedeutung des
Symbolischen, seiner Wirkung auf die Nachwelt jene
Wucht, welche nur die gültige Bewertung eines Welt-
zustandes zu haben pflegt, und so verlocken Leben, Werk
und Wirkung zur Ehrfurcht, Bewunderung und Be-
sinnung.
Cervantes wurde — um mit dem Rohstoff seines
Lebens zu beginnen — als Sohn vornehmer, aber
armer Eltern 1547 geboren. Zum Studium bestimmt,
ging er schon jung nach Madrid und überließ sich hier
sofort seinem Dichterberufe, ohne ein Brotstudium zu
verfolgen. Mit zahlreichen Gedichten erwarb er sich auch
einen guten Dichterruf, aber keinen genügenden Lebens-
unterhalt: er lebte als Literat unter Literaten. Mit
22 Jahren entriß er sich diesem Leben und ging im Ge-
folge eines Kardinals nach Italien, nach Rom. Schon
im nächsten Jahre trat er in die Armee des Papstes
ein und machte den Feldzug gegen die Türken und die
Seeschlacht bei Lepanto mit. Obgleich er schwer ver-
wundet wurde und eine Hand verloren hatte, blieb er
Soldat, wurde aber 1575 von Seeräubern gefangen ge-
nommen und als Sklave nach Algier gebracht.' Sechs
Jahre blieb er in der Gefangenschaft, wodurch er,
wie er selbst sagt, „Geduld in den Widerwärtigkeiten
erlernte". Dabei war er aber doch unablässig mit kühnen