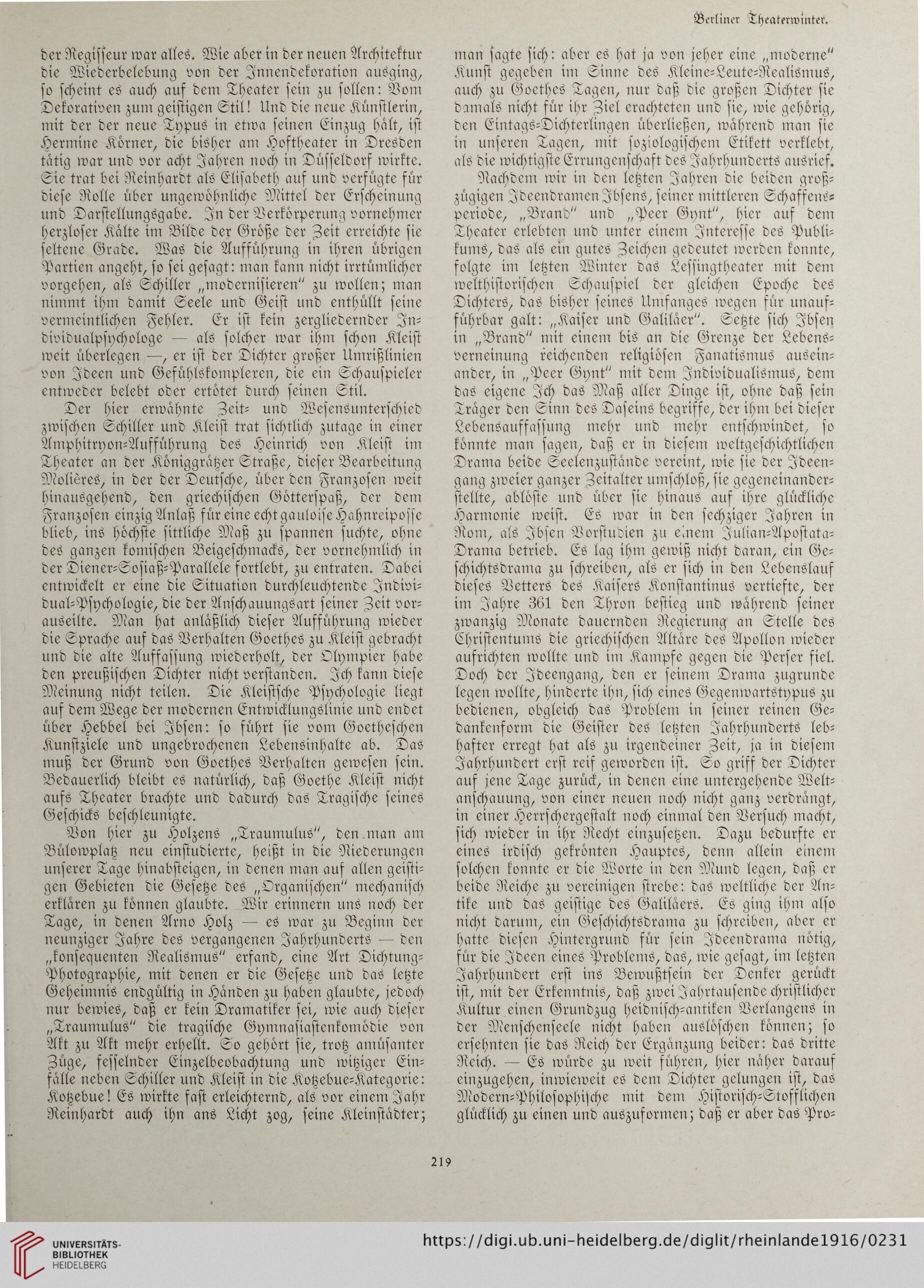Berliner Theaterwinter.
der Regisseur war alles. Wie aber in der neuen Architektur
die Wiederbelebung von der Innendekoration ausging,
so scheint es auch auf dem Theater sein zu sollen: Vom
Dekorativen zum geistigen Stil! Und die neue Künstlerin,
mit der der neue Typus in etwa seinen Einzug hält, ist
Hermine Körner, die bisher am Hoftheater in Dresden
tätig war und vor acht Jahren noch in Düsseldorf wirkte.
Sie trat bei Reinhardt als Elisabeth auf und verfügte für
diese Rolle über ungewöhnliche Mittel der Erscheinung
und Darstellungsgabe. In der Verkörperung vornehmer
herzloser Kälte im Bilde der Größe der Zeit erreichte sie
seltene Grade. Was die Aufführung in ihren übrigen
Partien angeht, so sei gesagt: man kann nicht irrtümlicher
vorgehen, als Schiller „modernisieren" zu wollen; man
nimmt ihm damit Seele und Geist und enthüllt seine
vermeintlichen Fehler. Er ist kein zergliedernder Jn-
dividualpsychologe — als solcher war ihm schon Kleist
weit überlegen —, er ist der Dichter großer Umrißlinien
von Ideen und Gefühlskompleren, die ein Schauspieler
entweder belebt oder ertötet durch seinen Stil.
Der hier erwähnte Zeit- und Wesensunterschied
zwischen Schiller und Kleist trat sichtlich zutage in einer
Amphitryon-Aufführung des Heinrich von Kleist im
Theater an der Königgrätzer Straße, dieser Bearbeitung
Molieres, in der der Deutsche, über den Franzosen weit
hinausgehend, den griechischen Götterspaß, der den,
Franzosen einzig Anlaß für eine echt gauloise Hahnreiposse
blieb, ins höchste sittliche Maß zu spannen suchte, ohne
des ganzen komischen Beigeschmacks, der vornehmlich in
der Diener-Sosiaß-Parallele fortlebt, zu entraten. Dabei
entwickelt er eine die Situation durchleuchtende Jndivi-
dual-Psychologie, die der Anschauungsart seiner Zeit vor-
auseilte. Man hat anläßlich dieser Aufführung wieder
die Sprache auf das Verhalten Goethes zu Kleist gebracht
und die alte Auffassung wiederholt, der Olympier habe
den preußischen Dichter nicht verstanden. Ich kann diese
Meinung nicht teilen. Die Kleistsche Psychologie liegt
auf dem Wege der modernen Entwicklungslinie und endet
über Hebbel bei Ibsen: so führt sie vom Goetheschen
Kunstziele und ungebrochenen Lebensinhalte ab. Das
muß der Grund von Goethes Verhalten gewesen sein.
Bedauerlich bleibt es natürlich, daß Goethe Kleist nicht
aufs Theater brachte und dadurch das Tragische seines
Geschicks beschleunigte.
Von hier zu Holzens „Traumulus", den man am
Bülowplatz neu einstudierte, heißt in die Niederungen
unserer Tage hinabsteigen, in denen man auf allen geisti-
gen Gebieten die Gesetze des „Organischen" mechanisch
erklären zu können glaubte. Wir erinnern uns noch der
Tage, in denen Arno Holz — es war zu Beginn der
neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts — den
„konsequenten Realismus" erfand, eine Art Dichtung-
Photographie, mit denen er die Gesetze und das letzte
Geheimnis endgültig in Händen zu haben glaubte, jedoch
nur bewies, daß er kein Dramatiker sei, wie auch dieser
„Traumulus" die tragische Gymnasiastenkomödie von
Akt zu Akt mehr erhellt. So gehört sie, trotz amüsanter
Züge, fesselnder Einzelbeobachtung und witziger Ein-
fälle neben Schiller und Kleist in die Kotzebue-Kategorie:
Kotzebue! Es wirkte fast erleichternd, als vor einem Jahr-
Reinhardt auch ihn ans Licht zog, seine Kleinstädter;
man sagte sich: aber es hat ja von jeher eine „moderne"
Kunst gegeben im Sinne des Kleine-Leute-Realismus,
auch zu Goethes Tagen, nur daß die großen Dichter sie
damals nicht für ihr Ziel erachteten und sie, wie gehörig,
den Eintags-Dichterlingen überließen, während man sie
in unseren Tagen, mit soziologischem Etikett verklebt,
als die wichtigste Errungenschaft des Jahrhunderts ausrief.
Nachdem wir in den letzten Jahren die beiden groß-
zügigen Ideendramen Ibsens, seiner mittleren Schaffens-
periode, „Brand" und „Peer Gynt", hier auf dem
Theater erlebten und unter einem Interesse des Publi-
kums, das als ein gutes Zeichen gedeutet werden konnte,
folgte im letzten Winter das Lessingtheater mit dem
welthistorischen Schauspiel der gleichen Epoche des
Dichters, das bisher seines Umfanges wegen für unaus-
führbar galt: „Kaiser und Galiläer". Setzte sich Ibsen
in „Brand" mit einem bis an die Grenze der Lebens-
verneinung reichenden religiösen Fanatismus ausein-
ander, in „Peer Gynt" nut dem Individualismus, dem
das eigene Ich das Maß aller Dinge ist, ohne daß sein
Träger den Sinn des Daseins begriffe, der ihm bei dieser
Lebensauffassung mehr und mehr entschwindet, so
könnte man sagen, daß er in diesem weltgeschichtlichen
Drama beide Seelenzustände vereint, wie sie der Ideen-
gang zweier ganzer Zeitalter umschloß, sie gegeneinander-
stellte, ablöste und über sie hinaus auf ihre glückliche
Harmonie weist. Es war in den sechziger Jahren in
Rom, als Ibsen Vorstudien zu emem Julian-Apostata-
Drama betrieb. Es lag ihm gewiß nicht daran, ein Ge-
schichtsdrama zu schreiben, als er sich in den Lebenslauf
dieses Vetters des Kaisers Konstantinus vertiefte, der
im Jahre 361 den Thron bestieg und während seiner
zwanzig Monate dauernden Negierung an Stelle des
Christentums die griechischen Altäre des Apollon wieder
aufrichten wollte und im Kampfe gegen die Perser fiel.
Doch der Jdeengang, den er seinem Drama zugrunde
legen wollte, hinderte ihn, sich eines Gegenwartstypus zu
bedienen, obgleich das Problem in seiner reinen Ge-
dankenform die Geister des letzten Jahrhunderts leb-
hafter erregt hat als zu irgendeiner Zeit, ja in diesem
Jahrhundert erst reif geworden ist. So griff der Dichter
auf jene Tage zurück, in denen eine untergehende Welt-
anschauung, von einer neuen noch nicht ganz verdrängt,
in einer Herrschergestalt noch einmal den Versuch macht,
sich wieder in ihr Recht einzusetzen. Dazu bedurfte er
eines irdisch gekrönten Hauptes, denn allein einem
solchen konnte er die Worte in den Mund legen, daß er
beide Reiche zu vereinigen strebe: das weltliche der An-
tike und das geistige des Galiläers. Es ging ihm also
nicht darum, ein Geschichtsdrama zu schreiben, aber er-
halte diesen Hintergrund für sein Ideendrama nötig,
für die Ideen eines Problems, das, wie gesagt, im letzten
Jahrhundert erst ins Bewußtsein der Denker gerückt
ist, mit der Erkenntnis, daß zwei Jahrtausende christlicher
Kultur einen Grundzug heidnisch-antiken Verlangens in
der Menschenseele nicht haben auslöschen können; so
ersehnten sie das Reich der Ergänzung beider: das dritte
Reich. — Es würde zu weit führen, hier näher darauf
einzugehen, inwieweit es dem Dichter gelungen ist, das
Modern-Philosophistche mit dein Historisch-Stofflichen
glücklich zu einen und auszuformen; daß er aber das Pro-
219
der Regisseur war alles. Wie aber in der neuen Architektur
die Wiederbelebung von der Innendekoration ausging,
so scheint es auch auf dem Theater sein zu sollen: Vom
Dekorativen zum geistigen Stil! Und die neue Künstlerin,
mit der der neue Typus in etwa seinen Einzug hält, ist
Hermine Körner, die bisher am Hoftheater in Dresden
tätig war und vor acht Jahren noch in Düsseldorf wirkte.
Sie trat bei Reinhardt als Elisabeth auf und verfügte für
diese Rolle über ungewöhnliche Mittel der Erscheinung
und Darstellungsgabe. In der Verkörperung vornehmer
herzloser Kälte im Bilde der Größe der Zeit erreichte sie
seltene Grade. Was die Aufführung in ihren übrigen
Partien angeht, so sei gesagt: man kann nicht irrtümlicher
vorgehen, als Schiller „modernisieren" zu wollen; man
nimmt ihm damit Seele und Geist und enthüllt seine
vermeintlichen Fehler. Er ist kein zergliedernder Jn-
dividualpsychologe — als solcher war ihm schon Kleist
weit überlegen —, er ist der Dichter großer Umrißlinien
von Ideen und Gefühlskompleren, die ein Schauspieler
entweder belebt oder ertötet durch seinen Stil.
Der hier erwähnte Zeit- und Wesensunterschied
zwischen Schiller und Kleist trat sichtlich zutage in einer
Amphitryon-Aufführung des Heinrich von Kleist im
Theater an der Königgrätzer Straße, dieser Bearbeitung
Molieres, in der der Deutsche, über den Franzosen weit
hinausgehend, den griechischen Götterspaß, der den,
Franzosen einzig Anlaß für eine echt gauloise Hahnreiposse
blieb, ins höchste sittliche Maß zu spannen suchte, ohne
des ganzen komischen Beigeschmacks, der vornehmlich in
der Diener-Sosiaß-Parallele fortlebt, zu entraten. Dabei
entwickelt er eine die Situation durchleuchtende Jndivi-
dual-Psychologie, die der Anschauungsart seiner Zeit vor-
auseilte. Man hat anläßlich dieser Aufführung wieder
die Sprache auf das Verhalten Goethes zu Kleist gebracht
und die alte Auffassung wiederholt, der Olympier habe
den preußischen Dichter nicht verstanden. Ich kann diese
Meinung nicht teilen. Die Kleistsche Psychologie liegt
auf dem Wege der modernen Entwicklungslinie und endet
über Hebbel bei Ibsen: so führt sie vom Goetheschen
Kunstziele und ungebrochenen Lebensinhalte ab. Das
muß der Grund von Goethes Verhalten gewesen sein.
Bedauerlich bleibt es natürlich, daß Goethe Kleist nicht
aufs Theater brachte und dadurch das Tragische seines
Geschicks beschleunigte.
Von hier zu Holzens „Traumulus", den man am
Bülowplatz neu einstudierte, heißt in die Niederungen
unserer Tage hinabsteigen, in denen man auf allen geisti-
gen Gebieten die Gesetze des „Organischen" mechanisch
erklären zu können glaubte. Wir erinnern uns noch der
Tage, in denen Arno Holz — es war zu Beginn der
neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts — den
„konsequenten Realismus" erfand, eine Art Dichtung-
Photographie, mit denen er die Gesetze und das letzte
Geheimnis endgültig in Händen zu haben glaubte, jedoch
nur bewies, daß er kein Dramatiker sei, wie auch dieser
„Traumulus" die tragische Gymnasiastenkomödie von
Akt zu Akt mehr erhellt. So gehört sie, trotz amüsanter
Züge, fesselnder Einzelbeobachtung und witziger Ein-
fälle neben Schiller und Kleist in die Kotzebue-Kategorie:
Kotzebue! Es wirkte fast erleichternd, als vor einem Jahr-
Reinhardt auch ihn ans Licht zog, seine Kleinstädter;
man sagte sich: aber es hat ja von jeher eine „moderne"
Kunst gegeben im Sinne des Kleine-Leute-Realismus,
auch zu Goethes Tagen, nur daß die großen Dichter sie
damals nicht für ihr Ziel erachteten und sie, wie gehörig,
den Eintags-Dichterlingen überließen, während man sie
in unseren Tagen, mit soziologischem Etikett verklebt,
als die wichtigste Errungenschaft des Jahrhunderts ausrief.
Nachdem wir in den letzten Jahren die beiden groß-
zügigen Ideendramen Ibsens, seiner mittleren Schaffens-
periode, „Brand" und „Peer Gynt", hier auf dem
Theater erlebten und unter einem Interesse des Publi-
kums, das als ein gutes Zeichen gedeutet werden konnte,
folgte im letzten Winter das Lessingtheater mit dem
welthistorischen Schauspiel der gleichen Epoche des
Dichters, das bisher seines Umfanges wegen für unaus-
führbar galt: „Kaiser und Galiläer". Setzte sich Ibsen
in „Brand" mit einem bis an die Grenze der Lebens-
verneinung reichenden religiösen Fanatismus ausein-
ander, in „Peer Gynt" nut dem Individualismus, dem
das eigene Ich das Maß aller Dinge ist, ohne daß sein
Träger den Sinn des Daseins begriffe, der ihm bei dieser
Lebensauffassung mehr und mehr entschwindet, so
könnte man sagen, daß er in diesem weltgeschichtlichen
Drama beide Seelenzustände vereint, wie sie der Ideen-
gang zweier ganzer Zeitalter umschloß, sie gegeneinander-
stellte, ablöste und über sie hinaus auf ihre glückliche
Harmonie weist. Es war in den sechziger Jahren in
Rom, als Ibsen Vorstudien zu emem Julian-Apostata-
Drama betrieb. Es lag ihm gewiß nicht daran, ein Ge-
schichtsdrama zu schreiben, als er sich in den Lebenslauf
dieses Vetters des Kaisers Konstantinus vertiefte, der
im Jahre 361 den Thron bestieg und während seiner
zwanzig Monate dauernden Negierung an Stelle des
Christentums die griechischen Altäre des Apollon wieder
aufrichten wollte und im Kampfe gegen die Perser fiel.
Doch der Jdeengang, den er seinem Drama zugrunde
legen wollte, hinderte ihn, sich eines Gegenwartstypus zu
bedienen, obgleich das Problem in seiner reinen Ge-
dankenform die Geister des letzten Jahrhunderts leb-
hafter erregt hat als zu irgendeiner Zeit, ja in diesem
Jahrhundert erst reif geworden ist. So griff der Dichter
auf jene Tage zurück, in denen eine untergehende Welt-
anschauung, von einer neuen noch nicht ganz verdrängt,
in einer Herrschergestalt noch einmal den Versuch macht,
sich wieder in ihr Recht einzusetzen. Dazu bedurfte er
eines irdisch gekrönten Hauptes, denn allein einem
solchen konnte er die Worte in den Mund legen, daß er
beide Reiche zu vereinigen strebe: das weltliche der An-
tike und das geistige des Galiläers. Es ging ihm also
nicht darum, ein Geschichtsdrama zu schreiben, aber er-
halte diesen Hintergrund für sein Ideendrama nötig,
für die Ideen eines Problems, das, wie gesagt, im letzten
Jahrhundert erst ins Bewußtsein der Denker gerückt
ist, mit der Erkenntnis, daß zwei Jahrtausende christlicher
Kultur einen Grundzug heidnisch-antiken Verlangens in
der Menschenseele nicht haben auslöschen können; so
ersehnten sie das Reich der Ergänzung beider: das dritte
Reich. — Es würde zu weit führen, hier näher darauf
einzugehen, inwieweit es dem Dichter gelungen ist, das
Modern-Philosophistche mit dein Historisch-Stofflichen
glücklich zu einen und auszuformen; daß er aber das Pro-
219