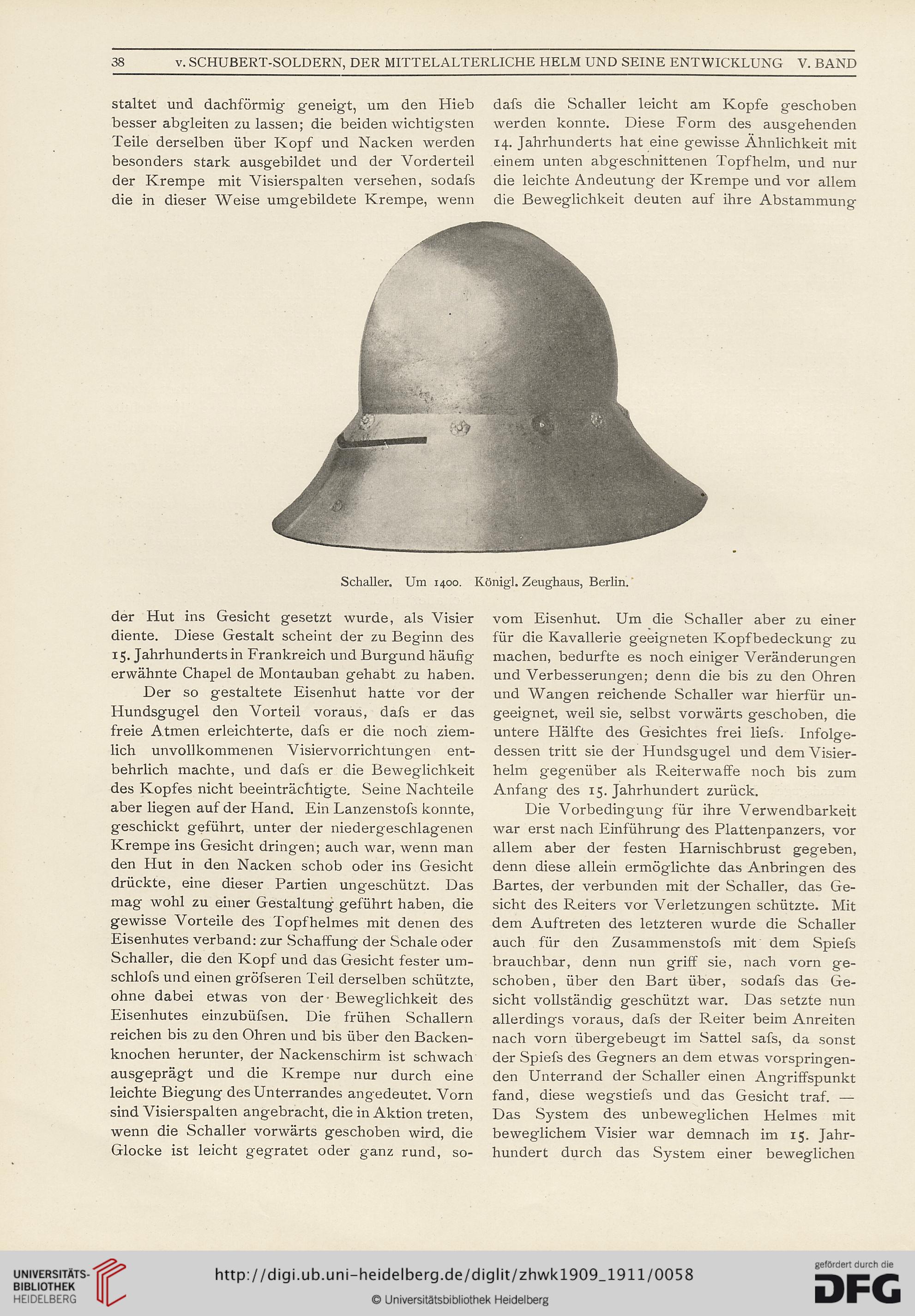38
v. SCHUBERT-SOLDERN, DER MITTELALTERLICHE HELM UND SEINE ENTWICKLUNG V. BAND
staltet und dachförmig geneigt, um den Hieb
besser abgleiten zu lassen; die beiden wichtigsten
Teile derselben über Kopf und Nacken werden
besonders stark ausgebildet und der Vorderteil
der Krempe mit Visierspalten versehen, sodafs
die in dieser Weise umgebildete Krempe, wenn
dafs die Schalter leicht am Kopfe geschoben
werden konnte. Diese Form des ausgehenden
14. Jahrhunderts hat eine gewisse Ähnlichkeit mit
einem unten abgeschnittenen Topfhelm, und nur
die leichte Andeutung der Krempe und vor allem
die Beweglichkeit deuten auf ihre Abstammung
Schallen Um 1400. Königl. Zeughaus, Berlin.
der Hut ins Gesicht gesetzt wurde, als Visier
diente. Diese Gestalt scheint der zu Beginn des
15. Jahrhunderts in Frankreich und Burgund häufig
erwähnte Chapel de Montauban gehabt Zu haben.
Der so gestaltete Eisenhut hatte vor der
Hundsgugel den Vorteil voraus, dafs er das
freie Atmen erleichterte, dafs er die noch ziem-
lich unvollkommenen Visiervorrichtungen ent-
behrlich machte, und dafs er die Beweglichkeit
des Kopfes nicht beeinträchtigte. Seine Nachteile
aber liegen auf der Hand. Ein Lanzenstofs konnte,
geschickt geführt, unter der niedergeschlagenen
Krempe ins Gesicht dringen; auch war, wenn man
den Hut in den Nacken schob oder ins Gesicht
drückte, eine dieser Partien ungeschützt. Das
mag wohl zu einer Gestaltung geführt haben, die
gewisse Vorteile des Topfhelmes mit denen des
Eisenhutes verband: zur Schaffung der Schale oder
Schaller, die den Kopf und das Gesicht fester um-
schlofs und einen gröfseren Teil derselben schützte,
ohne dabei etwas von der Beweglichkeit des
Eisenhutes einzubüfsen. Die frühen Schallern
reichen bis zu den Ohren und bis über den Backen-
knochen herunter, der Nackenschirm ist schwach
ausgeprägt und die Krempe nur durch eine
leichte Biegung des Unterrandes angedeutet. Vorn
sind Visierspalten angebracht, die in Aktion treten,
wenn die Schaller vorwärts geschoben wird, die
Glocke ist leicht gegratet oder ganz rund, so-
vom Eisenhut. Um die Schaller aber zu einer
für die Kavallerie geeigneten Kopfbedeckung zu
machen, bedurfte es noch einiger Veränderungen
und Verbesserungen; denn die bis zu den Ohren
und Wangen reichende Schaller war hierfür un-
geeignet, weil sie, selbst vorwärts geschoben, die
untere Hälfte des Gesichtes frei liefs. Infolge-
dessen tritt sie der Hundsgugel und dem Visier-
helm gegenüber als Reiterwaffe noch bis zum
Anfang des 15. Jahrhundert zurück.
Die Vorbedingung für ihre Verwendbarkeit
war erst nach Einführung des Plattenpanzers, vor
allem aber der festen Harnischbrust gegeben,
denn diese allein ermöglichte das Anbringen des
Bartes, der verbunden mit der Schaller, das Ge-
sicht des Reiters vor Verletzungen schützte. Mit
dem Auftreten des letzteren wurde die Schaller
auch für den Zusammenstofs mit dem Spiefs
brauchbar, denn nun griff sie, nach vorn ge-
schoben, über den Bart über, sodafs das Ge-
sicht vollständig geschützt war. Das setzte nun
allerdings voraus, dafs der Reiter beim Anreiten
nach vorn übergebeugt im Sattel safs, da sonst
der Spiefs des Gegners an dem etwas vorspringen-
den Unterrand der Schaller einen Angriffspunkt
fand, diese wegstiefs und das Gesicht traf. —
Das System des unbeweglichen Helmes mit
beweglichem Visier war demnach im 15. Jahr-
hundert durch das System einer beweglichen
v. SCHUBERT-SOLDERN, DER MITTELALTERLICHE HELM UND SEINE ENTWICKLUNG V. BAND
staltet und dachförmig geneigt, um den Hieb
besser abgleiten zu lassen; die beiden wichtigsten
Teile derselben über Kopf und Nacken werden
besonders stark ausgebildet und der Vorderteil
der Krempe mit Visierspalten versehen, sodafs
die in dieser Weise umgebildete Krempe, wenn
dafs die Schalter leicht am Kopfe geschoben
werden konnte. Diese Form des ausgehenden
14. Jahrhunderts hat eine gewisse Ähnlichkeit mit
einem unten abgeschnittenen Topfhelm, und nur
die leichte Andeutung der Krempe und vor allem
die Beweglichkeit deuten auf ihre Abstammung
Schallen Um 1400. Königl. Zeughaus, Berlin.
der Hut ins Gesicht gesetzt wurde, als Visier
diente. Diese Gestalt scheint der zu Beginn des
15. Jahrhunderts in Frankreich und Burgund häufig
erwähnte Chapel de Montauban gehabt Zu haben.
Der so gestaltete Eisenhut hatte vor der
Hundsgugel den Vorteil voraus, dafs er das
freie Atmen erleichterte, dafs er die noch ziem-
lich unvollkommenen Visiervorrichtungen ent-
behrlich machte, und dafs er die Beweglichkeit
des Kopfes nicht beeinträchtigte. Seine Nachteile
aber liegen auf der Hand. Ein Lanzenstofs konnte,
geschickt geführt, unter der niedergeschlagenen
Krempe ins Gesicht dringen; auch war, wenn man
den Hut in den Nacken schob oder ins Gesicht
drückte, eine dieser Partien ungeschützt. Das
mag wohl zu einer Gestaltung geführt haben, die
gewisse Vorteile des Topfhelmes mit denen des
Eisenhutes verband: zur Schaffung der Schale oder
Schaller, die den Kopf und das Gesicht fester um-
schlofs und einen gröfseren Teil derselben schützte,
ohne dabei etwas von der Beweglichkeit des
Eisenhutes einzubüfsen. Die frühen Schallern
reichen bis zu den Ohren und bis über den Backen-
knochen herunter, der Nackenschirm ist schwach
ausgeprägt und die Krempe nur durch eine
leichte Biegung des Unterrandes angedeutet. Vorn
sind Visierspalten angebracht, die in Aktion treten,
wenn die Schaller vorwärts geschoben wird, die
Glocke ist leicht gegratet oder ganz rund, so-
vom Eisenhut. Um die Schaller aber zu einer
für die Kavallerie geeigneten Kopfbedeckung zu
machen, bedurfte es noch einiger Veränderungen
und Verbesserungen; denn die bis zu den Ohren
und Wangen reichende Schaller war hierfür un-
geeignet, weil sie, selbst vorwärts geschoben, die
untere Hälfte des Gesichtes frei liefs. Infolge-
dessen tritt sie der Hundsgugel und dem Visier-
helm gegenüber als Reiterwaffe noch bis zum
Anfang des 15. Jahrhundert zurück.
Die Vorbedingung für ihre Verwendbarkeit
war erst nach Einführung des Plattenpanzers, vor
allem aber der festen Harnischbrust gegeben,
denn diese allein ermöglichte das Anbringen des
Bartes, der verbunden mit der Schaller, das Ge-
sicht des Reiters vor Verletzungen schützte. Mit
dem Auftreten des letzteren wurde die Schaller
auch für den Zusammenstofs mit dem Spiefs
brauchbar, denn nun griff sie, nach vorn ge-
schoben, über den Bart über, sodafs das Ge-
sicht vollständig geschützt war. Das setzte nun
allerdings voraus, dafs der Reiter beim Anreiten
nach vorn übergebeugt im Sattel safs, da sonst
der Spiefs des Gegners an dem etwas vorspringen-
den Unterrand der Schaller einen Angriffspunkt
fand, diese wegstiefs und das Gesicht traf. —
Das System des unbeweglichen Helmes mit
beweglichem Visier war demnach im 15. Jahr-
hundert durch das System einer beweglichen