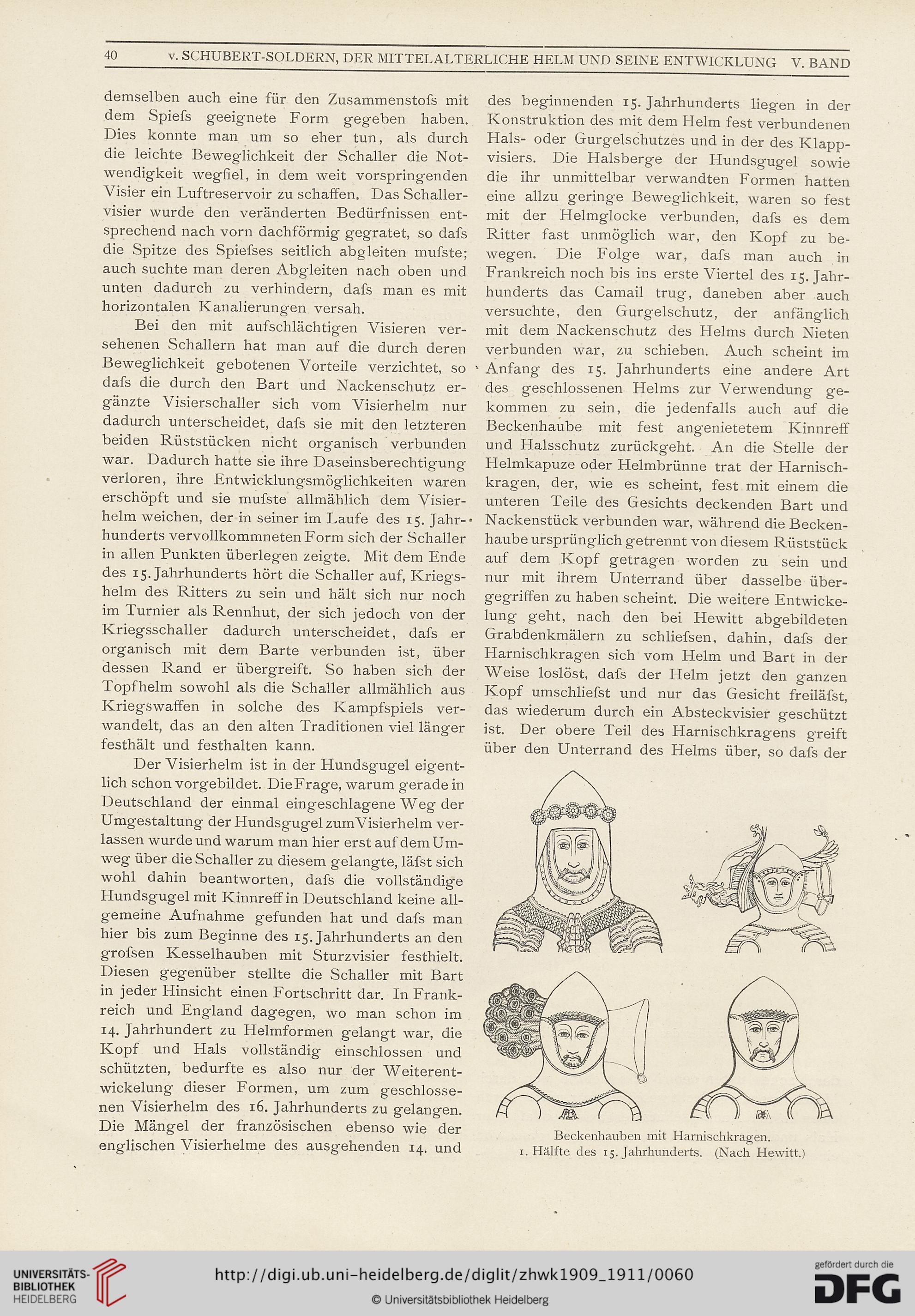40
v. SCHUBERT-SOLDERN, DER MITTELALTERLICHE HELM UND SEINE ENTWICKLUNG V. BAND
demselben auch eine für den Zusammenstofs mit
dem Spiefs geeignete Form gegeben haben.
Dies konnte man um so eher tun, als durch
die leichte Beweglichkeit der Schaller die Not-
wendigkeit wegfiel, in dem weit vorspringenden
Visier ein Luftreservoir zu schaffen. Das Schaller-
visier wurde den veränderten Bedürfnissen ent-
sprechend nach vorn dachförmig gegratet, so dafs
die Spitze des Spiefses seitlich abgleiten mufste;
auch suchte man deren Abgleiten nach oben und
unten dadurch zu verhindern, dafs man es mit
horizontalen Kanalierungen versah.
Bei den mit aufschlächtigen Visieren ver-
sehenen Schallern hat man auf die durch deren
Beweglichkeit gebotenen Vorteile verzichtet, so
dafs die durch den Bart und Nackenschutz er-
gänzte Visierschaller sich vom Visierhelm nur
dadurch unterscheidet, dafs sie mit den letzteren
beiden Rüststücken nicht organisch verbunden
war. Dadurch hatte sie ihre Daseinsberechtigung
verloren, ihre Entwicklungsmöglichkeiten waren
erschöpft und sie mufste allmählich dem Visier-
helm weichen, der in seiner im Laufe des 15. Jahr-*
hunderts vervollkommneten Form sich der Schaller
in allen Punkten überlegen zeigte. Mit dem Ende
des 15. Jahrhunderts hört die Schaller auf, Kriegs-
helm des Ritters zu sein und hält sich nur noch
im Turnier als Rennhut, der sich jedoch von der
Kriegsschaller dadurch unterscheidet, dafs er
organisch mit dem Barte verbunden ist, über
dessen Rand er übergreift. So haben sich der
Topfhelm sowohl als die Schaller allmählich aus
Kriegswaffen in solche des Kampfspiels ver-
wandelt, das an den alten Traditionen viel länger
festhält und festhalten kann.
Der Visierhelm ist in der Hundsgugel eigent-
lich schon vorgebildet. Die Frage, warum gerade in
Deutschland der einmal eingeschlagene Weg der
Umgestaltung der Hundsgugel zumVisierhelm ver-
lassen wurde und warum man hier erst auf dem Um-
weg über die Schaller zu diesem gelangte, läfst sich
wohl dahin beantworten, dafs die vollständige
Hundsgugel mit Kinnreff in Deutschland keine all-
gemeine Aufnahme gefunden hat und dafs man
hier bis zum Beginne des 15. Jahrhunderts an den
grofsen Kesselhauben mit Sturzvisier festhielt.
Diesen gegenüber stellte die Schaller mit Bart
in jeder Hinsicht einen Fortschritt dar. In Frank-
reich und England dagegen, wo man schon im
14. Jahrhundert zu Helmformen gelangt war, die
Kopf und Hals vollständig einschlossen und
schützten, bedurfte es also nur der Weiterent-
wickelung dieser Formen, um zum geschlosse-
nen Visierhelm des 16. Jahrhunderts zu gelangen.
Die Mängel der französischen ebenso wie der
englischen Visierhelme des ausgehenden 14. und
des beginnenden 15. Jahrhunderts liegen in der
Konstruktion des mit dem Helm fest verbundenen
Hals- oder Gurgelschutzes und in der des Klapp-
visiers. Die Halsberge der Hundsgugel sowie
die ihr unmittelbar verwandten Formen hatten
eine allzu geringe Beweglichkeit, waren so fest
mit der Helmglocke verbunden, dafs es dem
Ritter fast unmöglich war, den Kopf zu be-
wegen. Die Folge war, dafs man auch in
Frankreich noch bis ins erste Viertel des 15. Jahr-
hunderts das Camail trug, daneben aber auch
versuchte, den Gurgelschutz, der anfänglich
mit dem Nackenschutz des Helms durch Nieten
verbunden war, zu schieben. Auch scheint im
Anfang des 15. Jahrhunderts eine andere Art
des geschlossenen Helms zur Verwendung ge-
kommen zu sein, die jedenfalls auch auf die
Beckenhaube mit fest angenietetem Kinnreff
und Halsschutz zurückgeht. An die Stelle der
LIelmkapuze oder Helmbrünne trat der Harnisch-
kragen, der, wie es scheint, fest mit einem die
unteren Teile des Gesichts deckenden Bart und
Nackenstück verbunden war, während die Becken-
haube ursprünglich getrennt von diesem Rüststück
auf dem Kopf getragen worden zu sein und
nur mit ihrem Unterrand über dasselbe über-
gegriffen zu haben scheint. Die weitere Entwicke-
lung geht, nach den bei Hewitt abgebildeten
Grabdenkmälern zu schliefsen, dahin, dafs der
Harnischkragen sich vom Helm und Bart in der
Weise loslöst, dafs der Helm jetzt den ganzen
Kopf umschliefst und nur das Gesicht freiläfst,
das wiederum durch ein Absteckvisier geschützt
ist. Der obere Teil des Harnischkragens greift
über den Unterrand des Helms über, so dafs der
Beckenhauben mit Harnischkragen.
1. Hälfte des 15. Jahrhunderts. (Nach Hewitt.)
v. SCHUBERT-SOLDERN, DER MITTELALTERLICHE HELM UND SEINE ENTWICKLUNG V. BAND
demselben auch eine für den Zusammenstofs mit
dem Spiefs geeignete Form gegeben haben.
Dies konnte man um so eher tun, als durch
die leichte Beweglichkeit der Schaller die Not-
wendigkeit wegfiel, in dem weit vorspringenden
Visier ein Luftreservoir zu schaffen. Das Schaller-
visier wurde den veränderten Bedürfnissen ent-
sprechend nach vorn dachförmig gegratet, so dafs
die Spitze des Spiefses seitlich abgleiten mufste;
auch suchte man deren Abgleiten nach oben und
unten dadurch zu verhindern, dafs man es mit
horizontalen Kanalierungen versah.
Bei den mit aufschlächtigen Visieren ver-
sehenen Schallern hat man auf die durch deren
Beweglichkeit gebotenen Vorteile verzichtet, so
dafs die durch den Bart und Nackenschutz er-
gänzte Visierschaller sich vom Visierhelm nur
dadurch unterscheidet, dafs sie mit den letzteren
beiden Rüststücken nicht organisch verbunden
war. Dadurch hatte sie ihre Daseinsberechtigung
verloren, ihre Entwicklungsmöglichkeiten waren
erschöpft und sie mufste allmählich dem Visier-
helm weichen, der in seiner im Laufe des 15. Jahr-*
hunderts vervollkommneten Form sich der Schaller
in allen Punkten überlegen zeigte. Mit dem Ende
des 15. Jahrhunderts hört die Schaller auf, Kriegs-
helm des Ritters zu sein und hält sich nur noch
im Turnier als Rennhut, der sich jedoch von der
Kriegsschaller dadurch unterscheidet, dafs er
organisch mit dem Barte verbunden ist, über
dessen Rand er übergreift. So haben sich der
Topfhelm sowohl als die Schaller allmählich aus
Kriegswaffen in solche des Kampfspiels ver-
wandelt, das an den alten Traditionen viel länger
festhält und festhalten kann.
Der Visierhelm ist in der Hundsgugel eigent-
lich schon vorgebildet. Die Frage, warum gerade in
Deutschland der einmal eingeschlagene Weg der
Umgestaltung der Hundsgugel zumVisierhelm ver-
lassen wurde und warum man hier erst auf dem Um-
weg über die Schaller zu diesem gelangte, läfst sich
wohl dahin beantworten, dafs die vollständige
Hundsgugel mit Kinnreff in Deutschland keine all-
gemeine Aufnahme gefunden hat und dafs man
hier bis zum Beginne des 15. Jahrhunderts an den
grofsen Kesselhauben mit Sturzvisier festhielt.
Diesen gegenüber stellte die Schaller mit Bart
in jeder Hinsicht einen Fortschritt dar. In Frank-
reich und England dagegen, wo man schon im
14. Jahrhundert zu Helmformen gelangt war, die
Kopf und Hals vollständig einschlossen und
schützten, bedurfte es also nur der Weiterent-
wickelung dieser Formen, um zum geschlosse-
nen Visierhelm des 16. Jahrhunderts zu gelangen.
Die Mängel der französischen ebenso wie der
englischen Visierhelme des ausgehenden 14. und
des beginnenden 15. Jahrhunderts liegen in der
Konstruktion des mit dem Helm fest verbundenen
Hals- oder Gurgelschutzes und in der des Klapp-
visiers. Die Halsberge der Hundsgugel sowie
die ihr unmittelbar verwandten Formen hatten
eine allzu geringe Beweglichkeit, waren so fest
mit der Helmglocke verbunden, dafs es dem
Ritter fast unmöglich war, den Kopf zu be-
wegen. Die Folge war, dafs man auch in
Frankreich noch bis ins erste Viertel des 15. Jahr-
hunderts das Camail trug, daneben aber auch
versuchte, den Gurgelschutz, der anfänglich
mit dem Nackenschutz des Helms durch Nieten
verbunden war, zu schieben. Auch scheint im
Anfang des 15. Jahrhunderts eine andere Art
des geschlossenen Helms zur Verwendung ge-
kommen zu sein, die jedenfalls auch auf die
Beckenhaube mit fest angenietetem Kinnreff
und Halsschutz zurückgeht. An die Stelle der
LIelmkapuze oder Helmbrünne trat der Harnisch-
kragen, der, wie es scheint, fest mit einem die
unteren Teile des Gesichts deckenden Bart und
Nackenstück verbunden war, während die Becken-
haube ursprünglich getrennt von diesem Rüststück
auf dem Kopf getragen worden zu sein und
nur mit ihrem Unterrand über dasselbe über-
gegriffen zu haben scheint. Die weitere Entwicke-
lung geht, nach den bei Hewitt abgebildeten
Grabdenkmälern zu schliefsen, dahin, dafs der
Harnischkragen sich vom Helm und Bart in der
Weise loslöst, dafs der Helm jetzt den ganzen
Kopf umschliefst und nur das Gesicht freiläfst,
das wiederum durch ein Absteckvisier geschützt
ist. Der obere Teil des Harnischkragens greift
über den Unterrand des Helms über, so dafs der
Beckenhauben mit Harnischkragen.
1. Hälfte des 15. Jahrhunderts. (Nach Hewitt.)