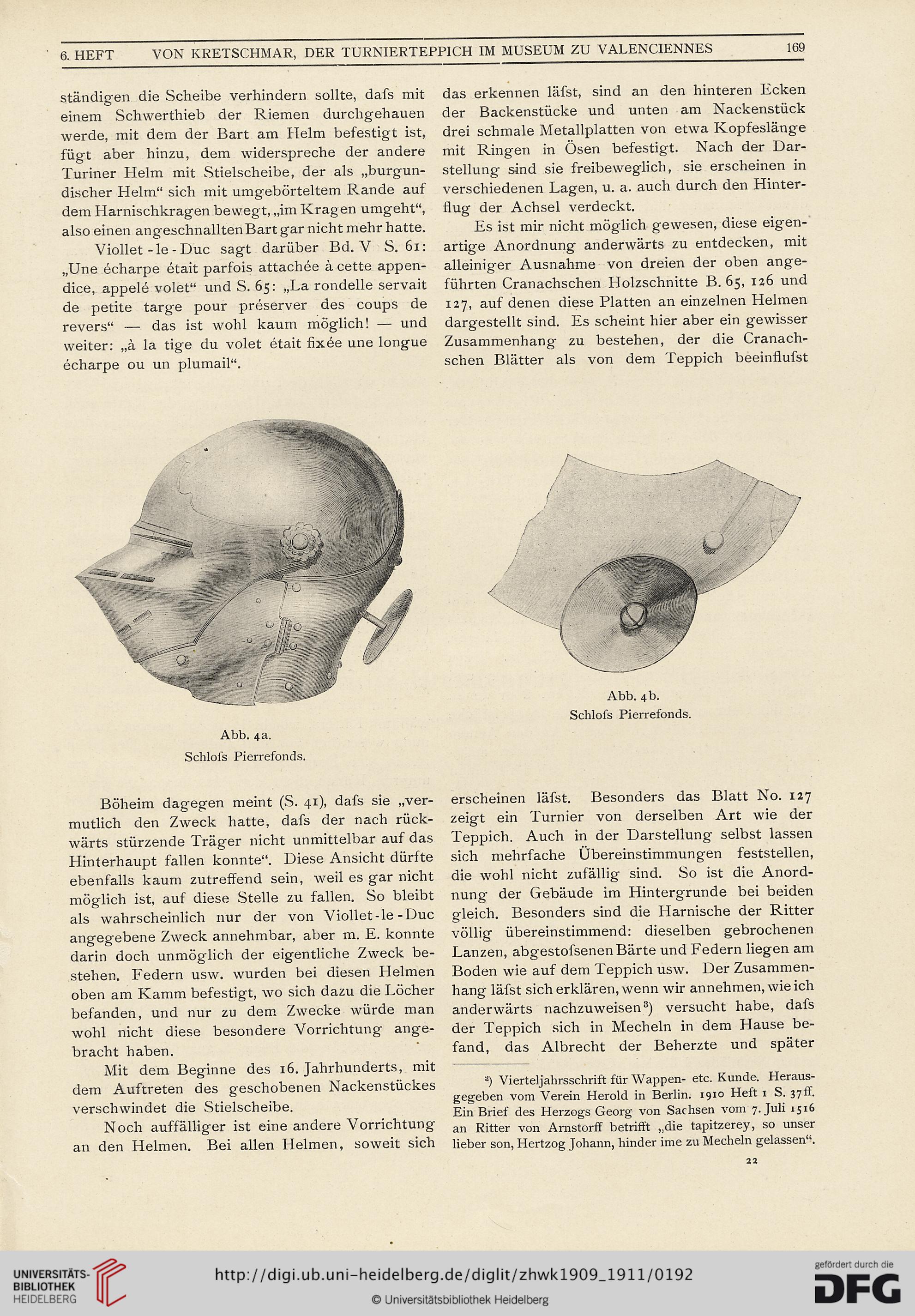6. HEFT
VON KRETSCHMAR, DER TURNIERTEPPICH IM MUSEUM ZU VALENCIENNES
169
ständigen die Scheibe verhindern sollte, dafs mit
einem Schwerthieb der Riemen durchgehauen
werde, mit dem der Bart am Helm befestigt ist,
fügt aber hinzu, dem widerspreche der andere
Turiner Helm mit Stielscheibe, der als „burgun-
discher Helm“ sich mit umgebörteltem Rande auf
dem Harnischkragen bewegt, „im Kragen umgeht“,
also einen angeschnallten Bart gar nicht mehr hatte.
Viollet-le-Duc sagt darüber Bd. V S. 61:
„Une echarpe etait parfois attachee ä cette appen-
dice, appele volet“ und S. 65: „La rondelle servait
de petite targe pour preserver des coups de
revers“ — das ist wohl kaum möglich! — und
weiter: „ä la tige du volet etait fixee une longue
echarpe ou un plumail“.
Abb. 4 a.
Schlofs Pierrefonds.
Böheim dagegen meint (S. 41), dafs sie „ver-
mutlich den Zweck hatte, dafs der nach rück-
wärts stürzende Träger nicht unmittelbar auf das
Hinterhaupt fallen konnte“. Diese Ansicht dürfte
ebenfalls kaum zutreffend sein, weil es gar nicht
möglich ist, auf diese Stelle zu fallen. So bleibt
als wahrscheinlich nur der von Viollet-le-Duc
angegebene Zweck annehmbar, aber m. E. konnte
darin doch unmöglich der eigentliche Zweck be-
stehen. Federn usw. wurden bei diesen Helmen
oben am Kamm befestigt, wo sich dazu die Löcher
befanden, und nur zu dem Zwecke würde man
wohl nicht diese besondere Vorrichtung ange-
bracht haben.
Mit dem Beginne des 16. Jahrhunderts, mit
dem Auftreten des geschobenen Nackenstückes
verschwindet die Stielscheibe.
Noch auffälliger ist eine andere Vorrichtung
an den Helmen. Bei allen Helmen, soweit sich
das erkennen läfst, sind an den hinteren Ecken
der Backenstücke und unten am Nackenstück
drei schmale Metallplatten von etwa Kopfeslänge
mit Ringen in Ösen befestigt. Nach der Dar-
stellung sind sie freibeweglich, sie erscheinen in
verschiedenen Lagen, u. a. auch durch den Hinter-
flug der Achsel verdeckt.
Es ist mir nicht möglich gewesen, diese eigen-
artige Anordnung anderwärts zu entdecken, mit
alleiniger Ausnahme von dreien der oben ange-
führten Cranachschen Holzschnitte B. 65, 126 und
127, auf denen diese Platten an einzelnen Helmen
dargestellt sind. Es scheint hier aber ein gewisser
Zusammenhang zu bestehen, der die Cranach-
schen Blätter als von dem Teppich beeinflufst
Abb. 4 b.
Schlofs Pierrefonds.
erscheinen läfst. Besonders das Blatt No. 127
zeigt ein Turnier von derselben Art wie der
Teppich. Auch in der Darstellung selbst lassen
sich mehrfache Übereinstimmungen feststellen,
die wohl nicht zufällig sind. So ist die Anord-
nung der Gebäude im Hintergründe bei beiden
gleich. Besonders sind die Harnische der Ritter
völlig übereinstimmend: dieselben gebrochenen
Lanzen, abgestofsenen Bärte und Federn liegen am
Boden wie auf dem Teppich usw. Der Zusammen-
hang läfst sich erklären, wenn wir annehmen, wie ich
anderwärts nachzuweisen8) versucht habe, dafs
der Teppich sich in Mecheln in dem Hause be-
fand, das Albrecht der Beherzte und später
3) Vierteljahrsschrift für Wappen- etc. Kunde. Heraus-
gegeben vom Verein Herold in Berlin. 1910 Heft 1 S. 37ff.
Ein Brief des Herzogs Georg von Sachsen vom 7. Juli 1516
an Ritter von Arnstorff betrifft „die tapitzerey, so unser
lieber son, Hertzog Johann, hinder ime zu Mecheln gelassen“.
IX
VON KRETSCHMAR, DER TURNIERTEPPICH IM MUSEUM ZU VALENCIENNES
169
ständigen die Scheibe verhindern sollte, dafs mit
einem Schwerthieb der Riemen durchgehauen
werde, mit dem der Bart am Helm befestigt ist,
fügt aber hinzu, dem widerspreche der andere
Turiner Helm mit Stielscheibe, der als „burgun-
discher Helm“ sich mit umgebörteltem Rande auf
dem Harnischkragen bewegt, „im Kragen umgeht“,
also einen angeschnallten Bart gar nicht mehr hatte.
Viollet-le-Duc sagt darüber Bd. V S. 61:
„Une echarpe etait parfois attachee ä cette appen-
dice, appele volet“ und S. 65: „La rondelle servait
de petite targe pour preserver des coups de
revers“ — das ist wohl kaum möglich! — und
weiter: „ä la tige du volet etait fixee une longue
echarpe ou un plumail“.
Abb. 4 a.
Schlofs Pierrefonds.
Böheim dagegen meint (S. 41), dafs sie „ver-
mutlich den Zweck hatte, dafs der nach rück-
wärts stürzende Träger nicht unmittelbar auf das
Hinterhaupt fallen konnte“. Diese Ansicht dürfte
ebenfalls kaum zutreffend sein, weil es gar nicht
möglich ist, auf diese Stelle zu fallen. So bleibt
als wahrscheinlich nur der von Viollet-le-Duc
angegebene Zweck annehmbar, aber m. E. konnte
darin doch unmöglich der eigentliche Zweck be-
stehen. Federn usw. wurden bei diesen Helmen
oben am Kamm befestigt, wo sich dazu die Löcher
befanden, und nur zu dem Zwecke würde man
wohl nicht diese besondere Vorrichtung ange-
bracht haben.
Mit dem Beginne des 16. Jahrhunderts, mit
dem Auftreten des geschobenen Nackenstückes
verschwindet die Stielscheibe.
Noch auffälliger ist eine andere Vorrichtung
an den Helmen. Bei allen Helmen, soweit sich
das erkennen läfst, sind an den hinteren Ecken
der Backenstücke und unten am Nackenstück
drei schmale Metallplatten von etwa Kopfeslänge
mit Ringen in Ösen befestigt. Nach der Dar-
stellung sind sie freibeweglich, sie erscheinen in
verschiedenen Lagen, u. a. auch durch den Hinter-
flug der Achsel verdeckt.
Es ist mir nicht möglich gewesen, diese eigen-
artige Anordnung anderwärts zu entdecken, mit
alleiniger Ausnahme von dreien der oben ange-
führten Cranachschen Holzschnitte B. 65, 126 und
127, auf denen diese Platten an einzelnen Helmen
dargestellt sind. Es scheint hier aber ein gewisser
Zusammenhang zu bestehen, der die Cranach-
schen Blätter als von dem Teppich beeinflufst
Abb. 4 b.
Schlofs Pierrefonds.
erscheinen läfst. Besonders das Blatt No. 127
zeigt ein Turnier von derselben Art wie der
Teppich. Auch in der Darstellung selbst lassen
sich mehrfache Übereinstimmungen feststellen,
die wohl nicht zufällig sind. So ist die Anord-
nung der Gebäude im Hintergründe bei beiden
gleich. Besonders sind die Harnische der Ritter
völlig übereinstimmend: dieselben gebrochenen
Lanzen, abgestofsenen Bärte und Federn liegen am
Boden wie auf dem Teppich usw. Der Zusammen-
hang läfst sich erklären, wenn wir annehmen, wie ich
anderwärts nachzuweisen8) versucht habe, dafs
der Teppich sich in Mecheln in dem Hause be-
fand, das Albrecht der Beherzte und später
3) Vierteljahrsschrift für Wappen- etc. Kunde. Heraus-
gegeben vom Verein Herold in Berlin. 1910 Heft 1 S. 37ff.
Ein Brief des Herzogs Georg von Sachsen vom 7. Juli 1516
an Ritter von Arnstorff betrifft „die tapitzerey, so unser
lieber son, Hertzog Johann, hinder ime zu Mecheln gelassen“.
IX