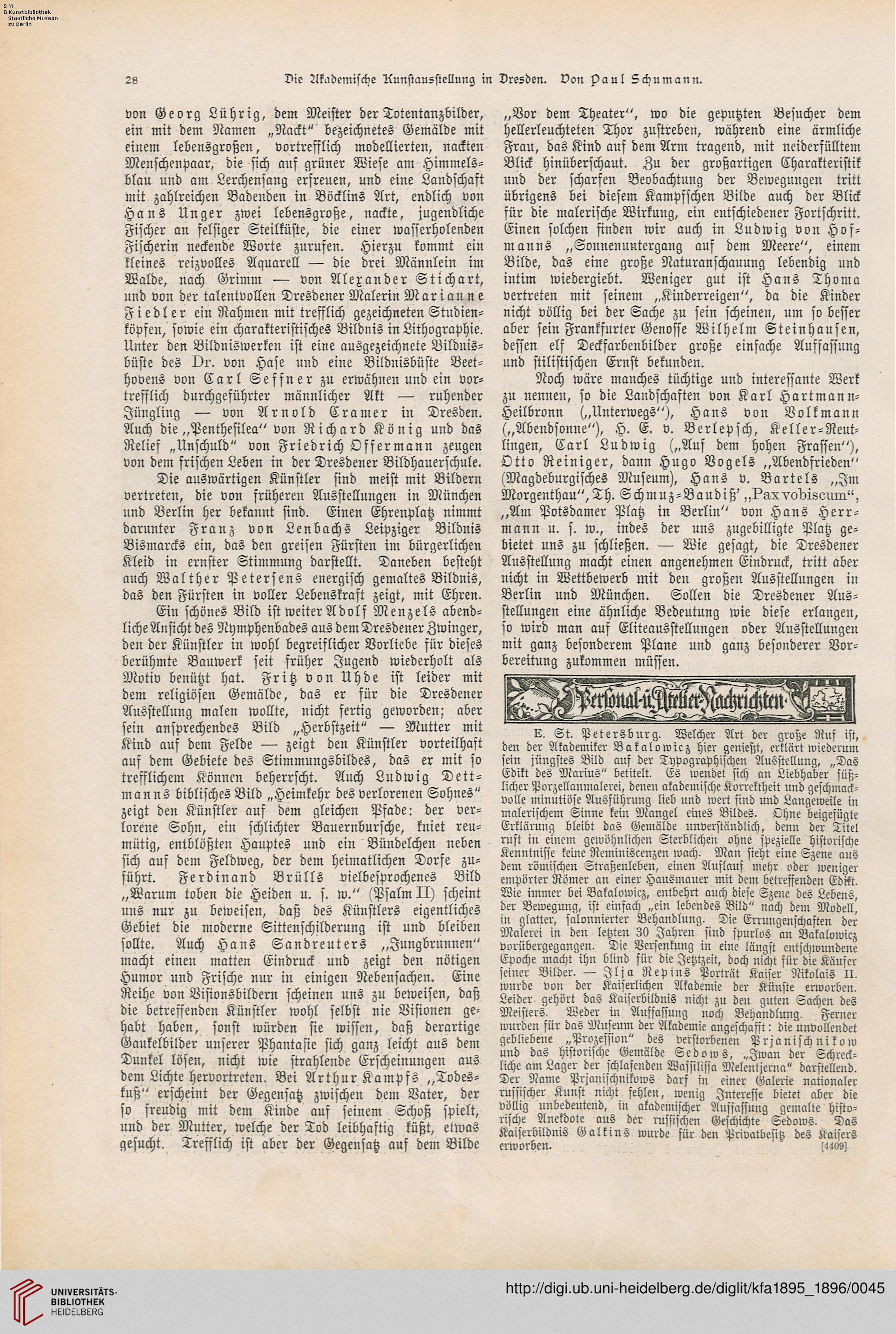28
Die Akademische Kunstausstellung in Dresden, von Paul Schumann.
von Georg Lührig, dem Meister der Totentanzbilder,
ein mit dem Namen „Nackt" bezeichnetes Gemälde mit
einem lebensgroßen, vortrefflich modellierten, nackten
Menschenpaar, die sich auf grüner Wiese am Himmels-
blau und am Lerchensang erfreuen, und eine Landschaft
mit zahlreichen Badenden in Böcklins Art, endlich von
Hans Unger zwei lebensgroße, nackte, jugendliche
Fischer an felsiger Steilküste, die einer wasserholenden
Fischerin neckende Worte zurufen. Hierzu kommt ein
kleines reizvolles Aquarell — die drei Männlein im
Walde, nach Grimm — von Alexander Stichart,
und von der talentvollen Dresdener Malerin Marianne
Fiedler ein Rahmen mit trefflich gezeichneten Studien-
köpfen, sowie ein charakteristisches Bildnis in Lithographie.
Unter den Bildniswerken ist eine ausgezeichnete Bildnis-
büste des Du. von Hase und eine Bildnisbüste Beet-
hovens von Carl Seffner zu erwähnen und ein vor-
trefflich durchgeführter männlicher Akt — ruhender
Jüngling — von Arnold Cramer in Dresden.
Auch die „Penthesilea" von Richard König und das
Relief „Unschuld" von Friedrich Offermann zeugen
von dem frischen Leben in der Dresdener Bildhauerschule.
Die auswärtigen Künstler sind meist mit Bildern
vertreten, die von früheren Ausstellungen in München
und Berlin her bekannt sind. Einen Ehrenplatz nimmt
darunter Franz von Lenbachs Leipziger Bildnis
Bismarcks ein, das den greisen Fürsten im bürgerlichen
Kleid in ernster Stimmung darstellt. Daneben besteht
auch Walther Petersens energisch gemaltes Bildnis,
das den Fürsten in voller Lebenskraft zeigt, mit Ehren.
Ein schönes Bild ist weiter Adolf Menzels abend-
liche Ansicht des Nymphenbades aus dem Dresdener Zwinger,
den der Künstler in wohl begreiflicher Vorliebe für dieses
berühmte Bauwerk seit früher Jugend wiederholt als
Motiv benützt hat. Fritz von Uhde ist leider mit
dem religiösen Gemälde, das er für die Dresdener
Ausstellung malen wollte, nicht fertig geworden; aber
sein ansprechendes Bild „Herbstzeit" — Mutter mit
Kind auf dem Felde — zeigt den Künstler vorteilhaft
auf dem Gebiete des Stimmungsbildes, das er mit so
trefflichem Können beherrscht. Auch Ludwig Dett-
manns biblisches Bild „Heimkehr des verlorenen Sohnes"
zeigt den Künstler auf dem gleichen Pfade: der ver-
lorene Sohn, ein schlichter Bauernbursche, kniet reu-
mütig, entblößten Hauptes und ein Bündelchen neben
sich auf dem Feldweg, der dem heimatlichen Dorfe zu-
führt. Ferdinand Brülls vielbesprochenes Bild
„Warum toben die Heiden u. s. w." (Psalm II) scheint
uns nur zu beweisen, daß des Künstlers eigentliches
Gebiet die moderne Sittenschilderung ist und bleiben
sollte. Auch Hans Sandreuters „Jungbrunnen"
macht einen matten Eindruck und zeigt den nötigen
Humor und Frische nur in einigen Nebensachen. Eine
Reihe von Visionsbildern scheinen uns zu beweisen, daß
die betreffenden Künstler wohl selbst nie Visionen ge-
habt haben, sonst würden sie wissen, daß derartige
Gaukelbilder unserer Phantasie sich ganz leicht aus dem
Dunkel lösen, nicht wie strahlende Erscheinungen aus
dem Lichte hervortreten. Bei Arthur Kampfs „Todes-
kuß" erscheint der Gegensatz zwischen dem Vater, der
so freudig mit dem Kinde auf seinem Schoß spielt,
und der Mutter, welche der Tod leibhaftig küßt, etwas
gesucht. Trefflich ist aber der Gegensatz auf dem Bilde
„Vor dem Theater", wo die geputzten Besucher dem
hellerleuchteten Thor zustreben, während eine ärmliche
Frau, das Kind auf dem Arm tragend, mit neiderfülltem
Blick hinüberschaut. Zu der großartigen Charakteristik
und der scharfen Beobachtung der Bewegungen tritt
übrigens bei diesem Kampfschen Bilde auch der Blick
für die malerische Wirkung, ein entschiedener Fortschritt.
Einen solchen finden wir auch in Ludwig von Hof-
manns „Sonnenuntergang auf dem Meere", einem
Bilde, das eine große Naturanschauung lebendig und
intim wiedergiebt. Weniger gut ist Hans Thoma
vertreten mit seinem „Kinderreigen", da die Kinder
nicht völlig bei der Sache zu sein scheinen, um so besser
aber sein Frankfurter Genosse Wilhelm Steinhaufen,
dessen elf Deckfarbenbilder große einfache Auffassung
und stilistischen Ernst bekunden.
Noch wäre manches tüchtige und interessante Werk
zu nennen, so die Landschaften von Karl Hartmann-
Heilbronn („Unterwegs"), Hans von Volkmann
(„Abendsonne"), H. E. v. Berlepsch, Keller-Reut-
lingen, Carl Ludwig („Auf dem hohen Fraffen"),
Otto Reiniger, dann Hugo Vogels „Abendfrieden"
(Magdeburgisches Museum), Hans v. Bartels „Im
Morgenthau", Th. Schmuz-Baudiß' „kg-xvostisoiim",
„Am Potsdamer Platz in Berlin" von Hans Herr-
mann u. s. w., indes der uns zugebilligte Platz ge-
bietet uns zu schließen. — Wie gesagt, die Dresdener
Ausstellung macht einen angenehmen Eindruck, tritt aber
nicht in Wettbewerb mit den großen Ausstellungen in
Berlin und München. Sollen die Dresdener Aus-
stellungen eine ähnliche Bedeutung wie diese erlangen,
so wird man auf Eliteausstellungen oder Ausstellungen
mit ganz besonderem Plane und ganz besonderer Vor-
bereitung zukommen müssen.
L. St. Petersburg. Welcher Art der große Ruf ist,
den der Akademiker Bakalowicz hier genießt, erklärt wiederum
sein jüngstes Bild auf der Typographischen Ausstellung, „Das
Edikt des Marius" betitelt. Es wendet sich an Liebhaber süß-
licher Porzellanmalerei, denen akademische Korrektheit und geschmack-
volle minutiöse Ausführung lieb und wert sind und Langeweile in
malerischem Sinne kein Mangel eines Bildes. Ohne beigefügte
Erklärung bleibt das Gemälde unverständlich, denn der Titel
ruft in einem gewöhnlichen Sterblichen ohne spezielle historische
Kenntnisse keine Reminiscenzen wach. Man sieht eine Szene aus
dem römischen Straßenleben, einen Auflauf mehr oder weniger
empörter Römer an einer Hausmauer mit dem betreffenden Edikt.
Wie immer bei Bakalowicz, entbehrt auch diese Szene des Lebens,
der Bewegung, ist einfach „ein lebendes Bild" nach dem Modell'
in glatter, salonnierter Behandlung. Die Errungenschaften der
Malerei in den letzten 30 Jahren sind spurlos an Bakalowicz
vorübergegangen. Die Versenkung in eine längst entschwundene
Epoche macht ihn blind für die Jetztzeit, doch nicht für die Käufer
seiner Bilder. — Jlja Repins Porträt Kaiser Nikolais II.
wurde von der Kaiserlichen Akademie der Künste erworben.
Leider gehört das Kaiserbildnis nicht zu den guten Sachen des
Meisters. Weder in Auffassung noch Behandlung. Ferner
wurden für das Museum der Akademie angeschafft: die unvollendet
gebliebene „Prozession" des verstorbenen P rjanisch ni kow
und das historische Gemälde Sedows, „Iwan der Schreck-
liche am Lager der schlafenden Wassilisja Melentjerna" darstellend.
Der Name Prjanischnikows darf in einer Galerie nationaler
russischer Kunst nicht fehlen, wenig Interesse bietet aber die
völlig unbedeutend, in akademischer Auffassung gemalte histo-
rische Anekdote aus der russischen Geschichte Sedows. Das
Kaiserbildnis Galkins wurde für den Privatbesitz des Kaisers
erworben. liiosi
Die Akademische Kunstausstellung in Dresden, von Paul Schumann.
von Georg Lührig, dem Meister der Totentanzbilder,
ein mit dem Namen „Nackt" bezeichnetes Gemälde mit
einem lebensgroßen, vortrefflich modellierten, nackten
Menschenpaar, die sich auf grüner Wiese am Himmels-
blau und am Lerchensang erfreuen, und eine Landschaft
mit zahlreichen Badenden in Böcklins Art, endlich von
Hans Unger zwei lebensgroße, nackte, jugendliche
Fischer an felsiger Steilküste, die einer wasserholenden
Fischerin neckende Worte zurufen. Hierzu kommt ein
kleines reizvolles Aquarell — die drei Männlein im
Walde, nach Grimm — von Alexander Stichart,
und von der talentvollen Dresdener Malerin Marianne
Fiedler ein Rahmen mit trefflich gezeichneten Studien-
köpfen, sowie ein charakteristisches Bildnis in Lithographie.
Unter den Bildniswerken ist eine ausgezeichnete Bildnis-
büste des Du. von Hase und eine Bildnisbüste Beet-
hovens von Carl Seffner zu erwähnen und ein vor-
trefflich durchgeführter männlicher Akt — ruhender
Jüngling — von Arnold Cramer in Dresden.
Auch die „Penthesilea" von Richard König und das
Relief „Unschuld" von Friedrich Offermann zeugen
von dem frischen Leben in der Dresdener Bildhauerschule.
Die auswärtigen Künstler sind meist mit Bildern
vertreten, die von früheren Ausstellungen in München
und Berlin her bekannt sind. Einen Ehrenplatz nimmt
darunter Franz von Lenbachs Leipziger Bildnis
Bismarcks ein, das den greisen Fürsten im bürgerlichen
Kleid in ernster Stimmung darstellt. Daneben besteht
auch Walther Petersens energisch gemaltes Bildnis,
das den Fürsten in voller Lebenskraft zeigt, mit Ehren.
Ein schönes Bild ist weiter Adolf Menzels abend-
liche Ansicht des Nymphenbades aus dem Dresdener Zwinger,
den der Künstler in wohl begreiflicher Vorliebe für dieses
berühmte Bauwerk seit früher Jugend wiederholt als
Motiv benützt hat. Fritz von Uhde ist leider mit
dem religiösen Gemälde, das er für die Dresdener
Ausstellung malen wollte, nicht fertig geworden; aber
sein ansprechendes Bild „Herbstzeit" — Mutter mit
Kind auf dem Felde — zeigt den Künstler vorteilhaft
auf dem Gebiete des Stimmungsbildes, das er mit so
trefflichem Können beherrscht. Auch Ludwig Dett-
manns biblisches Bild „Heimkehr des verlorenen Sohnes"
zeigt den Künstler auf dem gleichen Pfade: der ver-
lorene Sohn, ein schlichter Bauernbursche, kniet reu-
mütig, entblößten Hauptes und ein Bündelchen neben
sich auf dem Feldweg, der dem heimatlichen Dorfe zu-
führt. Ferdinand Brülls vielbesprochenes Bild
„Warum toben die Heiden u. s. w." (Psalm II) scheint
uns nur zu beweisen, daß des Künstlers eigentliches
Gebiet die moderne Sittenschilderung ist und bleiben
sollte. Auch Hans Sandreuters „Jungbrunnen"
macht einen matten Eindruck und zeigt den nötigen
Humor und Frische nur in einigen Nebensachen. Eine
Reihe von Visionsbildern scheinen uns zu beweisen, daß
die betreffenden Künstler wohl selbst nie Visionen ge-
habt haben, sonst würden sie wissen, daß derartige
Gaukelbilder unserer Phantasie sich ganz leicht aus dem
Dunkel lösen, nicht wie strahlende Erscheinungen aus
dem Lichte hervortreten. Bei Arthur Kampfs „Todes-
kuß" erscheint der Gegensatz zwischen dem Vater, der
so freudig mit dem Kinde auf seinem Schoß spielt,
und der Mutter, welche der Tod leibhaftig küßt, etwas
gesucht. Trefflich ist aber der Gegensatz auf dem Bilde
„Vor dem Theater", wo die geputzten Besucher dem
hellerleuchteten Thor zustreben, während eine ärmliche
Frau, das Kind auf dem Arm tragend, mit neiderfülltem
Blick hinüberschaut. Zu der großartigen Charakteristik
und der scharfen Beobachtung der Bewegungen tritt
übrigens bei diesem Kampfschen Bilde auch der Blick
für die malerische Wirkung, ein entschiedener Fortschritt.
Einen solchen finden wir auch in Ludwig von Hof-
manns „Sonnenuntergang auf dem Meere", einem
Bilde, das eine große Naturanschauung lebendig und
intim wiedergiebt. Weniger gut ist Hans Thoma
vertreten mit seinem „Kinderreigen", da die Kinder
nicht völlig bei der Sache zu sein scheinen, um so besser
aber sein Frankfurter Genosse Wilhelm Steinhaufen,
dessen elf Deckfarbenbilder große einfache Auffassung
und stilistischen Ernst bekunden.
Noch wäre manches tüchtige und interessante Werk
zu nennen, so die Landschaften von Karl Hartmann-
Heilbronn („Unterwegs"), Hans von Volkmann
(„Abendsonne"), H. E. v. Berlepsch, Keller-Reut-
lingen, Carl Ludwig („Auf dem hohen Fraffen"),
Otto Reiniger, dann Hugo Vogels „Abendfrieden"
(Magdeburgisches Museum), Hans v. Bartels „Im
Morgenthau", Th. Schmuz-Baudiß' „kg-xvostisoiim",
„Am Potsdamer Platz in Berlin" von Hans Herr-
mann u. s. w., indes der uns zugebilligte Platz ge-
bietet uns zu schließen. — Wie gesagt, die Dresdener
Ausstellung macht einen angenehmen Eindruck, tritt aber
nicht in Wettbewerb mit den großen Ausstellungen in
Berlin und München. Sollen die Dresdener Aus-
stellungen eine ähnliche Bedeutung wie diese erlangen,
so wird man auf Eliteausstellungen oder Ausstellungen
mit ganz besonderem Plane und ganz besonderer Vor-
bereitung zukommen müssen.
L. St. Petersburg. Welcher Art der große Ruf ist,
den der Akademiker Bakalowicz hier genießt, erklärt wiederum
sein jüngstes Bild auf der Typographischen Ausstellung, „Das
Edikt des Marius" betitelt. Es wendet sich an Liebhaber süß-
licher Porzellanmalerei, denen akademische Korrektheit und geschmack-
volle minutiöse Ausführung lieb und wert sind und Langeweile in
malerischem Sinne kein Mangel eines Bildes. Ohne beigefügte
Erklärung bleibt das Gemälde unverständlich, denn der Titel
ruft in einem gewöhnlichen Sterblichen ohne spezielle historische
Kenntnisse keine Reminiscenzen wach. Man sieht eine Szene aus
dem römischen Straßenleben, einen Auflauf mehr oder weniger
empörter Römer an einer Hausmauer mit dem betreffenden Edikt.
Wie immer bei Bakalowicz, entbehrt auch diese Szene des Lebens,
der Bewegung, ist einfach „ein lebendes Bild" nach dem Modell'
in glatter, salonnierter Behandlung. Die Errungenschaften der
Malerei in den letzten 30 Jahren sind spurlos an Bakalowicz
vorübergegangen. Die Versenkung in eine längst entschwundene
Epoche macht ihn blind für die Jetztzeit, doch nicht für die Käufer
seiner Bilder. — Jlja Repins Porträt Kaiser Nikolais II.
wurde von der Kaiserlichen Akademie der Künste erworben.
Leider gehört das Kaiserbildnis nicht zu den guten Sachen des
Meisters. Weder in Auffassung noch Behandlung. Ferner
wurden für das Museum der Akademie angeschafft: die unvollendet
gebliebene „Prozession" des verstorbenen P rjanisch ni kow
und das historische Gemälde Sedows, „Iwan der Schreck-
liche am Lager der schlafenden Wassilisja Melentjerna" darstellend.
Der Name Prjanischnikows darf in einer Galerie nationaler
russischer Kunst nicht fehlen, wenig Interesse bietet aber die
völlig unbedeutend, in akademischer Auffassung gemalte histo-
rische Anekdote aus der russischen Geschichte Sedows. Das
Kaiserbildnis Galkins wurde für den Privatbesitz des Kaisers
erworben. liiosi