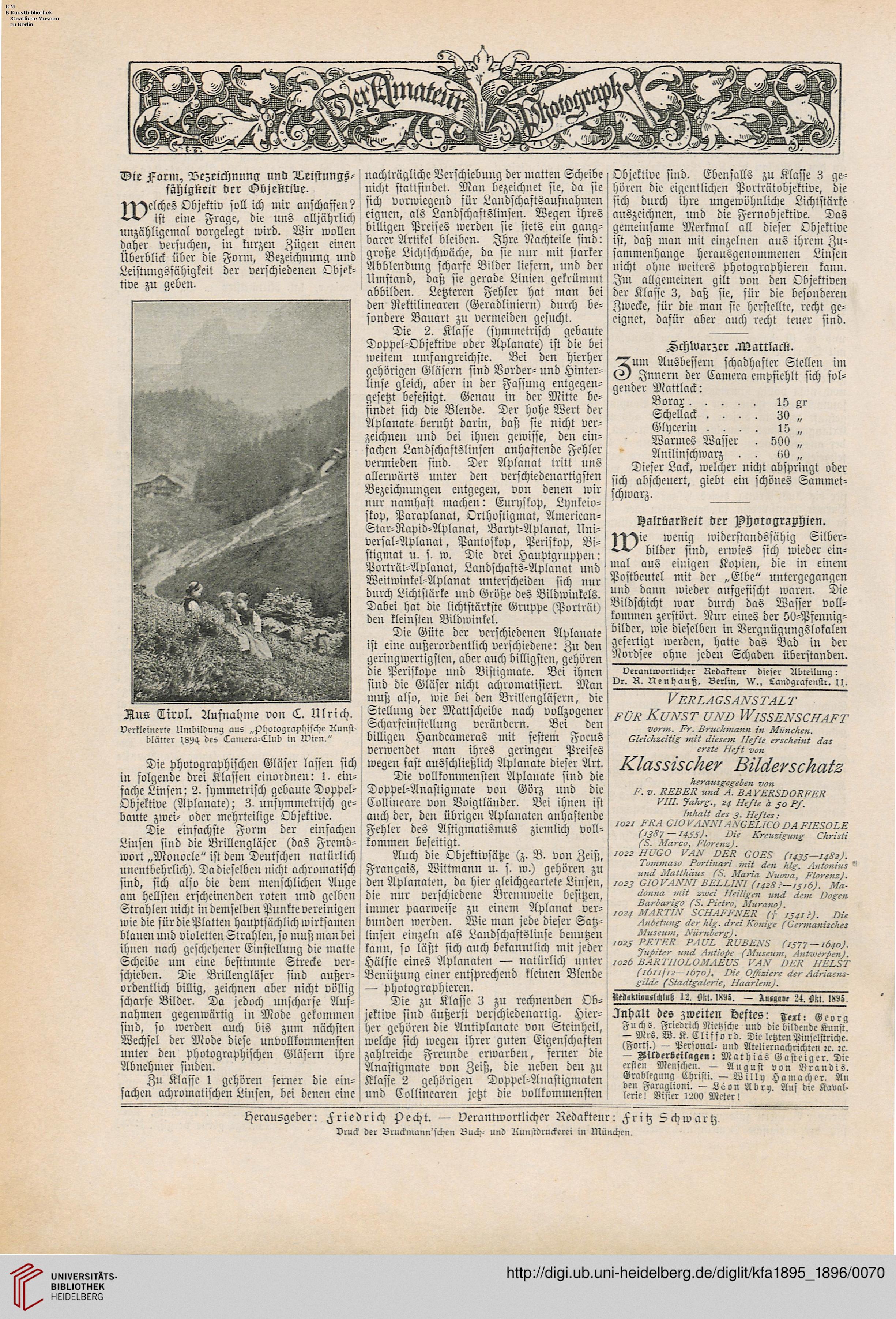Die Z?orm, Bezeichnung und Leistungß--
Migkeit der Gvjekrive
>I^>elches Objektiv soll ich mir anschasfen?
ist eine Frage, die uns alljährlich
unzähligemal vorgelegt wird. Wir wollen
daher versuchen, in kurzen Zügen einen
Überblick über die Form, Bezeichnung und
Leistungsfähigkeit der verschiedenen Objek-
tive zu geben.
Lus Tirol. Aufnahme von L. Ulrich.
verkleinerte Umbildung aus „Photographische Aunst-
blätter ^894 des Lamera-Llub in Wien."
Die photographischen Gläser lassen sich
in folgende drei Klassen einordnen: 1. ein-
fache Üinsen: 2. symmetrisch gebaute Doppel-
Objektive (Aplanate); 3. unsymmetrisch ge-^
baute zwei- oder mehrteilige Objektive.
Die einfachste Form der einfachen
Linsen sind die Brillengläser (das Fremd- ^
wort „Monocle" ist dem Deutschen natürlich
unentbehrlich). Dadieselben nicht achromatisch !
sind, sich also die dem menschlichen Auge
am hellsten erscheinenden roten und gelben
Strahlen nicht in demselben Punkte vereinigen ^
wie die für die Platten hauptsächlich wirksamen
blauen und violetten Strahlen, so muß man bei
ihnen nach geschehener Einstellung die matte !
Scheibe uni eine bestimmte Strecke ver-
schieben. Die Brillengläser sind außer-
ordentlich billig, zeichnen aber nicht völlig
scharfe Bilder. Da jedoch unscharfe Auf-
nahmen gegenwärtig in Mode gekommen
sind, so werden auch bis zum nächsten
Wechsel der Mode diese unvollkommensten
unter den photographischen Gläsern ihre!
Abnehmer finden.
Zu Klasse t gehören ferner die ein-!
fachen achromatischen Linsen, bei denen eine
nachträgliche Verschiebung der matten Scheibe
nicht stattsindet. Man bezeichnet sie, da sie
sich vorwiegend für Landschaftsaufnahmen
eignen, als Landschaftslinsen. Wegen ihres
billigen Preises werden sie stets ein gang-
barer Artikel bleiben. Ihre Nachteile sind:
große Lichtschwäche, da sie nur mit starker
Abblendung scharfe Bilder liefern, und der
Umstand, daß sie gerade Linien gekrümmt
abbilden. Letzteren Fehler hat man bei
den Rektilinearen (Geradliniern) durch be-
sondere Bauart zu vermeiden gesucht.
Die 2. Klasse (symmetrisch gebaute
Doppel-Objektive oder Aplanate) ist die bei
weitem umfangreichste. Bei den hierher
gehörigen Gläsern sind Vorder- und Hinter-
linse gleich, aber in der Fassung entgegen-
gesetzt befestigt. Genau in der Mitte be-
findet sich die Blende. Der hohe Wert der
Aplanate beruht darin, daß sie nicht ver-
zeichnen und bei ihnen gewisse, den ein-
fachen Landschaftslinsen anhaftende Fehler
vermieden sind. Der Aplanat tritt uns
allerwärts unter den verschiedenartigsten
Bezeichnungen entgegen, von denen wir
nur namhaft machen: Euryskop, Lynkeio-
skop, Paraplanat, Orthostigmat, American-
Star-Rapid-Aplanat, Baryt-Aplanat, Uni-
versal-Aplanat, Pantoskop, Periskop, Bi-
stigmat u. s. w. Die drei Hauptgruppen: ^
Porträt-Aplanat, Landschafts-Aplanat und!
Weitwinkel-Aplanat unterscheiden sich nur
durch Lichtstärke und Größe des Bildwinkels.
Dabei hat die lichtstärkste Gruppe (Porträt)
den kleinsten Bildwinkel.
Die Güte der verschiedenen Aplanate
ist eine außerordentlich verschiedene: Zu den
geringwertigsten, aber auch billigsten, gehören
die Periskope und Bistigmate. Bei ihnen
sind die Gläser nicht achromatisiert. Man
muß also, wie bei den Brillengläsern, die
Stellung der Mattscheibe nach vollzogener
Scharfeinstellung verändern. Bei den
billigen Handcameras mit festem Focus
verwendet man ihres geringen Preises
wegen fast ausschließlich Aplanate dieser Art.
Die vollkommensten Aplanate sind die
Doppel-Anastigmate von Görz und die
Collineare von Voigtländer. Bei ihnen ist
auch der, den übrigen Aplanaten anhaftende
Fehler des Astigmatismus ziemlich voll-
kommen beseitigt.
Auch die Objektivsätze (z. B. von Zeiß,
Frangais, Wittmann u. s. w.) gehören zu
den Aplanaten, da hier gleichgeartete Linsen,
die nur verschiedene Brennweite besitzen,
immer paarweise zu einem Aplanat ver-
bunden werden. Wie man jede dieser Satz-
linsen einzeln als Landschaftslinse benutzen
kann, so läßt sich auch bekanntlich mit jeder
Hälfte eines Aplanaten — natürlich unter
Benützung einer entsprechend kleinen Blende
— photographieren.
Die zu Klasse 3 zu rechnenden Ob-
jektive sind äußerst verschiedenartig. Hier-
her gehören die Antiplanate von Steinheil,
welche sich wegen ihrer guten Eigenschaften
zahlreiche Freunde erwarben, ferner die
Anastigmate von Zeiß, die neben den zu
Klasse 2 gehörigen Doppel-Anastigmaten
und Collinearen jetzt die vollkommensten
Objektive sind. Ebenfalls zu Klasse 3 ge-
hören die eigentlichen Porträtobjeklive, die
sich durch ihre ungewöhnliche Lichtstärke
auszeichnen, und die Fernobjektive. Das
gemeinsame Merkmal all dieser Objektive
ist, daß man mit einzelnen aus ihrem Zu-
sammenhänge herausgenommenen Linsen
nicht ohne weiters photographieren kann.
Im allgemeinen gilt von den Objektiven
der Klasse 3, daß sie, für die besonderen
Zwecke, für die man sie herstellte, recht ge-
eignet, dafür aber auch recht teuer sind.
Schwarzer.Matllacli.
^Bum Ausbessern schadhafter Stellen im
6) Innern der Camera empfiehlt sich fol-
gender Mattlack:
Borax.
15 §r
Schellack . . .
. 30 „
Glycerin - . .
15 „
Warmes Wasser
- 500 „
Anilinschwarz .
. 60 ,.
Dieser Lack, welcher nicht abspringt oder
sich abscheuert, giebt ein schönes Sammet-
schwarz.
Haltbarkeit der MotograMcn.
>>^ie wenig widerstandsfähig Silber-
bilder sind, erwies sich wieder ein-
mal aus einigen Kopien, die in einem
Postbeutel mit der „Elbe" untergegangen
und dann wieder aufgefischt waren. Die
Bildschicht war durch das Wasser voll-
kommen zerstört. Nur eines der 50-Pfennig-
bilder, wie dieselben in Vergnügungslokalen
gefertigt werden, hatte das Bad in der
Nordsee ohne jeden Schaden überstanden.
tV//. ^ a /^.
/»LrS L. ..
/-LL
^
7.
/<>-) LLLL/.V/.t/a-
LeSaktiollelLIub 1'^ 1X^5. — Ausimok Sl:l
Inhalt des zweiten bestes: Georg
Fuchs. Friedrich Nietzsche und die bildende Kunst.
— Mrs. W. K. Cliffo rd. Die letzten Pinselstriche.
(Forts.) — Personal- und Ateliernachrichten rc. re.
— Ailderöeitage«: Mathias Gasteiger. Die
ersten Menschen. — August von Brandts.
Grablegung Christi. — Willy Hamacher. An
den Faraglioni. — Leon Abry. Aus die Kaval-
lerie ! Visier 1200 Meter!
Herausgeber: Friedrich Pecht. — Verantwortlicher Redakteur: Fritz Schwartz
Migkeit der Gvjekrive
>I^>elches Objektiv soll ich mir anschasfen?
ist eine Frage, die uns alljährlich
unzähligemal vorgelegt wird. Wir wollen
daher versuchen, in kurzen Zügen einen
Überblick über die Form, Bezeichnung und
Leistungsfähigkeit der verschiedenen Objek-
tive zu geben.
Lus Tirol. Aufnahme von L. Ulrich.
verkleinerte Umbildung aus „Photographische Aunst-
blätter ^894 des Lamera-Llub in Wien."
Die photographischen Gläser lassen sich
in folgende drei Klassen einordnen: 1. ein-
fache Üinsen: 2. symmetrisch gebaute Doppel-
Objektive (Aplanate); 3. unsymmetrisch ge-^
baute zwei- oder mehrteilige Objektive.
Die einfachste Form der einfachen
Linsen sind die Brillengläser (das Fremd- ^
wort „Monocle" ist dem Deutschen natürlich
unentbehrlich). Dadieselben nicht achromatisch !
sind, sich also die dem menschlichen Auge
am hellsten erscheinenden roten und gelben
Strahlen nicht in demselben Punkte vereinigen ^
wie die für die Platten hauptsächlich wirksamen
blauen und violetten Strahlen, so muß man bei
ihnen nach geschehener Einstellung die matte !
Scheibe uni eine bestimmte Strecke ver-
schieben. Die Brillengläser sind außer-
ordentlich billig, zeichnen aber nicht völlig
scharfe Bilder. Da jedoch unscharfe Auf-
nahmen gegenwärtig in Mode gekommen
sind, so werden auch bis zum nächsten
Wechsel der Mode diese unvollkommensten
unter den photographischen Gläsern ihre!
Abnehmer finden.
Zu Klasse t gehören ferner die ein-!
fachen achromatischen Linsen, bei denen eine
nachträgliche Verschiebung der matten Scheibe
nicht stattsindet. Man bezeichnet sie, da sie
sich vorwiegend für Landschaftsaufnahmen
eignen, als Landschaftslinsen. Wegen ihres
billigen Preises werden sie stets ein gang-
barer Artikel bleiben. Ihre Nachteile sind:
große Lichtschwäche, da sie nur mit starker
Abblendung scharfe Bilder liefern, und der
Umstand, daß sie gerade Linien gekrümmt
abbilden. Letzteren Fehler hat man bei
den Rektilinearen (Geradliniern) durch be-
sondere Bauart zu vermeiden gesucht.
Die 2. Klasse (symmetrisch gebaute
Doppel-Objektive oder Aplanate) ist die bei
weitem umfangreichste. Bei den hierher
gehörigen Gläsern sind Vorder- und Hinter-
linse gleich, aber in der Fassung entgegen-
gesetzt befestigt. Genau in der Mitte be-
findet sich die Blende. Der hohe Wert der
Aplanate beruht darin, daß sie nicht ver-
zeichnen und bei ihnen gewisse, den ein-
fachen Landschaftslinsen anhaftende Fehler
vermieden sind. Der Aplanat tritt uns
allerwärts unter den verschiedenartigsten
Bezeichnungen entgegen, von denen wir
nur namhaft machen: Euryskop, Lynkeio-
skop, Paraplanat, Orthostigmat, American-
Star-Rapid-Aplanat, Baryt-Aplanat, Uni-
versal-Aplanat, Pantoskop, Periskop, Bi-
stigmat u. s. w. Die drei Hauptgruppen: ^
Porträt-Aplanat, Landschafts-Aplanat und!
Weitwinkel-Aplanat unterscheiden sich nur
durch Lichtstärke und Größe des Bildwinkels.
Dabei hat die lichtstärkste Gruppe (Porträt)
den kleinsten Bildwinkel.
Die Güte der verschiedenen Aplanate
ist eine außerordentlich verschiedene: Zu den
geringwertigsten, aber auch billigsten, gehören
die Periskope und Bistigmate. Bei ihnen
sind die Gläser nicht achromatisiert. Man
muß also, wie bei den Brillengläsern, die
Stellung der Mattscheibe nach vollzogener
Scharfeinstellung verändern. Bei den
billigen Handcameras mit festem Focus
verwendet man ihres geringen Preises
wegen fast ausschließlich Aplanate dieser Art.
Die vollkommensten Aplanate sind die
Doppel-Anastigmate von Görz und die
Collineare von Voigtländer. Bei ihnen ist
auch der, den übrigen Aplanaten anhaftende
Fehler des Astigmatismus ziemlich voll-
kommen beseitigt.
Auch die Objektivsätze (z. B. von Zeiß,
Frangais, Wittmann u. s. w.) gehören zu
den Aplanaten, da hier gleichgeartete Linsen,
die nur verschiedene Brennweite besitzen,
immer paarweise zu einem Aplanat ver-
bunden werden. Wie man jede dieser Satz-
linsen einzeln als Landschaftslinse benutzen
kann, so läßt sich auch bekanntlich mit jeder
Hälfte eines Aplanaten — natürlich unter
Benützung einer entsprechend kleinen Blende
— photographieren.
Die zu Klasse 3 zu rechnenden Ob-
jektive sind äußerst verschiedenartig. Hier-
her gehören die Antiplanate von Steinheil,
welche sich wegen ihrer guten Eigenschaften
zahlreiche Freunde erwarben, ferner die
Anastigmate von Zeiß, die neben den zu
Klasse 2 gehörigen Doppel-Anastigmaten
und Collinearen jetzt die vollkommensten
Objektive sind. Ebenfalls zu Klasse 3 ge-
hören die eigentlichen Porträtobjeklive, die
sich durch ihre ungewöhnliche Lichtstärke
auszeichnen, und die Fernobjektive. Das
gemeinsame Merkmal all dieser Objektive
ist, daß man mit einzelnen aus ihrem Zu-
sammenhänge herausgenommenen Linsen
nicht ohne weiters photographieren kann.
Im allgemeinen gilt von den Objektiven
der Klasse 3, daß sie, für die besonderen
Zwecke, für die man sie herstellte, recht ge-
eignet, dafür aber auch recht teuer sind.
Schwarzer.Matllacli.
^Bum Ausbessern schadhafter Stellen im
6) Innern der Camera empfiehlt sich fol-
gender Mattlack:
Borax.
15 §r
Schellack . . .
. 30 „
Glycerin - . .
15 „
Warmes Wasser
- 500 „
Anilinschwarz .
. 60 ,.
Dieser Lack, welcher nicht abspringt oder
sich abscheuert, giebt ein schönes Sammet-
schwarz.
Haltbarkeit der MotograMcn.
>>^ie wenig widerstandsfähig Silber-
bilder sind, erwies sich wieder ein-
mal aus einigen Kopien, die in einem
Postbeutel mit der „Elbe" untergegangen
und dann wieder aufgefischt waren. Die
Bildschicht war durch das Wasser voll-
kommen zerstört. Nur eines der 50-Pfennig-
bilder, wie dieselben in Vergnügungslokalen
gefertigt werden, hatte das Bad in der
Nordsee ohne jeden Schaden überstanden.
tV//. ^ a /^.
/»LrS L. ..
/-LL
^
7.
/<>-) LLLL/.V/.t/a-
LeSaktiollelLIub 1'^ 1X^5. — Ausimok Sl:l
Inhalt des zweiten bestes: Georg
Fuchs. Friedrich Nietzsche und die bildende Kunst.
— Mrs. W. K. Cliffo rd. Die letzten Pinselstriche.
(Forts.) — Personal- und Ateliernachrichten rc. re.
— Ailderöeitage«: Mathias Gasteiger. Die
ersten Menschen. — August von Brandts.
Grablegung Christi. — Willy Hamacher. An
den Faraglioni. — Leon Abry. Aus die Kaval-
lerie ! Visier 1200 Meter!
Herausgeber: Friedrich Pecht. — Verantwortlicher Redakteur: Fritz Schwartz