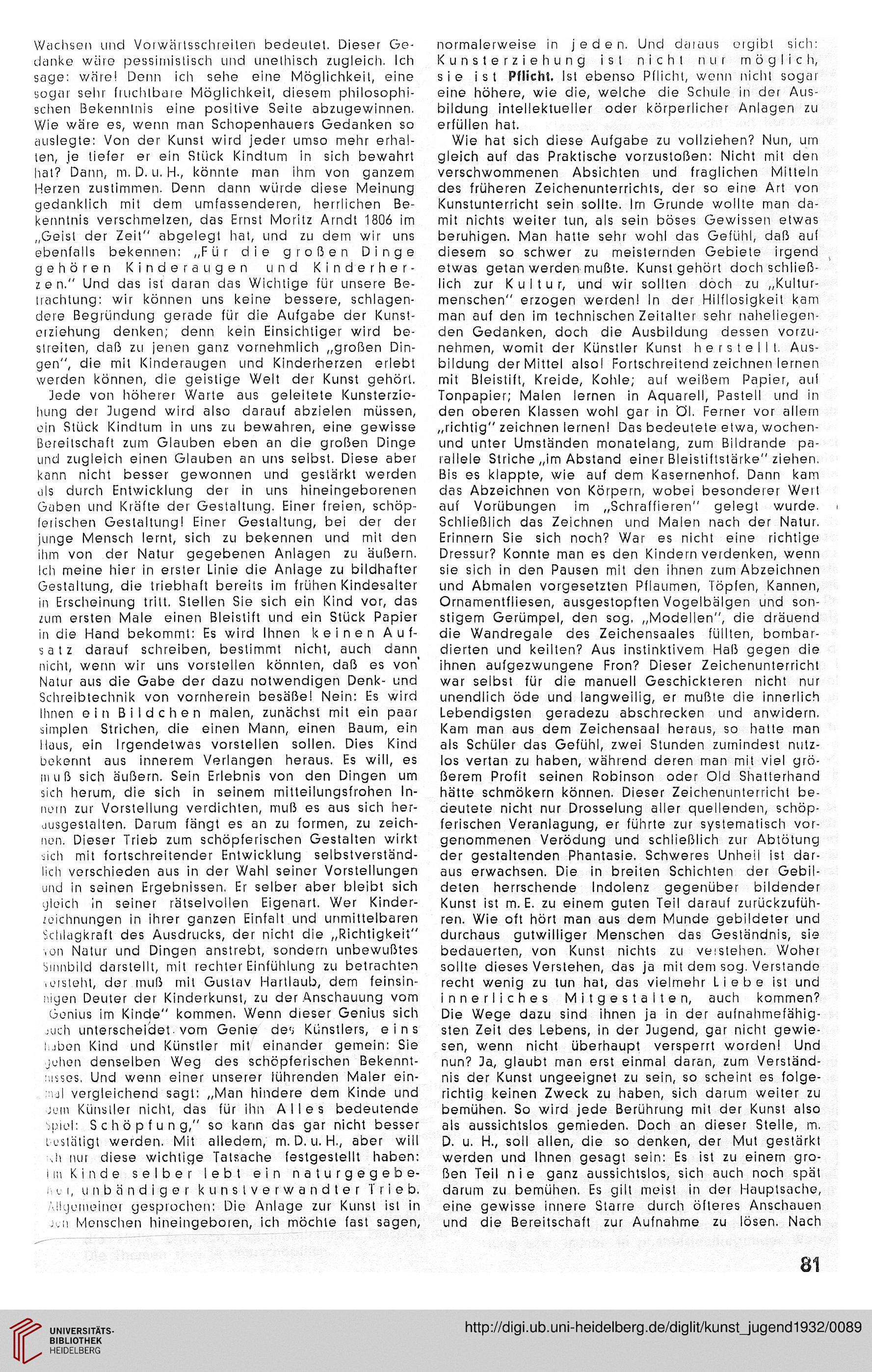Wachsen und Vorwärtsschreilen bedeutet. Dieser Ge-
danke wäre pessimistisch und unethisch zugleich. Ich
sage: wäre! Denn ich sehe eine Möglichkeit, eine
sogar sehr fruchtbare Möglichkeit, diesem philosophi-
schen Bekenntnis eine positive Seite abzugewinnen.
Wie wäre es, wenn man Schopenhauers Gedanken so
auslegte: Von der Kunst wird jeder umso mehr erhal-
ten, je tiefer er ein Stück Kindtum in sich bewahrt
iiat? Dann, m. D. u. H., könnte man Ihm von ganzem
Herzen zustimmen. Denn dann würde diese Meinung
gedanklich mit dem umfassenderen, herrlichen Be-
kenntnis verschmelzen, das Ernst Moritz Arndt 1806 im
„Geist der Zeit" abgelegt hat, und zu dem wir uns
ebenfalls bekennen: „Für die großen Dinge
gehören Kinderaugen und Kin de rher-
z e n." Und das ist daran das Wichtige für unsere Be-
trachtung: wir können uns keine bessere, schlagen-
dere Begründung gerade für die Aufgabe der Kunst-
erziehung denken; denn kein Einsichtiger wird be-
streiten, daß zu jenen ganz vornehmlich „großen Din-
gen", die mit Kinderaugen und Kinderherzen erlebt
werden können, die geistige Welt der Kunst gehört.
Jede von höherer Warte aus geleitete Kunsterzie-
hung der lugend wird also darauf abzielen müssen,
ein Stück Kindtum in uns zu bewahren, eine gewisse
Bereitschaft zum Glauben eben an die großen Dinge
und zugleich einen Glauben an uns selbst. Diese aber
kann nicht besser gewonnen und gestärkt werden
als durch Entwicklung der in uns hineingeborenen
Gaben und Kräfte der Gestaltung. Einer freien, schöp-
(etischen Gestaltung! Einer Gestaltung, bei der der
junge Mensch lernt, sich zu bekennen und mit den
ihm von der Natur gegebenen Anlagen zu äußern.
Ich meine hier in erster Linie die Anlage zu bildhafter
Gestaltung, die triebhaft bereits im frühen Kindesalter
in Erscheinung tritt. Stellen Sie sich ein Kind vor, das
zum ersten Male einen Bleistift und ein Stück Papier
in die Hand bekommt: Es wird Ihnen keinen Auf-
satz darauf schreiben, bestimmt nicht, auch dann
nicht, wenn wir uns vorstellen könnten, daß es von’
Natur aus die Gabe der dazu notwendigen Denk- und
Schreibtechnik von vornherein besäßel Nein: Es wird
Ihnen ein Bildchen malen, zunächst mit ein paar
simplen Strichen, die einen Mann, einen Baum, ein
Haus, ein Irgendetwas vorstellen sollen. Dies Kind
bekennt aus innerem Verlangen heraus. Es will, es
muß sich äußern. Sein Erlebnis von den Dingen um
sich herum, die sich in seinem mitteilungsfrohen In-
nc'in zur Vorstellung verdichten, muß es aus sich her-
ausgestalten. Darum fängt es an zu formen, zu zeich-
nen. Dieser Trieb zum schöpferischen Gestalten wirkt
sich mit fortschreitender Entwicklung selbstverständ-
lich verschieden aus in der Wahl seiner Vorstellungen
und in seinen Ergebnissen. Er selber aber bleibt sich
gleich in seiner rätselvollen Eigenart. Wer Kinder-
rcichnungen in ihrer ganzen Einfalt und unmittelbaren
Schlagkraft des Ausdrucks, der nicht die „Richtigkeit"
.on Natur und Dingen anstrebt, sondern unbewußtes
Sinnbild darstellt, mit rechter Einfühlung zu betrachten
.ersteht, der muß mit Gustav Hartlaub, dem feinsin-
nigen Deuter der Kinderkunst, zu der Anschauung vom
Genius im Kinde" kommen. Wenn dieser Genius sich
juch unterscheidet vom Genie des Künstlers, eins
haben Kind und Künstler mit einander gemein: Sie
Julien denselben Weg des schöpferischen Bekennt-
nisses. Und wenn einer unserer führenden Maler ein-
mal vergleichend sagt: „Man hindere dem Kinde und
Juni Künstler nicht, das für ihn Alles bedeutende
spiel: Schöpfung," so kann das gar nicht besser
bestätigt werden. Mit alledem, m. D. u. H., aber will
Jt nur diese wichtige Tatsache festgestellt haben:
im Kinde selber lebt ein naturgegebe-
ne!, unbändiger kunstverwandter Trieb.
Allgemeiner gesprochen: Die Anlage zur Kunst ist in
juii Menschen hineingeboren, ich möchte fast sagen,
normalerweise in jeden. Und daraus ergibt sich:
Kunsterziehung ist nicht nur möglich,
sie ist Pflicht. Ist ebenso Pflicht, wenn nicht sogar
eine höhere, wie die, welche die Schule in der Aus-
bildung intellektueller oder körperlicher Anlagen zu
erfüllen hat.
Wie hat sich diese Aufgabe zu vollziehen? Nun, um
gleich auf das Praktische vorzustoßen: Nicht mit den
verschwommenen Absichten und fraglichen Mitteln
des früheren Zeichenunterrichts, der so eine Art von
Kunstunterricht sein sollte. Im Grunde wollte man da-
mit nichts weiter tun, als sein böses Gewissen etwas
beruhigen. Man hatte sehr wohl das Gefühl, daß auf
diesem so schwer zu meisternden Gebiete irgend
etwas getan werden mußte. Kunst gehört doch schließ-
lich zur Kultur, und wir sollten doch zu „Kultur-
menschen" erzogen werden! In der Hilflosigkeit kam
man auf den im technischen Zeitalter sehr naheliegen-
den Gedanken, doch die Ausbildung dessen vorzu-
nehmen, womit der Künstler Kunst h e r s t e I I t. Aus-
bildung der Mittel alsol Fortschreitend zeichnen lernen
mit Bleistift, Kreide, Kohle; auf weißem Papier, aul
Tonpapier; Malen lernen in Aquarell, Pastell und in
den oberen Klassen wohl gar in öl. Ferner vor allem
„richtig" zeichnen lernenl Das bedeutete etwa, wochen-
und unter Umständen monatelang, zum Bildrande pa-
rallele Striche „Im Abstand einer Bleistiftstärke" ziehen.
Bis es klappte, wie auf dem Kasernenhof. Dann kam
das Abzeichnen von Körpern, wobei besonderer Werl
auf Vorübungen im „Schraffieren" gelegt wurde. .
Schließlich das Zeichnen und Malen nach der Natur.
Erinnern Sie sich noch? War es nicht eine richtige
Dressur? Konnte man es den Kindern verdenken, wenn
sie sich in den Pausen mit den ihnen zum Abzeichnen
und Abmalen Vorgesetzten Pflaumen, Töpfen, Kannen,
Ornamentfliesen, ausgestopften Vogelbälgen und son-
stigem Gerümpel, den sog, „Modellen", die dräuend
die Wandregale des Zeichensaales füllten, bombar-
dierten und keilten? Aus instinktivem Haß gegen die
ihnen aufgezwungene Fron? Dieser Zeichenunterricht
war selbst für die manuell Geschickteren nicht nur
unendlich öde und langweilig, er mußte die innerlich
Lebendigsten geradezu abschrecken und anwidern.
Kam man aus dem Zeichensaal heraus, so hatte man
als Schüler das Gefühl, zwei Stunden zumindest nutz-
los vertan zu haben, während deren man mit viel grö-
ßerem Profit seinen Robinson oder Old Shatterhand
hätte schmökern können. Dieser Zeichenunterricht be-
deutete nicht nur Drosselung aller quellenden, schöp-
ferischen Veranlagung, er führte zur systematisch vor-
genommenen Verödung und schließlich zur Abtötung
der gestaltenden Phantasie. Schweres Unheil ist dar-
aus erwachsen. Die in breiten Schichten der Gebil-
deten herrschende Indolenz gegenüber bildender
Kunst ist m. E. zu einem guten Teil darauf zurückzufüh-
ren. Wie oft hört man aus dem Munde gebildeter und
durchaus gutwilliger Menschen das Geständnis, sie
bedauerten, von Kunst nichts zu veistehen. Woher
sollte dieses Verstehen, das ja mit dem sog. Verstände
recht wenig zu tun hat, das vielmehr Liebe ist und
innerliches Mitgestalten, auch kommen?
Die Wege dazu sind ihnen ja in der aufnahmefähig-
sten Zeit des Lebens, in der Tugend, gar nicht gewie-
sen, wenn nicht überhaupt versperrt wordenl Und
nun? 3a, glaubt man erst einmal daran, zum Verständ-
nis der Kunst ungeeignet zu sein, so scheint es folge-
richtig keinen Zweck zu haben, sich darum weiter zu
bemühen. So wird jede Berührung mit der Kunst also
als aussichtslos gemieden. Doch an dieser Stelle, m.
D. u. H., soll allen, die so denken, der Mut gestärkt
werden und Ihnen gesagt sein: Es ist zu einem gro-
ßen Teil n i e ganz aussichtslos, sich auch noch spät
darum zu bemühen. Es gilt meist in der Hauptsache,
eine gewisse innere Starre durch öfteres Anschauen
und die Bereitschaft zur Aufnahme zu lösen. Nach
81
danke wäre pessimistisch und unethisch zugleich. Ich
sage: wäre! Denn ich sehe eine Möglichkeit, eine
sogar sehr fruchtbare Möglichkeit, diesem philosophi-
schen Bekenntnis eine positive Seite abzugewinnen.
Wie wäre es, wenn man Schopenhauers Gedanken so
auslegte: Von der Kunst wird jeder umso mehr erhal-
ten, je tiefer er ein Stück Kindtum in sich bewahrt
iiat? Dann, m. D. u. H., könnte man Ihm von ganzem
Herzen zustimmen. Denn dann würde diese Meinung
gedanklich mit dem umfassenderen, herrlichen Be-
kenntnis verschmelzen, das Ernst Moritz Arndt 1806 im
„Geist der Zeit" abgelegt hat, und zu dem wir uns
ebenfalls bekennen: „Für die großen Dinge
gehören Kinderaugen und Kin de rher-
z e n." Und das ist daran das Wichtige für unsere Be-
trachtung: wir können uns keine bessere, schlagen-
dere Begründung gerade für die Aufgabe der Kunst-
erziehung denken; denn kein Einsichtiger wird be-
streiten, daß zu jenen ganz vornehmlich „großen Din-
gen", die mit Kinderaugen und Kinderherzen erlebt
werden können, die geistige Welt der Kunst gehört.
Jede von höherer Warte aus geleitete Kunsterzie-
hung der lugend wird also darauf abzielen müssen,
ein Stück Kindtum in uns zu bewahren, eine gewisse
Bereitschaft zum Glauben eben an die großen Dinge
und zugleich einen Glauben an uns selbst. Diese aber
kann nicht besser gewonnen und gestärkt werden
als durch Entwicklung der in uns hineingeborenen
Gaben und Kräfte der Gestaltung. Einer freien, schöp-
(etischen Gestaltung! Einer Gestaltung, bei der der
junge Mensch lernt, sich zu bekennen und mit den
ihm von der Natur gegebenen Anlagen zu äußern.
Ich meine hier in erster Linie die Anlage zu bildhafter
Gestaltung, die triebhaft bereits im frühen Kindesalter
in Erscheinung tritt. Stellen Sie sich ein Kind vor, das
zum ersten Male einen Bleistift und ein Stück Papier
in die Hand bekommt: Es wird Ihnen keinen Auf-
satz darauf schreiben, bestimmt nicht, auch dann
nicht, wenn wir uns vorstellen könnten, daß es von’
Natur aus die Gabe der dazu notwendigen Denk- und
Schreibtechnik von vornherein besäßel Nein: Es wird
Ihnen ein Bildchen malen, zunächst mit ein paar
simplen Strichen, die einen Mann, einen Baum, ein
Haus, ein Irgendetwas vorstellen sollen. Dies Kind
bekennt aus innerem Verlangen heraus. Es will, es
muß sich äußern. Sein Erlebnis von den Dingen um
sich herum, die sich in seinem mitteilungsfrohen In-
nc'in zur Vorstellung verdichten, muß es aus sich her-
ausgestalten. Darum fängt es an zu formen, zu zeich-
nen. Dieser Trieb zum schöpferischen Gestalten wirkt
sich mit fortschreitender Entwicklung selbstverständ-
lich verschieden aus in der Wahl seiner Vorstellungen
und in seinen Ergebnissen. Er selber aber bleibt sich
gleich in seiner rätselvollen Eigenart. Wer Kinder-
rcichnungen in ihrer ganzen Einfalt und unmittelbaren
Schlagkraft des Ausdrucks, der nicht die „Richtigkeit"
.on Natur und Dingen anstrebt, sondern unbewußtes
Sinnbild darstellt, mit rechter Einfühlung zu betrachten
.ersteht, der muß mit Gustav Hartlaub, dem feinsin-
nigen Deuter der Kinderkunst, zu der Anschauung vom
Genius im Kinde" kommen. Wenn dieser Genius sich
juch unterscheidet vom Genie des Künstlers, eins
haben Kind und Künstler mit einander gemein: Sie
Julien denselben Weg des schöpferischen Bekennt-
nisses. Und wenn einer unserer führenden Maler ein-
mal vergleichend sagt: „Man hindere dem Kinde und
Juni Künstler nicht, das für ihn Alles bedeutende
spiel: Schöpfung," so kann das gar nicht besser
bestätigt werden. Mit alledem, m. D. u. H., aber will
Jt nur diese wichtige Tatsache festgestellt haben:
im Kinde selber lebt ein naturgegebe-
ne!, unbändiger kunstverwandter Trieb.
Allgemeiner gesprochen: Die Anlage zur Kunst ist in
juii Menschen hineingeboren, ich möchte fast sagen,
normalerweise in jeden. Und daraus ergibt sich:
Kunsterziehung ist nicht nur möglich,
sie ist Pflicht. Ist ebenso Pflicht, wenn nicht sogar
eine höhere, wie die, welche die Schule in der Aus-
bildung intellektueller oder körperlicher Anlagen zu
erfüllen hat.
Wie hat sich diese Aufgabe zu vollziehen? Nun, um
gleich auf das Praktische vorzustoßen: Nicht mit den
verschwommenen Absichten und fraglichen Mitteln
des früheren Zeichenunterrichts, der so eine Art von
Kunstunterricht sein sollte. Im Grunde wollte man da-
mit nichts weiter tun, als sein böses Gewissen etwas
beruhigen. Man hatte sehr wohl das Gefühl, daß auf
diesem so schwer zu meisternden Gebiete irgend
etwas getan werden mußte. Kunst gehört doch schließ-
lich zur Kultur, und wir sollten doch zu „Kultur-
menschen" erzogen werden! In der Hilflosigkeit kam
man auf den im technischen Zeitalter sehr naheliegen-
den Gedanken, doch die Ausbildung dessen vorzu-
nehmen, womit der Künstler Kunst h e r s t e I I t. Aus-
bildung der Mittel alsol Fortschreitend zeichnen lernen
mit Bleistift, Kreide, Kohle; auf weißem Papier, aul
Tonpapier; Malen lernen in Aquarell, Pastell und in
den oberen Klassen wohl gar in öl. Ferner vor allem
„richtig" zeichnen lernenl Das bedeutete etwa, wochen-
und unter Umständen monatelang, zum Bildrande pa-
rallele Striche „Im Abstand einer Bleistiftstärke" ziehen.
Bis es klappte, wie auf dem Kasernenhof. Dann kam
das Abzeichnen von Körpern, wobei besonderer Werl
auf Vorübungen im „Schraffieren" gelegt wurde. .
Schließlich das Zeichnen und Malen nach der Natur.
Erinnern Sie sich noch? War es nicht eine richtige
Dressur? Konnte man es den Kindern verdenken, wenn
sie sich in den Pausen mit den ihnen zum Abzeichnen
und Abmalen Vorgesetzten Pflaumen, Töpfen, Kannen,
Ornamentfliesen, ausgestopften Vogelbälgen und son-
stigem Gerümpel, den sog, „Modellen", die dräuend
die Wandregale des Zeichensaales füllten, bombar-
dierten und keilten? Aus instinktivem Haß gegen die
ihnen aufgezwungene Fron? Dieser Zeichenunterricht
war selbst für die manuell Geschickteren nicht nur
unendlich öde und langweilig, er mußte die innerlich
Lebendigsten geradezu abschrecken und anwidern.
Kam man aus dem Zeichensaal heraus, so hatte man
als Schüler das Gefühl, zwei Stunden zumindest nutz-
los vertan zu haben, während deren man mit viel grö-
ßerem Profit seinen Robinson oder Old Shatterhand
hätte schmökern können. Dieser Zeichenunterricht be-
deutete nicht nur Drosselung aller quellenden, schöp-
ferischen Veranlagung, er führte zur systematisch vor-
genommenen Verödung und schließlich zur Abtötung
der gestaltenden Phantasie. Schweres Unheil ist dar-
aus erwachsen. Die in breiten Schichten der Gebil-
deten herrschende Indolenz gegenüber bildender
Kunst ist m. E. zu einem guten Teil darauf zurückzufüh-
ren. Wie oft hört man aus dem Munde gebildeter und
durchaus gutwilliger Menschen das Geständnis, sie
bedauerten, von Kunst nichts zu veistehen. Woher
sollte dieses Verstehen, das ja mit dem sog. Verstände
recht wenig zu tun hat, das vielmehr Liebe ist und
innerliches Mitgestalten, auch kommen?
Die Wege dazu sind ihnen ja in der aufnahmefähig-
sten Zeit des Lebens, in der Tugend, gar nicht gewie-
sen, wenn nicht überhaupt versperrt wordenl Und
nun? 3a, glaubt man erst einmal daran, zum Verständ-
nis der Kunst ungeeignet zu sein, so scheint es folge-
richtig keinen Zweck zu haben, sich darum weiter zu
bemühen. So wird jede Berührung mit der Kunst also
als aussichtslos gemieden. Doch an dieser Stelle, m.
D. u. H., soll allen, die so denken, der Mut gestärkt
werden und Ihnen gesagt sein: Es ist zu einem gro-
ßen Teil n i e ganz aussichtslos, sich auch noch spät
darum zu bemühen. Es gilt meist in der Hauptsache,
eine gewisse innere Starre durch öfteres Anschauen
und die Bereitschaft zur Aufnahme zu lösen. Nach
81