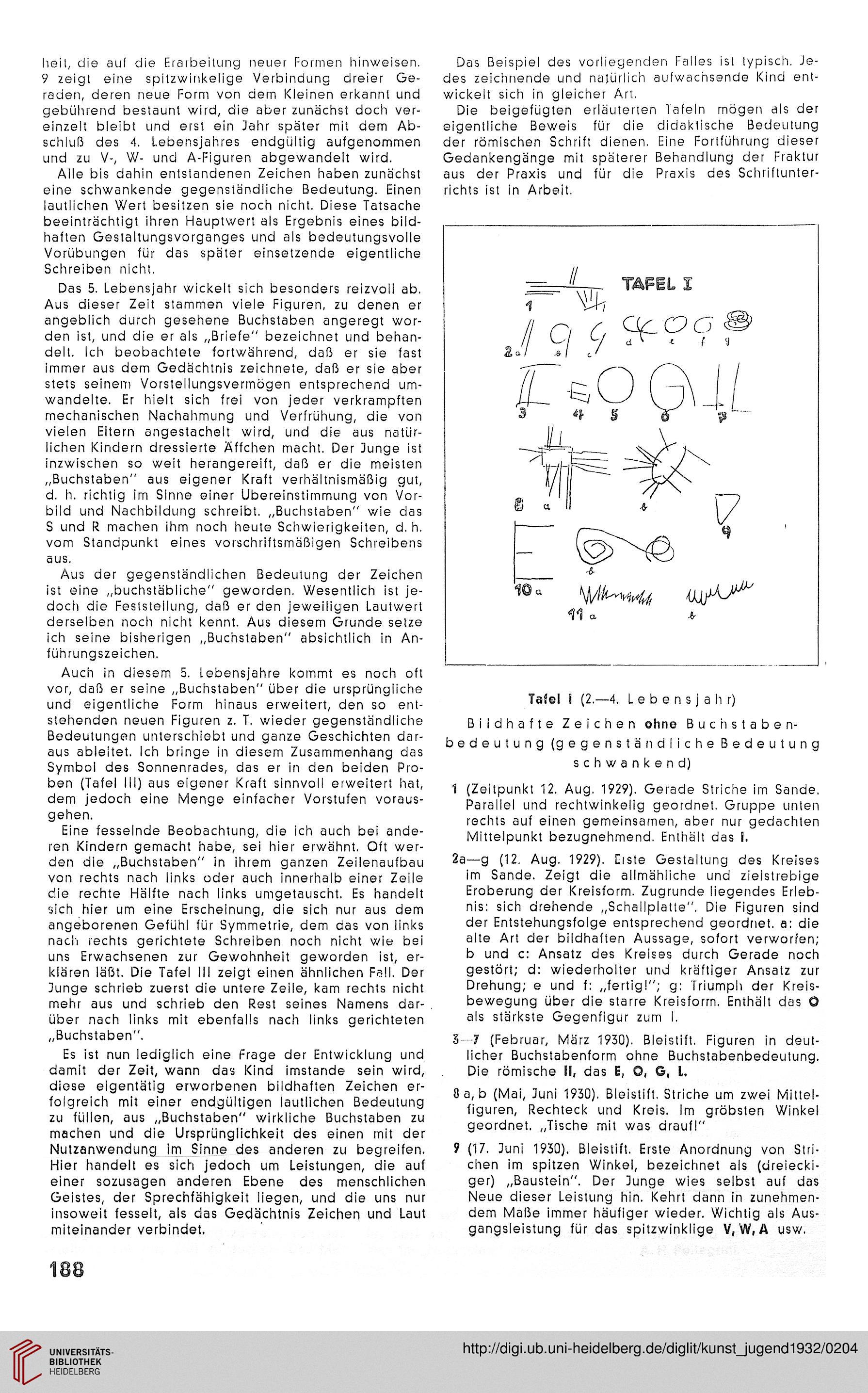heil, die auf die Erarbeitung neuer Formen hinweisen.
9 zeigt eine spitzwinkelige Verbindung dreier Ge-
raden, deren neue Form von dem Kleinen erkannt und
gebülirend bestaunt wird, die aber zunächst doch ver-
einzelt bleibt und erst ein Jahr später mit dem Ab-
schluß des 4. Lebensjahres endgültig aufgenommen
und zu V-, W- und A-Figuren abgewandelt wird.
Alle bis dahin entstandenen Zeichen haben zunächst
eine schwankende gegenständliche Bedeutung. Einen
lautlichen Wert besitzen sie noch nicht. Diese Tatsache
beeinträchtigt ihren Hauptwert als Ergebnis eines bild-
haften Gestaltungsvorganges und als bedeutungsvolle
Vorübungen für das später einsetzende eigentliche
Schreiben nicht.
Das 5. Lebensjahr wickelt sich besonders reizvoll ab.
Aus dieser Zeit stammen viele Figuren, zu denen er
angeblich durch gesehene Buchstaben angeregt wor-
den ist, und die er als „Briefe" bezeichnet und behan-
delt. Ich beobachtete fortwährend, daß er sie fast
immer aus dem Gedächtnis zeichnete, daß er sie aber
stets seinem Vorstellungsvermögen entsprechend um-
wandelte. Er hielt sich frei von jeder verkrampften
mechanischen Nachahmung und Verfrühung, die von
vielen Eltern angestachelt wird, und die aus natür-
lichen Kindern dressierte Äffchen macht. Der Junge ist
inzwischen so weit herangereift, daß er die meisten
„Buchstaben" aus eigener Kraft verhältnismäßig gut,
d. h. richtig im Sinne einer Übereinstimmung von Vor-
bild und Nachbildung schreibt. „Buchstaben" wie das
S und R machen ihm noch heute Schwierigkeiten, d. h.
vom Standpunkt eines vorschriftsmäßigen Schreibens
aus.
Aus der gegenständlichen Bedeutung der Zeichen
ist eine „buchstäbliche" geworden. Wesentlich ist je-
doch die Feststellung, daß er den jeweiligen Lautwert
derselben noch nicht kennt. Aus diesem Grunde setze
ich seine bisherigen „Buchstaben" absichtlich in An-
führungszeichen.
Auch in diesem 5. lebensjahre kommt es noch oft
vor, daß er seine „Buchstaben" über die ursprüngliche
und eigentliche Form hinaus erweitert, den so ent-
stehenden neuen Figuren z. T, wieder gegenständliche
Bedeutungen unterschiebt und ganze Geschichten dar-
aus ableitet. Ich bringe in diesem Zusammenhang das
Symbol des Sonnenrades, das er in den beiden Pro-
ben (Tafel III) aus eigener Kraft sinnvoll erweitert hat,
dem jedoch eine Menge einfacher Vorstufen voraus-
gehen.
Eine fesselnde Beobachtung, die ich auch bei ande-
ren Kindern gemacht habe, sei hier erwähnt. Oft wer-
den die „Buchstaben" in ihrem ganzen Zeilenaufbau
von rechts nach links oder auch innerhalb einer Zeile
die rechte Hälfte nach links umgetauscht. Es handelt
sich hier um eine Erscheinung, die sich nur aus dem
angeborenen Gefühl für Symmetrie, dem das von links
nach rechts gerichtete Schreiben noch nicht wie bei
uns Erwachsenen zur Gewohnheit geworden ist, er-
klären läßt. Die Tafel III zeigt einen ähnlichen Fall. Der
Junge schrieb zuerst die untere Zeile, kam rechts nicht
mehr aus und schrieb den Rest seines Namens dar-
über nach links mit ebenfalls nach links gerichteten
„Buchstaben".
Es ist nun lediglich eine Frage der Entwicklung und
damit der Zeit, wann das Kind imstande sein wird,
diese eigentätig erv/orbenen bildhaften Zeichen er-
folgreich mit einer endgültigen lautlichen Bedeutung
zu füllen, aus „Buchstaben" wirkliche Buchstaben zu
machen und die Ursprünglichkeit des einen mit der
Nutzanwendung im Sinne des anderen zu begreifen.
Hier handelt es sich jedoch um Leistungen, die auf
einer sozusagen anderen Ebene des menschlichen
Geistes, der Sprechfähigkeit liegen, und die uns nur
insoweit fesselt, als das Gedächtnis Zeichen und Laut
miteinander verbindet.
Das Beispiel des vorliegenden Falles ist typisch. Je-
des zeichnende und natürlich aufwachsende Kind ent-
wickelt sich in gleicher Art.
Die beigefügten erläuterten Tafeln mögen als der
eigentliche Beweis für die didaktische Bedeutung
der römischen Schrift dienen. Eine Fortführung dieser
Gedankengänge mit späterer Behandlung der Fraktur
aus der Praxis und für die Praxis des Schriftunter-
richts ist in Arbeit.
Tafel I (2.—4. Lebensjahr)
Bildhafte Zeichen ohne Buchstaben-
bedeutung (gegenständliche Bedeutung
schwankend)
1 (Zeitpunkt 12. Aug. 1929). Gerade Striche im Sande,
Parallel und rechtwinkelig geordnet. Gruppe unten
rechts auf einen gemeinsamen, aber nur gedachten
Mittelpunkt bezugnehmend. Enthält das I.
2a—g (12. Aug. 1929). Eiste Gestaltung des Kreises
im Sande. Zeigt die allmähliche und zielstrebige
Eroberung der Kreisform. Zugrunde liegendes Erleb-
nis: sich drehende „Schallplatte". Die Figuren sind
der Entstehungsfolge entsprechend geordnet, a: die
alte Art der bildhaften Aussage, sofort verworfen;
b und c: Ansatz des Kreises durch Gerade noch
gestört; d: wiederholter und kräftiger Ansatz zur
Drehung; e und f: „fertig!"; g: Triumpli der Kreis-
bewegung über die starre Kreisform. Enthält das O
als stärkste Gegenfigur zum I.
3—7 (Februar, März 1930). Bleistift. Figuren in deut-
licher Buchstabenform ohne Buchstabenbedeutung.
Die römische II, das E, Q, G, l.
8 a, b (Mai, Juni 1930). Bleistift. Striche um zwei Mittel-
figuren, Rechteck und Kreis. Im gröbsten Winkel
geordnet. „Tische mit was drauf!"
9 (17. Juni 1930), Bleistift. Erste Anordnung von Stri-
chen im spitzen Winkel, bezeichnet als (dreiecki-
ger) „Baustein". Der Junge wies selbst auf das
Neue dieser Leistung hin. Kehrt dann in zunehmen-
dem Maße immer häufiger wieder. Wichtig als Aus-
gangsleistung für das spitzwinklige V, W, A usw.
TAPEL I
10a
11 a &
188
9 zeigt eine spitzwinkelige Verbindung dreier Ge-
raden, deren neue Form von dem Kleinen erkannt und
gebülirend bestaunt wird, die aber zunächst doch ver-
einzelt bleibt und erst ein Jahr später mit dem Ab-
schluß des 4. Lebensjahres endgültig aufgenommen
und zu V-, W- und A-Figuren abgewandelt wird.
Alle bis dahin entstandenen Zeichen haben zunächst
eine schwankende gegenständliche Bedeutung. Einen
lautlichen Wert besitzen sie noch nicht. Diese Tatsache
beeinträchtigt ihren Hauptwert als Ergebnis eines bild-
haften Gestaltungsvorganges und als bedeutungsvolle
Vorübungen für das später einsetzende eigentliche
Schreiben nicht.
Das 5. Lebensjahr wickelt sich besonders reizvoll ab.
Aus dieser Zeit stammen viele Figuren, zu denen er
angeblich durch gesehene Buchstaben angeregt wor-
den ist, und die er als „Briefe" bezeichnet und behan-
delt. Ich beobachtete fortwährend, daß er sie fast
immer aus dem Gedächtnis zeichnete, daß er sie aber
stets seinem Vorstellungsvermögen entsprechend um-
wandelte. Er hielt sich frei von jeder verkrampften
mechanischen Nachahmung und Verfrühung, die von
vielen Eltern angestachelt wird, und die aus natür-
lichen Kindern dressierte Äffchen macht. Der Junge ist
inzwischen so weit herangereift, daß er die meisten
„Buchstaben" aus eigener Kraft verhältnismäßig gut,
d. h. richtig im Sinne einer Übereinstimmung von Vor-
bild und Nachbildung schreibt. „Buchstaben" wie das
S und R machen ihm noch heute Schwierigkeiten, d. h.
vom Standpunkt eines vorschriftsmäßigen Schreibens
aus.
Aus der gegenständlichen Bedeutung der Zeichen
ist eine „buchstäbliche" geworden. Wesentlich ist je-
doch die Feststellung, daß er den jeweiligen Lautwert
derselben noch nicht kennt. Aus diesem Grunde setze
ich seine bisherigen „Buchstaben" absichtlich in An-
führungszeichen.
Auch in diesem 5. lebensjahre kommt es noch oft
vor, daß er seine „Buchstaben" über die ursprüngliche
und eigentliche Form hinaus erweitert, den so ent-
stehenden neuen Figuren z. T, wieder gegenständliche
Bedeutungen unterschiebt und ganze Geschichten dar-
aus ableitet. Ich bringe in diesem Zusammenhang das
Symbol des Sonnenrades, das er in den beiden Pro-
ben (Tafel III) aus eigener Kraft sinnvoll erweitert hat,
dem jedoch eine Menge einfacher Vorstufen voraus-
gehen.
Eine fesselnde Beobachtung, die ich auch bei ande-
ren Kindern gemacht habe, sei hier erwähnt. Oft wer-
den die „Buchstaben" in ihrem ganzen Zeilenaufbau
von rechts nach links oder auch innerhalb einer Zeile
die rechte Hälfte nach links umgetauscht. Es handelt
sich hier um eine Erscheinung, die sich nur aus dem
angeborenen Gefühl für Symmetrie, dem das von links
nach rechts gerichtete Schreiben noch nicht wie bei
uns Erwachsenen zur Gewohnheit geworden ist, er-
klären läßt. Die Tafel III zeigt einen ähnlichen Fall. Der
Junge schrieb zuerst die untere Zeile, kam rechts nicht
mehr aus und schrieb den Rest seines Namens dar-
über nach links mit ebenfalls nach links gerichteten
„Buchstaben".
Es ist nun lediglich eine Frage der Entwicklung und
damit der Zeit, wann das Kind imstande sein wird,
diese eigentätig erv/orbenen bildhaften Zeichen er-
folgreich mit einer endgültigen lautlichen Bedeutung
zu füllen, aus „Buchstaben" wirkliche Buchstaben zu
machen und die Ursprünglichkeit des einen mit der
Nutzanwendung im Sinne des anderen zu begreifen.
Hier handelt es sich jedoch um Leistungen, die auf
einer sozusagen anderen Ebene des menschlichen
Geistes, der Sprechfähigkeit liegen, und die uns nur
insoweit fesselt, als das Gedächtnis Zeichen und Laut
miteinander verbindet.
Das Beispiel des vorliegenden Falles ist typisch. Je-
des zeichnende und natürlich aufwachsende Kind ent-
wickelt sich in gleicher Art.
Die beigefügten erläuterten Tafeln mögen als der
eigentliche Beweis für die didaktische Bedeutung
der römischen Schrift dienen. Eine Fortführung dieser
Gedankengänge mit späterer Behandlung der Fraktur
aus der Praxis und für die Praxis des Schriftunter-
richts ist in Arbeit.
Tafel I (2.—4. Lebensjahr)
Bildhafte Zeichen ohne Buchstaben-
bedeutung (gegenständliche Bedeutung
schwankend)
1 (Zeitpunkt 12. Aug. 1929). Gerade Striche im Sande,
Parallel und rechtwinkelig geordnet. Gruppe unten
rechts auf einen gemeinsamen, aber nur gedachten
Mittelpunkt bezugnehmend. Enthält das I.
2a—g (12. Aug. 1929). Eiste Gestaltung des Kreises
im Sande. Zeigt die allmähliche und zielstrebige
Eroberung der Kreisform. Zugrunde liegendes Erleb-
nis: sich drehende „Schallplatte". Die Figuren sind
der Entstehungsfolge entsprechend geordnet, a: die
alte Art der bildhaften Aussage, sofort verworfen;
b und c: Ansatz des Kreises durch Gerade noch
gestört; d: wiederholter und kräftiger Ansatz zur
Drehung; e und f: „fertig!"; g: Triumpli der Kreis-
bewegung über die starre Kreisform. Enthält das O
als stärkste Gegenfigur zum I.
3—7 (Februar, März 1930). Bleistift. Figuren in deut-
licher Buchstabenform ohne Buchstabenbedeutung.
Die römische II, das E, Q, G, l.
8 a, b (Mai, Juni 1930). Bleistift. Striche um zwei Mittel-
figuren, Rechteck und Kreis. Im gröbsten Winkel
geordnet. „Tische mit was drauf!"
9 (17. Juni 1930), Bleistift. Erste Anordnung von Stri-
chen im spitzen Winkel, bezeichnet als (dreiecki-
ger) „Baustein". Der Junge wies selbst auf das
Neue dieser Leistung hin. Kehrt dann in zunehmen-
dem Maße immer häufiger wieder. Wichtig als Aus-
gangsleistung für das spitzwinklige V, W, A usw.
TAPEL I
10a
11 a &
188