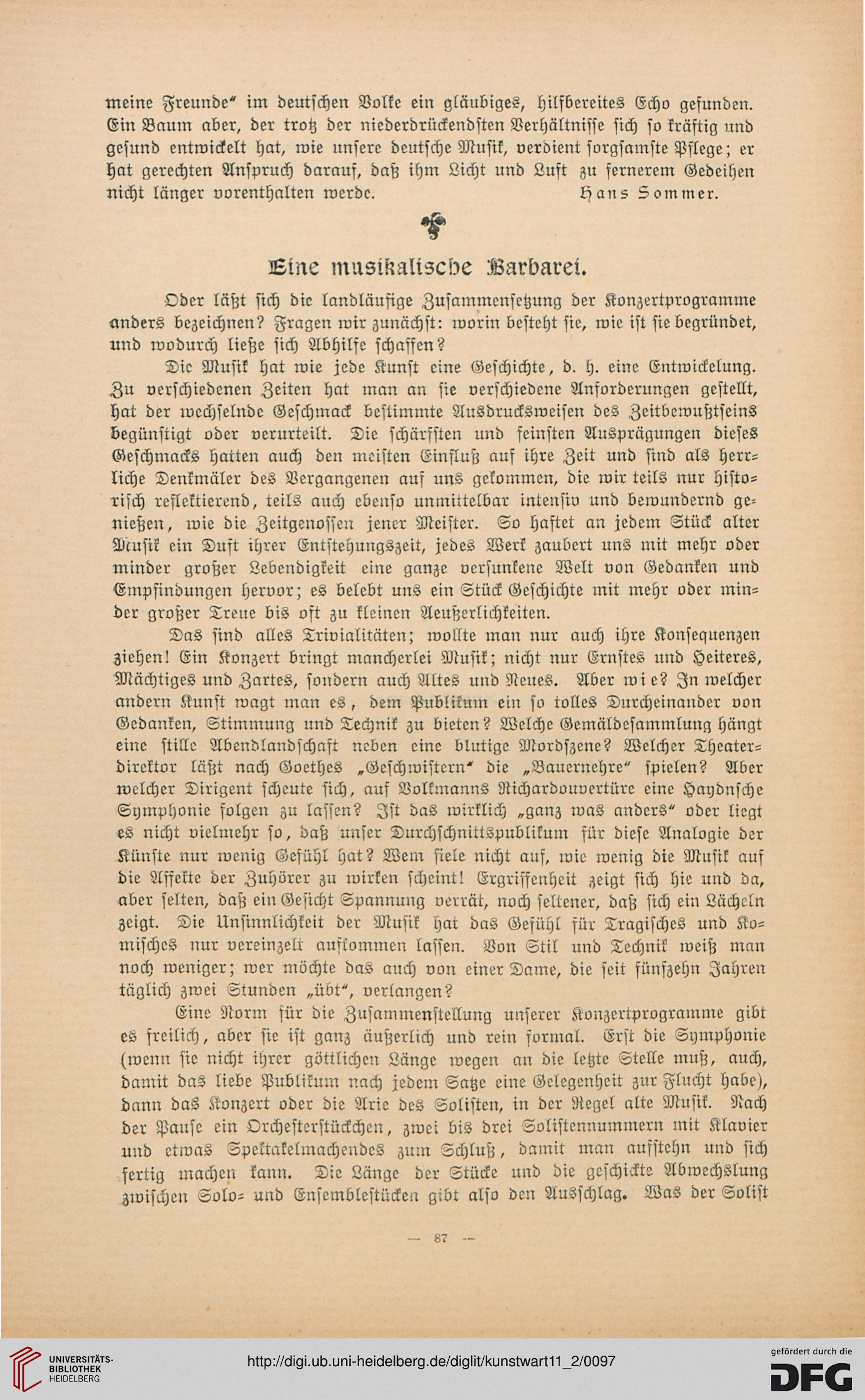rneine Freunde" im deutschen Volke ein gläubiges, hilfbereites Echo gefunden.
Ein Baum aber, der trotz der niederdrückendsten Verhältnisse sich so kräftig und
gesund entwickelt hat, wie unsere deutsche Musik, verdient sorgsamste Pflege; er
hat gerechten Anspruch darauf, daß ihm Licht und Luft zu sernerem Gedeihen
nicht länger rwrenthalten werde. ksans Sominer.
Lme musrkalisclie KArbArer.
Oder läßt sich dic landläufige Zusammensetzung der Konzertprogramme
anders bezeichnen? Fragen wir zunächst: worin bcsteht sie, wie ist sie begründet,
und wodurch ließe sich Abhilfe schaffen?
Dic Musik hat wie jede Kunst eine Geschichte, d. h. eine Entwickelung.
Zu verschiedenen Zeiten hat man an sie verschiedene Anforderungen gestellt,
hat der wechselnde Geschmack bestimmte Ausdrucksweisen des Zeitbewußtseins
begünstigt oder verurteilt. Die schärfsten und feinsten Ausprägungen dieses
Geschmacks hatten auch den meisten Einfluß auf ihre Zeit und sind als herr-
liche Denkmäler des Vergangenen auf uns gekommcn, die wir teils nur histo-
risch reflektierend, teils auch ebenso unmittelbar intensiv und bewundcrnd ge-
nießen, wie die Zeitgenossen jener Meister. So haftet an jedem Stück alter
Musik ein Duft ihrer Entstehungszeit, jedes Werk zaubert uns mit mehr oder
minder großer Lebendigkeit eine ganze versunkene Welt von Gedanken und
Empfindungen hervor; es belebt uns ein Stück Geschichte mit mehr oder min-
der großer Treue bis oft zu klsinen Aeußerlichkeiten.
Das sind alles Trivialitäten; wollte man nur auch ihre Konsequenzen
ziehen! Ein Konzert bringt mancherlei Musik; nicht nur Ernstes und Heiteres,
Mächtiges und Zartes, sondern auch Altes uud Neues. Aber w i e? Jn welcher
andern Kunst wagt man es, dem Publikum ein so tolles Durcheinander von
Gedanken, Stimmung und Technik zu bieten? Welchc Gemäldesammlung hängt
eine stille Abendlandschaft neben eine blutige Mordszene? Wclcher Theater-
direktor läßt nach Goethes .Geschwistcrn" die „Bauernehre" spielen? Aber
welcher Dirigcnt scheute sich, auf Volkmanns Richardouvertüre eine Hapdnsche
Symphonie folgen zu lassen? Jst das wirklich „ganz was anders" oder liegt
es nicht vielmehr so, daß unser Durchschnittspublikum für diese Analogie der
Künste nur wenig Gefühl hat? Wem fiele nicht auf, wie wenig die Musik auf
die Affekte der Zuhörer zu wirken scheint! Ergriffcnheit zeigt sich hie und da,
aber selten, daß ein Gesicht Spannung verrät, noch seltener, daß sich ein Lächcln
zeigt. Die Unsinnlichkeit der Musik hat das Gefühl für Tragisches und Ko-
mischcs nur vereinzelr auskommen lassen. Von Stil und Technik weiß man
noch weniger; wer möchte das auch von einer Dame, die seit fünfzehn Jahren
täglich zwei Stunden „übt", verlangen?
Eine Norm für die Zusammenstellung unserer Aonzertprogramme gibt
es freilich, aber sie ist ganz äußerlich und rein sormal. Erst die Spmphonie
(wenn sie nicht ihrer göttlichen Länge wegen an die letzte Stelle muß, auch,
damit das liebe Publirum nach jedem Satze eine Gclegenhcit zur Flucht habe),
dann das Konzert oder die Arie des Solisten, in der Regel alte Musik. Nach
der Pause ein Orchesterstückchen, zwei bis drei Solistcnnummern mit Klavier
und etwas Spektakelmachendes zum Schluß, damit man ausstehn und sich
fertig machen kann. Die Länge der Stücke und die gcschickts Abwechslung
zwischen Solo- und Ensemblestücken gibt also den Ausschlag. Was der Solist
87
Ein Baum aber, der trotz der niederdrückendsten Verhältnisse sich so kräftig und
gesund entwickelt hat, wie unsere deutsche Musik, verdient sorgsamste Pflege; er
hat gerechten Anspruch darauf, daß ihm Licht und Luft zu sernerem Gedeihen
nicht länger rwrenthalten werde. ksans Sominer.
Lme musrkalisclie KArbArer.
Oder läßt sich dic landläufige Zusammensetzung der Konzertprogramme
anders bezeichnen? Fragen wir zunächst: worin bcsteht sie, wie ist sie begründet,
und wodurch ließe sich Abhilfe schaffen?
Dic Musik hat wie jede Kunst eine Geschichte, d. h. eine Entwickelung.
Zu verschiedenen Zeiten hat man an sie verschiedene Anforderungen gestellt,
hat der wechselnde Geschmack bestimmte Ausdrucksweisen des Zeitbewußtseins
begünstigt oder verurteilt. Die schärfsten und feinsten Ausprägungen dieses
Geschmacks hatten auch den meisten Einfluß auf ihre Zeit und sind als herr-
liche Denkmäler des Vergangenen auf uns gekommcn, die wir teils nur histo-
risch reflektierend, teils auch ebenso unmittelbar intensiv und bewundcrnd ge-
nießen, wie die Zeitgenossen jener Meister. So haftet an jedem Stück alter
Musik ein Duft ihrer Entstehungszeit, jedes Werk zaubert uns mit mehr oder
minder großer Lebendigkeit eine ganze versunkene Welt von Gedanken und
Empfindungen hervor; es belebt uns ein Stück Geschichte mit mehr oder min-
der großer Treue bis oft zu klsinen Aeußerlichkeiten.
Das sind alles Trivialitäten; wollte man nur auch ihre Konsequenzen
ziehen! Ein Konzert bringt mancherlei Musik; nicht nur Ernstes und Heiteres,
Mächtiges und Zartes, sondern auch Altes uud Neues. Aber w i e? Jn welcher
andern Kunst wagt man es, dem Publikum ein so tolles Durcheinander von
Gedanken, Stimmung und Technik zu bieten? Welchc Gemäldesammlung hängt
eine stille Abendlandschaft neben eine blutige Mordszene? Wclcher Theater-
direktor läßt nach Goethes .Geschwistcrn" die „Bauernehre" spielen? Aber
welcher Dirigcnt scheute sich, auf Volkmanns Richardouvertüre eine Hapdnsche
Symphonie folgen zu lassen? Jst das wirklich „ganz was anders" oder liegt
es nicht vielmehr so, daß unser Durchschnittspublikum für diese Analogie der
Künste nur wenig Gefühl hat? Wem fiele nicht auf, wie wenig die Musik auf
die Affekte der Zuhörer zu wirken scheint! Ergriffcnheit zeigt sich hie und da,
aber selten, daß ein Gesicht Spannung verrät, noch seltener, daß sich ein Lächcln
zeigt. Die Unsinnlichkeit der Musik hat das Gefühl für Tragisches und Ko-
mischcs nur vereinzelr auskommen lassen. Von Stil und Technik weiß man
noch weniger; wer möchte das auch von einer Dame, die seit fünfzehn Jahren
täglich zwei Stunden „übt", verlangen?
Eine Norm für die Zusammenstellung unserer Aonzertprogramme gibt
es freilich, aber sie ist ganz äußerlich und rein sormal. Erst die Spmphonie
(wenn sie nicht ihrer göttlichen Länge wegen an die letzte Stelle muß, auch,
damit das liebe Publirum nach jedem Satze eine Gclegenhcit zur Flucht habe),
dann das Konzert oder die Arie des Solisten, in der Regel alte Musik. Nach
der Pause ein Orchesterstückchen, zwei bis drei Solistcnnummern mit Klavier
und etwas Spektakelmachendes zum Schluß, damit man ausstehn und sich
fertig machen kann. Die Länge der Stücke und die gcschickts Abwechslung
zwischen Solo- und Ensemblestücken gibt also den Ausschlag. Was der Solist
87