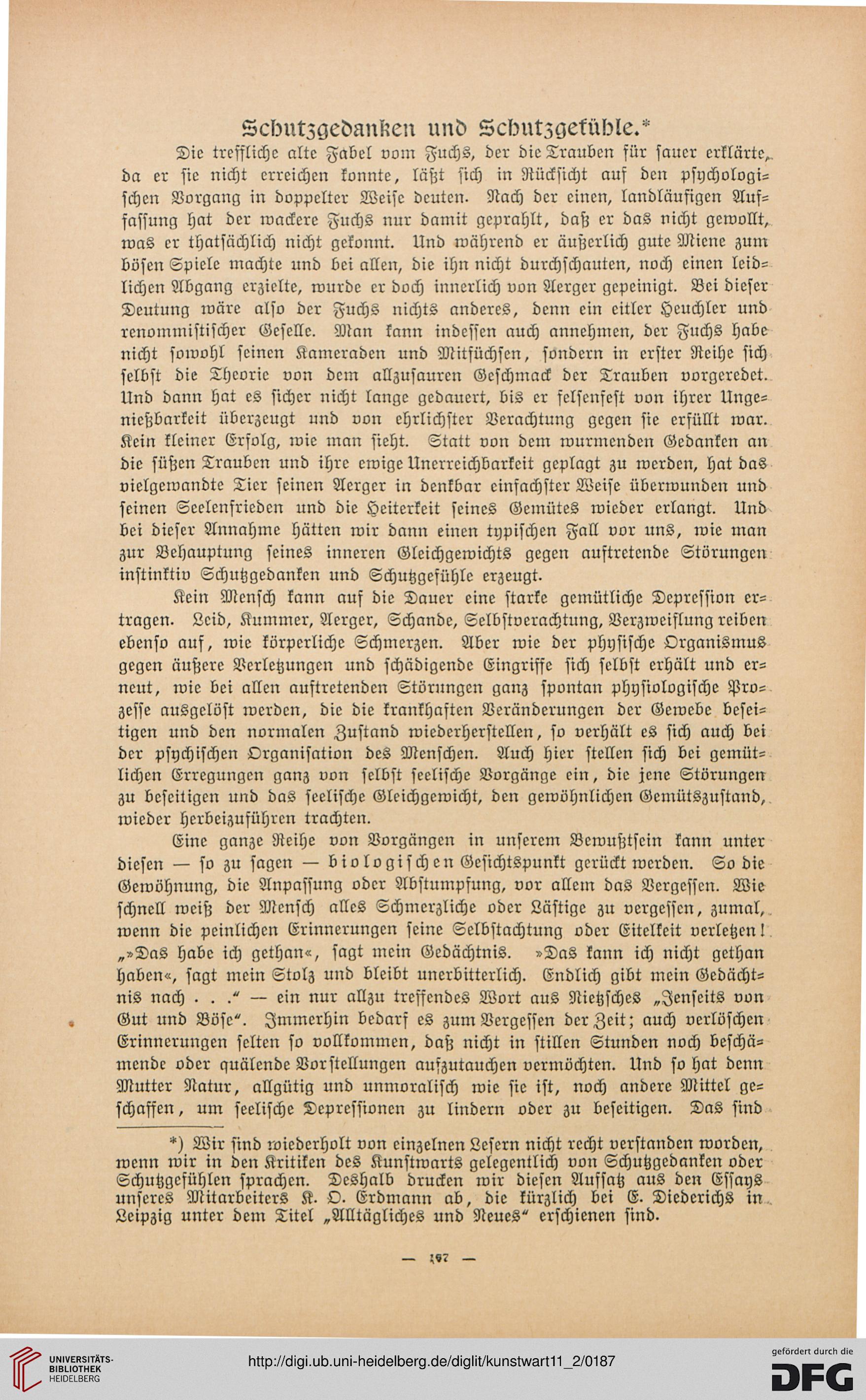Scbntzgedmiken und Lcdutzgetüdle.^
Dic trefflichc alte Fabel vom Fuchs, der die Trauben für saucr erklärte^
da er sie nicht crreichen konnte, läßt sich in Rücksicht auf den psychologi-
schen Vorgang in doppelter Weise deuten. Nach der einen, landläufigen Auf-
fassung hat der rvackere Fuchs nur damit geprahlt, daß er das nicht gewollt,
was er thatsächlich nicht gekonnt. Und während er äußerlich gute Micne zum
bösen Spiele machte und bei allen, die ihn nicht durchschauten, noch einen leid-
lichen Abgang erzielte, wurde er doch innerlich von Aerger gepeinigt. Bei dieser
Deutung wäre also der Fuchs nichts anderes, dcnn ein eitler Heuchler und
renommistischer Geselle. Man kann indessen auch annehmen, der Fuchs habe
nicht sowohl seincn Kameraden und Mitfüchsen, sondorn in erster Reihe sich
selbst die Theorie von dem allzusauren Geschmack der Trauben vorgeredet.
Und dann hat es sichcr nicht lange gedauert, bis er felsensest von ihrer Unge-
nießbarkeit überzcugt und von ehrlichster Verachtung gegen sie erfüllt war.
Kein kleiner Erfolg, wie man sieht. Statt von dom wurmenden Gedankcn an
die süßen Traubcn und ihre ewige Unerreichbarkeit geplagt zu werden, hat das
vielgewandte Tier seinen Aerger in denkbar einfachster Weise überwunden und
seinen Seelenfrieden und die Heiterkeit seines Gemütes wieder erlangt. Und
bei dieser Annahme hätten wir dann einen typischen Fall vor uns, wie man
zur Behauptung scines inneren Gleichgewichts gegen auftretende Störungen
instinktiv Schutzgedanken und Schutzgefühle erzeugt.
Kein Mensch kann auf die Dauer eine starke gomütliche Deprcssion er-
tragen. Lcid, Kummer, Aerger, Schande, Selbstverachtung, Verzweiflung reiben
ebenso auf, wie körperliche Schmerzen. Aber wie der physische Organismus
gegen äußere Verletzungen und schädigende Eingriffe sich selbst erhält und er-
ncut, wie bei allen auftretenden Störungen ganz spontan physiologische Pro-
zesse ausgelöst werden, die die krankhasten Veränderungen der Gewebe besei-
tigen und den normalen Zustand wiederherstellen, so verhält es sich auch bei
der psychischen Organisation des Menschen. Auch hier stellon sich bei gemüt-
lichcn Erregungen ganz von selbst seelische Vorgänge ein, die jene Störungen
zu beseitigen und das seelische Gleichgewicht, den gewöhnlichen Gemütszustand,
wieder herbeizuführen trachten.
Eine ganze Reihe von Vorgängen in unserem Bewußtscin kann unter
diesen — so zu sagcn — biologischen Gesichtspunkt gerückt wcrdcn. So die
Gewöhnung, die Anpassung odcr Abstumpfung, vor allem das Vergessen. Wie
schnell weiß der Mcnsch allcs Schmerzliche oder Lästige zu vergesscn, zumal,
wenn die pcinlichen Erinnerungen seine Selbstachtung oder Eitelkeit verletzen l
„»Das habe ich gethan-, sagt mein Gedächtnis. »Das kann ich nicht gethan
haben«, sagt mein Stolz und bleibt unerbitterlich. Endlich gibt mein Gedächt-
nis nach ..." — ein nur allzu treffendes Wort aus NietzscheS „Jenseits von
Gut und Böse". Jmmerhin bedarf es zum Vergessen der Zeit; auch verlöschen
Erinnerungen selten so vollkommen, daß nicht in stillen Stunden noch beschä-
mendc oder quälende Vorstellungen auszutauchen vermöchten. Und so hat denn
Mutter Natur, allgütig und unmoralisch wie sie ist, noch andere Mittel ge-
schaffen, um seelische Depressionen zu lindern oder zu beseitigen. Das sind
*) Wir sind wiederholt von cinzelnen Lesern nicht rccht verstanden worden,
wenn wir in den Kritiken des Kunstwarts gelegentlich von Schutzgcdanken odcr
Schutzgefühlen sprachen. Deshalb druckcn wir diesen Aufsatz aus den Essays
unseres Mitarbeiters K- O. Erdmann ab, die kürzlich bei E- Diedcrichs in
Leipzig unter dem Titel „Alltägliches und Neues" erschienen sind.
Dic trefflichc alte Fabel vom Fuchs, der die Trauben für saucr erklärte^
da er sie nicht crreichen konnte, läßt sich in Rücksicht auf den psychologi-
schen Vorgang in doppelter Weise deuten. Nach der einen, landläufigen Auf-
fassung hat der rvackere Fuchs nur damit geprahlt, daß er das nicht gewollt,
was er thatsächlich nicht gekonnt. Und während er äußerlich gute Micne zum
bösen Spiele machte und bei allen, die ihn nicht durchschauten, noch einen leid-
lichen Abgang erzielte, wurde er doch innerlich von Aerger gepeinigt. Bei dieser
Deutung wäre also der Fuchs nichts anderes, dcnn ein eitler Heuchler und
renommistischer Geselle. Man kann indessen auch annehmen, der Fuchs habe
nicht sowohl seincn Kameraden und Mitfüchsen, sondorn in erster Reihe sich
selbst die Theorie von dem allzusauren Geschmack der Trauben vorgeredet.
Und dann hat es sichcr nicht lange gedauert, bis er felsensest von ihrer Unge-
nießbarkeit überzcugt und von ehrlichster Verachtung gegen sie erfüllt war.
Kein kleiner Erfolg, wie man sieht. Statt von dom wurmenden Gedankcn an
die süßen Traubcn und ihre ewige Unerreichbarkeit geplagt zu werden, hat das
vielgewandte Tier seinen Aerger in denkbar einfachster Weise überwunden und
seinen Seelenfrieden und die Heiterkeit seines Gemütes wieder erlangt. Und
bei dieser Annahme hätten wir dann einen typischen Fall vor uns, wie man
zur Behauptung scines inneren Gleichgewichts gegen auftretende Störungen
instinktiv Schutzgedanken und Schutzgefühle erzeugt.
Kein Mensch kann auf die Dauer eine starke gomütliche Deprcssion er-
tragen. Lcid, Kummer, Aerger, Schande, Selbstverachtung, Verzweiflung reiben
ebenso auf, wie körperliche Schmerzen. Aber wie der physische Organismus
gegen äußere Verletzungen und schädigende Eingriffe sich selbst erhält und er-
ncut, wie bei allen auftretenden Störungen ganz spontan physiologische Pro-
zesse ausgelöst werden, die die krankhasten Veränderungen der Gewebe besei-
tigen und den normalen Zustand wiederherstellen, so verhält es sich auch bei
der psychischen Organisation des Menschen. Auch hier stellon sich bei gemüt-
lichcn Erregungen ganz von selbst seelische Vorgänge ein, die jene Störungen
zu beseitigen und das seelische Gleichgewicht, den gewöhnlichen Gemütszustand,
wieder herbeizuführen trachten.
Eine ganze Reihe von Vorgängen in unserem Bewußtscin kann unter
diesen — so zu sagcn — biologischen Gesichtspunkt gerückt wcrdcn. So die
Gewöhnung, die Anpassung odcr Abstumpfung, vor allem das Vergessen. Wie
schnell weiß der Mcnsch allcs Schmerzliche oder Lästige zu vergesscn, zumal,
wenn die pcinlichen Erinnerungen seine Selbstachtung oder Eitelkeit verletzen l
„»Das habe ich gethan-, sagt mein Gedächtnis. »Das kann ich nicht gethan
haben«, sagt mein Stolz und bleibt unerbitterlich. Endlich gibt mein Gedächt-
nis nach ..." — ein nur allzu treffendes Wort aus NietzscheS „Jenseits von
Gut und Böse". Jmmerhin bedarf es zum Vergessen der Zeit; auch verlöschen
Erinnerungen selten so vollkommen, daß nicht in stillen Stunden noch beschä-
mendc oder quälende Vorstellungen auszutauchen vermöchten. Und so hat denn
Mutter Natur, allgütig und unmoralisch wie sie ist, noch andere Mittel ge-
schaffen, um seelische Depressionen zu lindern oder zu beseitigen. Das sind
*) Wir sind wiederholt von cinzelnen Lesern nicht rccht verstanden worden,
wenn wir in den Kritiken des Kunstwarts gelegentlich von Schutzgcdanken odcr
Schutzgefühlen sprachen. Deshalb druckcn wir diesen Aufsatz aus den Essays
unseres Mitarbeiters K- O. Erdmann ab, die kürzlich bei E- Diedcrichs in
Leipzig unter dem Titel „Alltägliches und Neues" erschienen sind.