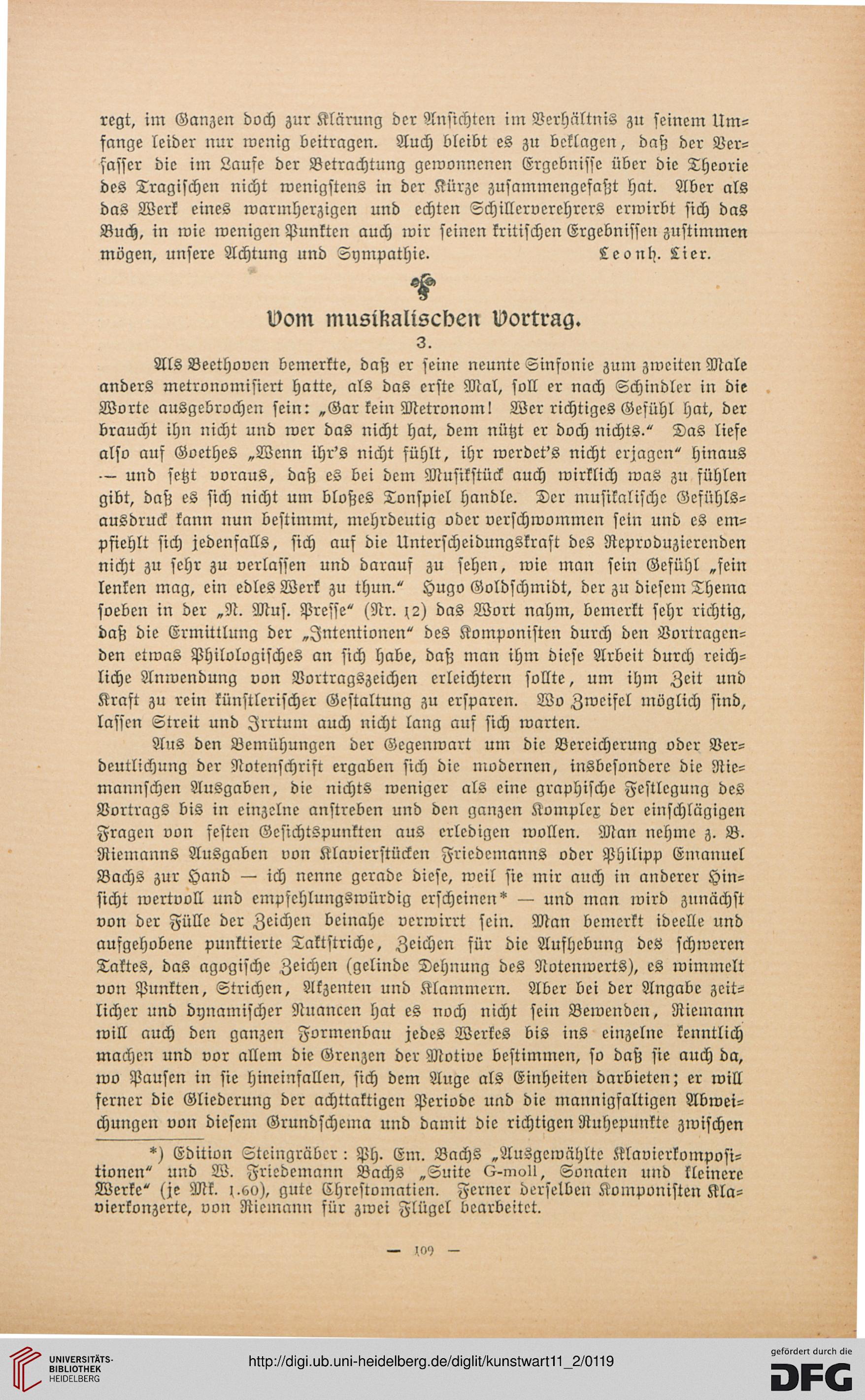regt, im Ganzen doch zur Klärung der Ansichten im Verhältnis zu seinem Um-
fange leider nur wenig beitragen. Auch bleibt es zu beklagen, daß der Ver-
fasser dic im Laufe der Betrachtung gewonnenen Ergebnisse über die Theorie
des Tragischen nicht wenigstens in der Kürze zusammengefaßt hat. Aber als
das Werk eines warmherzigcn und echten Schillerverehrers erwirbt sich das
Buch, in wie wenigen Punkten auch wir seinen kritischen Ergebnissen zustimmen
mögen, unsere Achtung und Sympathie. Leonh. Lier.
vom musikklliscben vortrag.
3.
Als Beethoven bemerkte, daß er seine neunte Sinfonie zum zweiten Male
anders metronomisiert hatte, als das erste Mal, soll er nach Schindler in die
Worte ausgebrochen sein: »Gar kein Metronom! Wer richtiges Gefühl hat, der
braucht ihn nicht und wer das nicht hat, dem nützt er doch nichts." Das liefe
also auf Goethes „Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen" hinaus
— und setzt voraus, daß es bei dem Musikstück auch wirklich was zu fühlen
gibt, daß es sich nicht um bloßes Tonspiel handle. Dcr musikalische Gefühls-
ausdruck kann nun bestimmt, mehrdeutig oder verschwommen sein und es cm-
pfiehlt sich jedenfalls, sich aus die Unterscheidungskraft des Reproduzicrenden
nicht zu sehr zu verlassen und darauf zu sehen, wie man sein Gefühl „fein
lenken mag, ein edles Werk zu thun." Hugo Goldschmidt, der zu diesem Thema
soeben in der „N. Mus. Presse" (Nr. ;2) das Wort nahm, bemerkt sehr richtig,
daß die Ermittlung der „Jntentionen" des Komponisten durch den Vortragen-
den etwas Philologisches an sich habe, daß man ihm diese Arbeit durch reich-
liche Anwendung von Vortragszeichen erleichtern sollte, um ihm Zeit und
Kraft zu rein künstlerischer Gestaltung zu ersparen. Wo Zweifcl möglich sind,
lassen Streit und Irrtum auch nicht lang auf sich warten.
Aus den Bemühungen der Gegenwart um die Bereicherung oder Ver-
deutlichung der Notenschrift ergaben sich die modernen, insbesondere die Nie-
mannschen Ausgaben, die nichts weniger als cine graphische Festlcgung des
Vortrags bis in einzelne anstreben und den ganzen Komplex der einschlägigen
Fragen von festen Gesichtspunkten aus erledigen wollen. Man nehme z. B.
Riemanns Ausgabcn von Klavierstücken Friedomanns oder Philipp Emanuel
Bachs zur Hand — ich nenne gerade diese, wcil sie mir auch in anderer Hin-
sicht wertvoll und empsehlungswürdig erscheincn* — und man wird zunächst
von der Fülle der Zeichen beinahe vcrwirrt sein. Man bemerkt ideelle und
aufgehobene punktierte Taktstriche, Zeichen für die Aufhebung des schweren
Taktes, das agogische Zeichen (gelinde Dehnung des Notenwerts), es wimmelt
von Punkten, Strichen, Akzenten und Klammern. Aber bci der Angabe zcit-
licher und dynamischer Nuancen hat es noch nicht sein Bewenden, Riemann
will auch den ganzcn Formenbau jedes Werkes bis ins einzelne kenntlich
machcn und vor allem die Grenzen der Motive bestimmen, so daß sie auch da,
wo Pausen in sie hineinfallen, sich dem Auge als Einheiten darbieten; er will
ferner die Gliederung der achttaktigen Periode und die mannigfaltigen Abwei-
chungen von diesem Grundschema und damit die richtigcn Nuhepunkte zwischen
*) Edition Steingräber: Ph. Em. Bachs „Ausgewählte Klavierkomposi-
tionen" und W. Friedemann Bachs „Suite 6-irioll, Sonnten und kloinere
Werke" (je Mk. ;.so), gute Chresromatien. Fcrner derselben Komponisten Kla-
vierkonzerte, von Riemnnn für zwci Flügcl bearbeitet.
fange leider nur wenig beitragen. Auch bleibt es zu beklagen, daß der Ver-
fasser dic im Laufe der Betrachtung gewonnenen Ergebnisse über die Theorie
des Tragischen nicht wenigstens in der Kürze zusammengefaßt hat. Aber als
das Werk eines warmherzigcn und echten Schillerverehrers erwirbt sich das
Buch, in wie wenigen Punkten auch wir seinen kritischen Ergebnissen zustimmen
mögen, unsere Achtung und Sympathie. Leonh. Lier.
vom musikklliscben vortrag.
3.
Als Beethoven bemerkte, daß er seine neunte Sinfonie zum zweiten Male
anders metronomisiert hatte, als das erste Mal, soll er nach Schindler in die
Worte ausgebrochen sein: »Gar kein Metronom! Wer richtiges Gefühl hat, der
braucht ihn nicht und wer das nicht hat, dem nützt er doch nichts." Das liefe
also auf Goethes „Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen" hinaus
— und setzt voraus, daß es bei dem Musikstück auch wirklich was zu fühlen
gibt, daß es sich nicht um bloßes Tonspiel handle. Dcr musikalische Gefühls-
ausdruck kann nun bestimmt, mehrdeutig oder verschwommen sein und es cm-
pfiehlt sich jedenfalls, sich aus die Unterscheidungskraft des Reproduzicrenden
nicht zu sehr zu verlassen und darauf zu sehen, wie man sein Gefühl „fein
lenken mag, ein edles Werk zu thun." Hugo Goldschmidt, der zu diesem Thema
soeben in der „N. Mus. Presse" (Nr. ;2) das Wort nahm, bemerkt sehr richtig,
daß die Ermittlung der „Jntentionen" des Komponisten durch den Vortragen-
den etwas Philologisches an sich habe, daß man ihm diese Arbeit durch reich-
liche Anwendung von Vortragszeichen erleichtern sollte, um ihm Zeit und
Kraft zu rein künstlerischer Gestaltung zu ersparen. Wo Zweifcl möglich sind,
lassen Streit und Irrtum auch nicht lang auf sich warten.
Aus den Bemühungen der Gegenwart um die Bereicherung oder Ver-
deutlichung der Notenschrift ergaben sich die modernen, insbesondere die Nie-
mannschen Ausgaben, die nichts weniger als cine graphische Festlcgung des
Vortrags bis in einzelne anstreben und den ganzen Komplex der einschlägigen
Fragen von festen Gesichtspunkten aus erledigen wollen. Man nehme z. B.
Riemanns Ausgabcn von Klavierstücken Friedomanns oder Philipp Emanuel
Bachs zur Hand — ich nenne gerade diese, wcil sie mir auch in anderer Hin-
sicht wertvoll und empsehlungswürdig erscheincn* — und man wird zunächst
von der Fülle der Zeichen beinahe vcrwirrt sein. Man bemerkt ideelle und
aufgehobene punktierte Taktstriche, Zeichen für die Aufhebung des schweren
Taktes, das agogische Zeichen (gelinde Dehnung des Notenwerts), es wimmelt
von Punkten, Strichen, Akzenten und Klammern. Aber bci der Angabe zcit-
licher und dynamischer Nuancen hat es noch nicht sein Bewenden, Riemann
will auch den ganzcn Formenbau jedes Werkes bis ins einzelne kenntlich
machcn und vor allem die Grenzen der Motive bestimmen, so daß sie auch da,
wo Pausen in sie hineinfallen, sich dem Auge als Einheiten darbieten; er will
ferner die Gliederung der achttaktigen Periode und die mannigfaltigen Abwei-
chungen von diesem Grundschema und damit die richtigcn Nuhepunkte zwischen
*) Edition Steingräber: Ph. Em. Bachs „Ausgewählte Klavierkomposi-
tionen" und W. Friedemann Bachs „Suite 6-irioll, Sonnten und kloinere
Werke" (je Mk. ;.so), gute Chresromatien. Fcrner derselben Komponisten Kla-
vierkonzerte, von Riemnnn für zwci Flügcl bearbeitet.