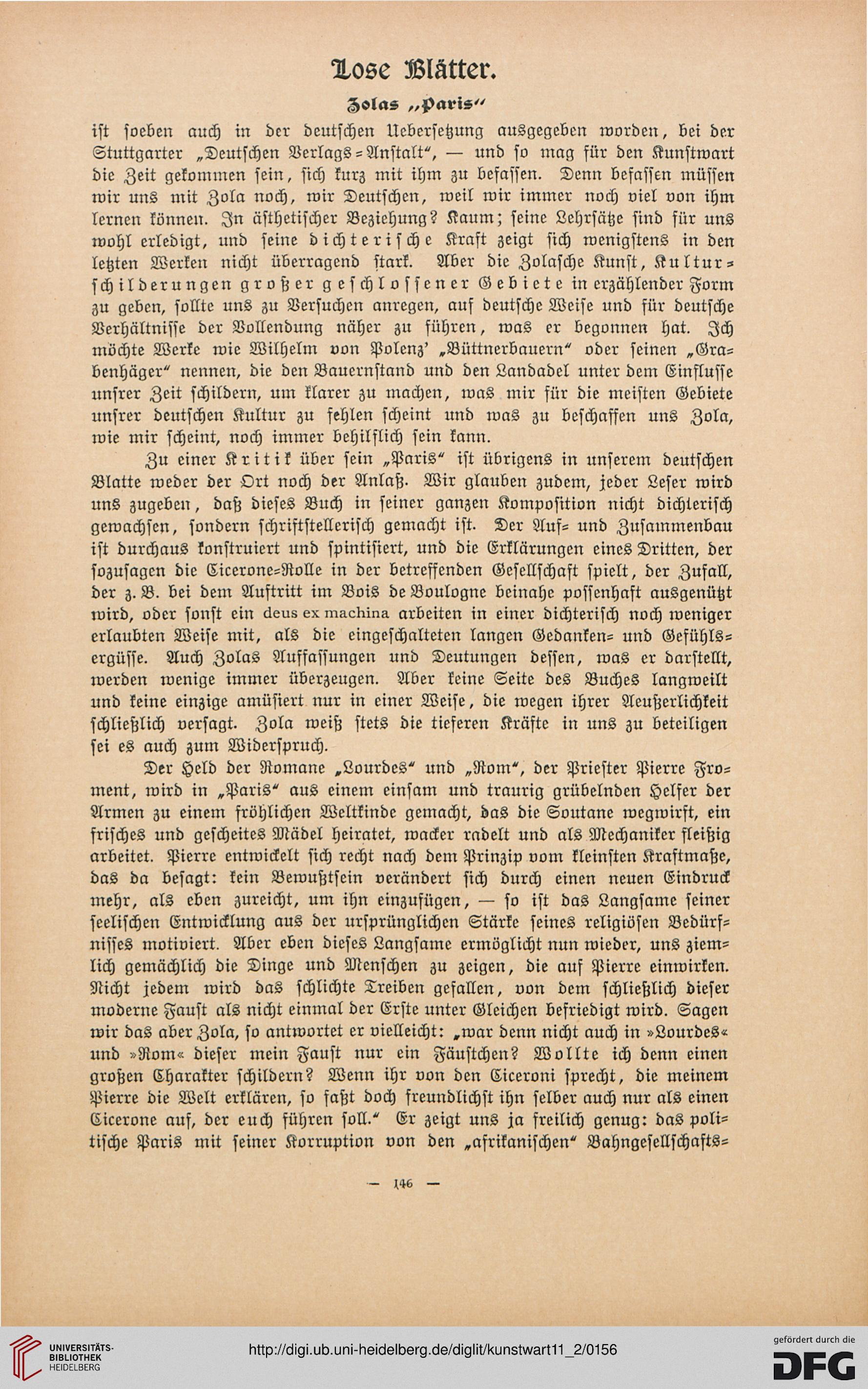Lose Vlätter.
Zolas „paris"
ist soeben auch in der deutschen Ucbersetzung ausgegeben worden, bei der
Stuttgarter „Deutschen Verlags-Anstalt", — und so mag für den Kunstwart
die Zeit gekommen sein, sich kurz mit ihm zu befassen. Denn bsfassen müssen
wir uns mit Zola noch, wir Deutschcn, weil wir immer noch viel von ihm
lernen können. Jn ästhetischer Beziehung? Kaum; seine Lehrsätze sind für uns
wohl erledigt, und seine dichterische Kraft zeigt sich wenigstens in den
letzten Werken nicht überragend ftark. Aber die Zolasche Kunst, Kultur-
schilderungen grotzer geschlossener Gebiete in erzählender Form
zu geben, sollte uns zu Versuchen anregen, auf deutsche Weise und für deutsche
Verhältnisse der Vollendung näher zu führen, was er begonnen hat. Jch
möchte Werke wie Wilhelm von Polcnz' .Büttnerbauern" oder seinen „Gra-
benhäger" nennen, die den Bauernstand und den Landadel unter dem Einflusse
unsrer Zeit schildern, um klarer zu machen, was mir für die meisten Gebiete
unsrer deutschen Kultur zu fehlen scheint und was zu beschaffen uns Zola,
wie mir scheint, noch immer behilflich sein kann.
Zu einer Kritik über sein „Paris" ist übrigens in unserem deutschen
Blatte weder der Ort noch der Anlaß. Wir glauben zudem, jeder Leser wird
uns zugeben, dah dieses Buch in seiner ganzen Komposition nicht dichterisch
gewachsen, sondern schriststellerisch gemacht ist. Der Auf- und Zusammenbau
ist durchaus konstruiert und spintisiert, und die Erklärungen eines Dritten, der
sozusagen die Cicerone-Rolle in der betreffenden Gesellschaft spielt, der Zufall,
der z. B. bei dem Auftritt im Bois de Boulogne bcinahe possenhaft ausgenützt
wird, oder sonst ein cteus ex nnmllm-i. arbeiten in einer dichterisch noch weniger
erlaubten Weise mit, als die eingeschalteten langen Gedanken- und Gefühls-
ergüsse. Auch Zolas Auffassungen und Deutungen dessen, was er darstellt,
werden wenige immer überzeugen. Aber keine Seite des Buches langweilt
und keine einzige amüsiert nur in einer Weise, die wegen ihrer Aeutzerlichkeit
schließlich versagt. Zola weiß stets die tieferen Kräfte in uns zu beteiligen
sei es auch zum Widerspruch.
Der Hcld der Romane .Lourdes" und „Rom", der Priester Pierre Fro-
ment, wird in .Paris" aus einem einsam und traurig grübelnden Helfer der
Armen zu einem fröhlichen Weltkinde gemacht, das die Soutane wegwirft, ein
frisches und gescheites Mädel heiratet, wacker radelt und als Mechaniker sleißig
arbeitet. Pierre entwickelt sich recht nach dem Prinzip vom kleinsten Kraftmahe,
das da besagt: kein Bewutztsein verändert sich durch einen neuen Eindruck
mehr, als cben zureicht, um ihn einzufügen, — so ist das Langsame seiner
seelischen Entwicklung aus dcr ursprünglichen Stärkc seines religiösen Bedürf-
nisses inotiviert. Aber eben dieses Langsame ermöglicht nun wieder, uns ziem-
lich gemächlich die Dinge und Menschen zu zeigen, die auf Pierre einwirken.
Nicht jedem wird das schlichte Treiben gefallen, von dem schlietzlich dieser
moderne Faust als nicht einmal der Erste unter Gleichen befriedigt wird. Sagen
wir das aber Zola, so antwortet er vielleicht: ,war denn nicht auch in »Lourdes«
und »Rom« dieser mein Faust nur ein Fäustchen? Wollte ich denn einen
grotzen Charakter schildern? Wenn ihr von den Ciceroni sprecht, die meinem
Pierre die Welt erklären, so faßt doch freundlichst ihn selber auch nur als einen
Cicerone auf, der euch führen soll." Er zeigt uns ja freilich genug: das poli-
tische Paris mit seiner Korruption von den .afrikanischen" Bahngesellschafts-
Zolas „paris"
ist soeben auch in der deutschen Ucbersetzung ausgegeben worden, bei der
Stuttgarter „Deutschen Verlags-Anstalt", — und so mag für den Kunstwart
die Zeit gekommen sein, sich kurz mit ihm zu befassen. Denn bsfassen müssen
wir uns mit Zola noch, wir Deutschcn, weil wir immer noch viel von ihm
lernen können. Jn ästhetischer Beziehung? Kaum; seine Lehrsätze sind für uns
wohl erledigt, und seine dichterische Kraft zeigt sich wenigstens in den
letzten Werken nicht überragend ftark. Aber die Zolasche Kunst, Kultur-
schilderungen grotzer geschlossener Gebiete in erzählender Form
zu geben, sollte uns zu Versuchen anregen, auf deutsche Weise und für deutsche
Verhältnisse der Vollendung näher zu führen, was er begonnen hat. Jch
möchte Werke wie Wilhelm von Polcnz' .Büttnerbauern" oder seinen „Gra-
benhäger" nennen, die den Bauernstand und den Landadel unter dem Einflusse
unsrer Zeit schildern, um klarer zu machen, was mir für die meisten Gebiete
unsrer deutschen Kultur zu fehlen scheint und was zu beschaffen uns Zola,
wie mir scheint, noch immer behilflich sein kann.
Zu einer Kritik über sein „Paris" ist übrigens in unserem deutschen
Blatte weder der Ort noch der Anlaß. Wir glauben zudem, jeder Leser wird
uns zugeben, dah dieses Buch in seiner ganzen Komposition nicht dichterisch
gewachsen, sondern schriststellerisch gemacht ist. Der Auf- und Zusammenbau
ist durchaus konstruiert und spintisiert, und die Erklärungen eines Dritten, der
sozusagen die Cicerone-Rolle in der betreffenden Gesellschaft spielt, der Zufall,
der z. B. bei dem Auftritt im Bois de Boulogne bcinahe possenhaft ausgenützt
wird, oder sonst ein cteus ex nnmllm-i. arbeiten in einer dichterisch noch weniger
erlaubten Weise mit, als die eingeschalteten langen Gedanken- und Gefühls-
ergüsse. Auch Zolas Auffassungen und Deutungen dessen, was er darstellt,
werden wenige immer überzeugen. Aber keine Seite des Buches langweilt
und keine einzige amüsiert nur in einer Weise, die wegen ihrer Aeutzerlichkeit
schließlich versagt. Zola weiß stets die tieferen Kräfte in uns zu beteiligen
sei es auch zum Widerspruch.
Der Hcld der Romane .Lourdes" und „Rom", der Priester Pierre Fro-
ment, wird in .Paris" aus einem einsam und traurig grübelnden Helfer der
Armen zu einem fröhlichen Weltkinde gemacht, das die Soutane wegwirft, ein
frisches und gescheites Mädel heiratet, wacker radelt und als Mechaniker sleißig
arbeitet. Pierre entwickelt sich recht nach dem Prinzip vom kleinsten Kraftmahe,
das da besagt: kein Bewutztsein verändert sich durch einen neuen Eindruck
mehr, als cben zureicht, um ihn einzufügen, — so ist das Langsame seiner
seelischen Entwicklung aus dcr ursprünglichen Stärkc seines religiösen Bedürf-
nisses inotiviert. Aber eben dieses Langsame ermöglicht nun wieder, uns ziem-
lich gemächlich die Dinge und Menschen zu zeigen, die auf Pierre einwirken.
Nicht jedem wird das schlichte Treiben gefallen, von dem schlietzlich dieser
moderne Faust als nicht einmal der Erste unter Gleichen befriedigt wird. Sagen
wir das aber Zola, so antwortet er vielleicht: ,war denn nicht auch in »Lourdes«
und »Rom« dieser mein Faust nur ein Fäustchen? Wollte ich denn einen
grotzen Charakter schildern? Wenn ihr von den Ciceroni sprecht, die meinem
Pierre die Welt erklären, so faßt doch freundlichst ihn selber auch nur als einen
Cicerone auf, der euch führen soll." Er zeigt uns ja freilich genug: das poli-
tische Paris mit seiner Korruption von den .afrikanischen" Bahngesellschafts-