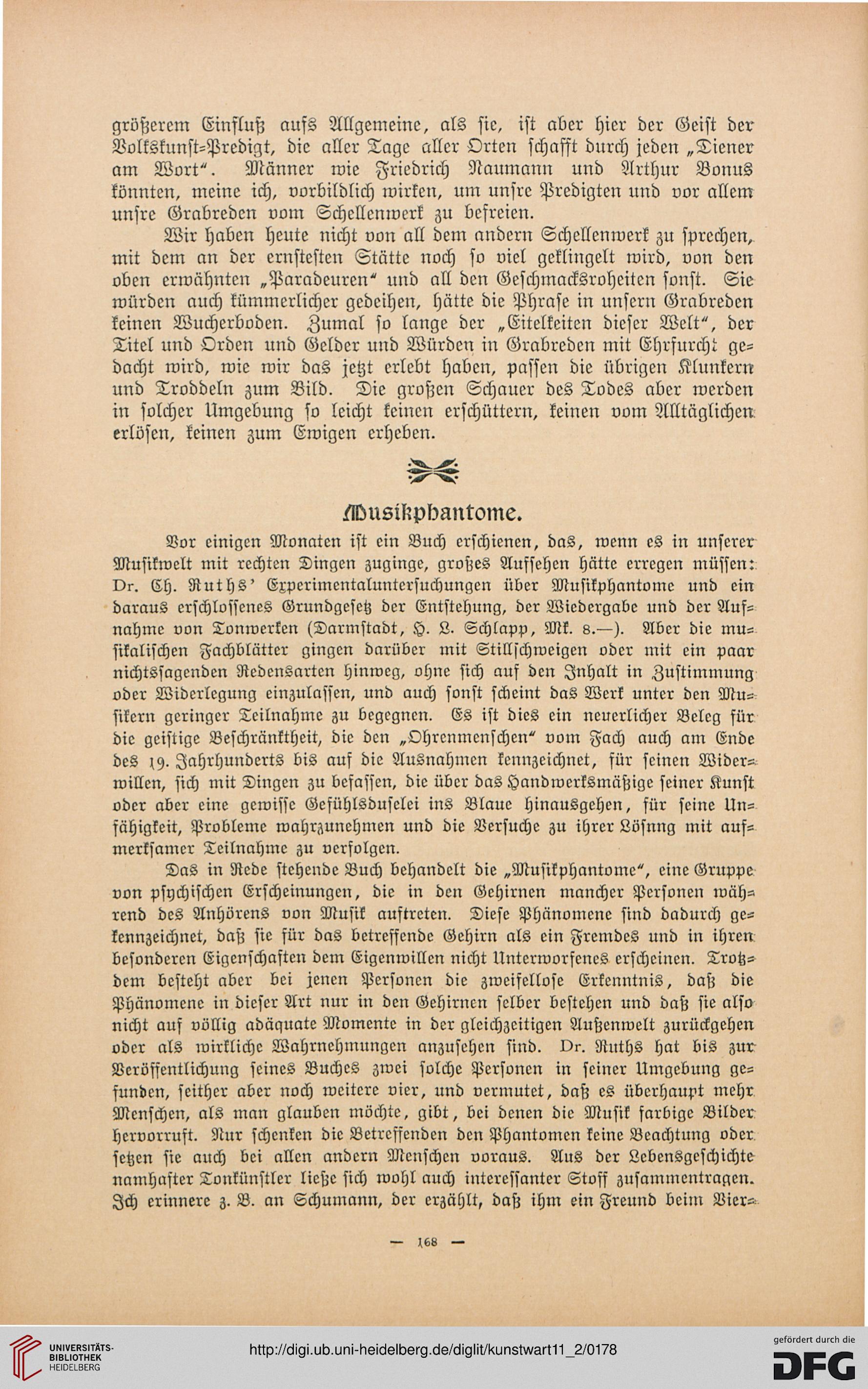größerem Einfluß cmfs Allgemeine, als fie, ist aber hier der Geist dev
Volkskunst-Predigt, die aller Tage aller Orten schafft durch jeden „Tiener
am Wort"'. Männer wie Friedrich Naumann und Arthur Bonus
könnten, meine ich, vorbildlich wirken, um unsre Predigten und vor allem
unsrc Grabreden vom Schellenwerk zu befreien.
Wir haben heute nicht von all dem andern Schellenwerk zu sprechen,
mit dem an der ernstesten Stätte noch so viel geklingelt wird, von den
oben erwähnten „Paradeuren" und all den Geschmacksroheitcn sonst. Sie
würden auch kümmerlicher gedeihen, hätte die Phrase in unsern Grabredcn
keinen Wucherboden. Zumal so lange der „Eitelkeitcn dicser Welt", der
Titel und Orden und Gelder und Würden in Grabreden mit Ehrfurcht ge-
dacht wird, wie wir das jetzt erlebt haben, passen die übrigen Klunkern
und Troddeln zum Bild. Die großen Schauer des Todes aber werden
in solcher Umgebung so leicht keinen erschüttern, keinen vom Alltäglichen
erlösen, keinen zum Ewigen erheben.
/Dusikpbantome.
Vor einigen Monaten ist ein Buch erschienen, das, wenn es in unserer
Musikwelt mit rechten Dingen zuginge, großes Aussehen hätte erregen müssen:
vr. Ch. Ruths' Experimentaluntersuchungen über Musikphantome und ein
daraus erschlossenes Grundgesetz der Entstehung, der Wiodergabe und der Auf-
nahme von Tonwerken (Darmstadt, H. L- Schlapp, Mk. 8.—). Aber die mu-
sikalischen Fachblätter gingen darüber mit Stillschweigen odcr mit ein paar
nichtssagenden Redensartcn hinweg, ohne sich auf dcn Jnhalt in Zustimmung
oder Widerlegung einzulassen, und auch sonst scheint das Werk untcr den Mu-
sikern geringer Tcilnahme zu begegncn. Es ist dies cin ncuerlicher Beleg für
die geistige Beschränktheit, die dcn „Ohrenmenschen" vom Fach auch am Ende
des cd- Jahrhunderts bis auf die Ausnahmen kennzeichnet, sür seinen Wider-
willen, sich mit Dingen zu befassen, die übcr das Handwcrksmäßige sciner Kunst
oder aber eine gewissc Gefühlsduselei ins Blaue hinausgehen, für seine Un-
fähigkeit, Probleme wahrzunehmen und die Versuche zu ihrcr Lösnng mit auf-
merksamcr Teilnahme zu verfolgen.
Das in Rede stehende Buch behandelt die „Musikphantome", eine Gruppe
von psychischen Erscheinungen, die in den Gehirnen mancher Personen wäh-
rend des Anhörens von Musik auftreten. Diese Phänomeno sind dadurch ge-
kennzeichnet, daß sie für das betreffendc Gehirn als ein Fremdes und in ihren
bcsonderen Eigcnschaften dem Eigcnwillcn nicht Unterworfencs erscheinen. Trotz-
dem besteht aber bci jencn Personen die zweifellose Erkenntnis, daß die
Phänomene in dieser Art nur in den Gehirncn selber bestehen und daß sie also
nicht auf vüllig adäquate Momente in der gleichzeitigen Außenwelt zurückgehcn
odcr als wirkliche Wahrnehmungen anzusehen sind. vr. Nuths hat bis zur
Veröffentlichung seines Buches zwci solche Personen in sciner Umgebung ge-
sunden, seither aber noch wcitere vier, und vermutet, daß es überhaupt mehr
Menschen, als man glauben möchte, gibt, bei denen die Musik sarbige Bilder
hcrvorruft. Nur schcnken die Betreffenden den Phantomen keine Beachtung oder
setzen sie auch bei allen andern Mcnschen voraus. Aus der Lebensgeschichte
namhaster Tonkünstler ließc sich wohl auch interessanter Stoff zusammentragen.
Jch erinnere z. B. an Schumann, der erzählt, daß ihm ein Freund beim Vier-
— r«8 —
Volkskunst-Predigt, die aller Tage aller Orten schafft durch jeden „Tiener
am Wort"'. Männer wie Friedrich Naumann und Arthur Bonus
könnten, meine ich, vorbildlich wirken, um unsre Predigten und vor allem
unsrc Grabreden vom Schellenwerk zu befreien.
Wir haben heute nicht von all dem andern Schellenwerk zu sprechen,
mit dem an der ernstesten Stätte noch so viel geklingelt wird, von den
oben erwähnten „Paradeuren" und all den Geschmacksroheitcn sonst. Sie
würden auch kümmerlicher gedeihen, hätte die Phrase in unsern Grabredcn
keinen Wucherboden. Zumal so lange der „Eitelkeitcn dicser Welt", der
Titel und Orden und Gelder und Würden in Grabreden mit Ehrfurcht ge-
dacht wird, wie wir das jetzt erlebt haben, passen die übrigen Klunkern
und Troddeln zum Bild. Die großen Schauer des Todes aber werden
in solcher Umgebung so leicht keinen erschüttern, keinen vom Alltäglichen
erlösen, keinen zum Ewigen erheben.
/Dusikpbantome.
Vor einigen Monaten ist ein Buch erschienen, das, wenn es in unserer
Musikwelt mit rechten Dingen zuginge, großes Aussehen hätte erregen müssen:
vr. Ch. Ruths' Experimentaluntersuchungen über Musikphantome und ein
daraus erschlossenes Grundgesetz der Entstehung, der Wiodergabe und der Auf-
nahme von Tonwerken (Darmstadt, H. L- Schlapp, Mk. 8.—). Aber die mu-
sikalischen Fachblätter gingen darüber mit Stillschweigen odcr mit ein paar
nichtssagenden Redensartcn hinweg, ohne sich auf dcn Jnhalt in Zustimmung
oder Widerlegung einzulassen, und auch sonst scheint das Werk untcr den Mu-
sikern geringer Tcilnahme zu begegncn. Es ist dies cin ncuerlicher Beleg für
die geistige Beschränktheit, die dcn „Ohrenmenschen" vom Fach auch am Ende
des cd- Jahrhunderts bis auf die Ausnahmen kennzeichnet, sür seinen Wider-
willen, sich mit Dingen zu befassen, die übcr das Handwcrksmäßige sciner Kunst
oder aber eine gewissc Gefühlsduselei ins Blaue hinausgehen, für seine Un-
fähigkeit, Probleme wahrzunehmen und die Versuche zu ihrcr Lösnng mit auf-
merksamcr Teilnahme zu verfolgen.
Das in Rede stehende Buch behandelt die „Musikphantome", eine Gruppe
von psychischen Erscheinungen, die in den Gehirnen mancher Personen wäh-
rend des Anhörens von Musik auftreten. Diese Phänomeno sind dadurch ge-
kennzeichnet, daß sie für das betreffendc Gehirn als ein Fremdes und in ihren
bcsonderen Eigcnschaften dem Eigcnwillcn nicht Unterworfencs erscheinen. Trotz-
dem besteht aber bci jencn Personen die zweifellose Erkenntnis, daß die
Phänomene in dieser Art nur in den Gehirncn selber bestehen und daß sie also
nicht auf vüllig adäquate Momente in der gleichzeitigen Außenwelt zurückgehcn
odcr als wirkliche Wahrnehmungen anzusehen sind. vr. Nuths hat bis zur
Veröffentlichung seines Buches zwci solche Personen in sciner Umgebung ge-
sunden, seither aber noch wcitere vier, und vermutet, daß es überhaupt mehr
Menschen, als man glauben möchte, gibt, bei denen die Musik sarbige Bilder
hcrvorruft. Nur schcnken die Betreffenden den Phantomen keine Beachtung oder
setzen sie auch bei allen andern Mcnschen voraus. Aus der Lebensgeschichte
namhaster Tonkünstler ließc sich wohl auch interessanter Stoff zusammentragen.
Jch erinnere z. B. an Schumann, der erzählt, daß ihm ein Freund beim Vier-
— r«8 —