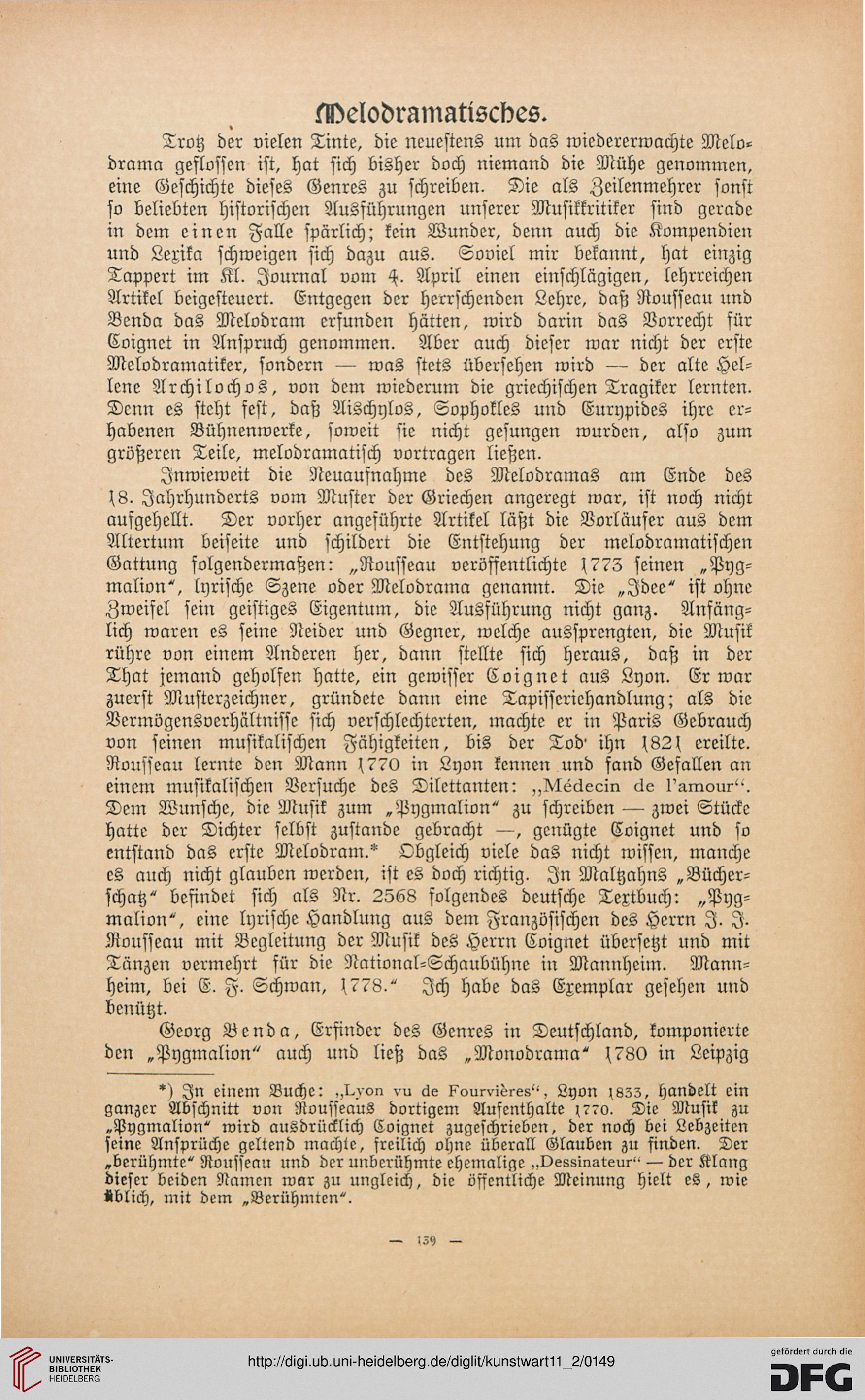lDelodramatiscbes.
Trotz der vielen Tinte, die neuestens um das wiedererwachte Melo-
drama gestossen ist, hat sich bisher doch niemand die Mühe genommen,
eine Geschichte dieses Genres zu schreiben. Die als Zeilenmehrer sonst
so beliebten historischen Ausführungen unserer Musikkritiker sind gcrade
in dem einen Falle spärlich; kein Wunder, denn auch dic Kompendien
und Lexika schweigen sich dazu aus. Sooiel mir bekannt, hat einzig
Tappert im Kl. Journal vom ls. April einen einschlägigen, lehrreichen
Artikel beigesteuert. Entgegen der herrschenden Lehre, daß Rousseau und
Benda das Melodram erfunden hätten, wird darin das Vorrecht für
Coignct in Anspruch genommen. Aber auch dieser war nicht der erste
Melodramatiker, sondern — was stets übersehen wird — der alte Hel-
lene Archilochos, von dem wiederum die griechischen Tragiker lernten.
Dcnn es stcht fest, daß Aischylos, Sophokles und Eurypides ihre er-
habenen Bühnenwerke, soweit sie nicht gesungen wurden, also zum
großeren Teile, melodramatisch vortragen ließen.
Jnwieweit die Neuaufnahme des Melodramas am Ende des
s8. Jahrhunderts vom Muster der Griechen angeregt war, ist noch nicht
aufgehellt. Der vorher angeführte Artikel läßt die Vorläuser aus dem
Altertum beiseite und schildert die Entstehung der melodramatischen
Gattung folgendermaßen: „Rousseau veröffentlichte s773 seinen „Pyg-
malion", lyrische Szene oder Melodrama genannt. Die „Jdee" ist ohne
Zweifel sein geistiges Eigentum, die Ausführung nicht ganz. Anfäng-
lich wareu es seine Neider und Gegner, welche aussprengten, die Musik
rühre von einem Anderen her, dann stellte sich heraus, daß in der
That jemand geholfen hatte, ein gewisser Coignet aus Lyon. Er war
zuerst Musterzeichner, gründetc dann eine Tapisseriehandlung; als die
Vermögensoerhältnisse sich verschlechterten, machte er in Paris Gebrauch
von scinen musikalischen Fähigkeiten, bis der Tod' ihn s82s ereilte.
Rousseau lernte den Mann s770 in Lyon kennen und fand Gefallen an
einem musikalischen Versuche des Dilettanten: „lVlsäeciv cle I'amour".
Dem Wunschc, die Musik zum „Pygmalion" zu schreiben — zwei Stücke
hatte dcr Dichter selbst zustande gebracht —, genügte Coignet und so
entstand das erste Melodram.* Obgleich viele das nicht wissen, manche
es auch nicht glauben werden, ist es doch richtig. Jn Maltzahns „Bücher-
schatz" befindet sich als Nr. 2568 folgendes deutsche Textbuch: „Pyg-
malion", eine lyrische Handlung aus dem Französischen des Herrn I. I.
Rousseau mit Begleitung der Musik des Herrn Coignet übersetzt und mit
Tünzen vermehrt für die National-Schaubühne in Mannheim. Mann-
heim, bei E. F. Schwan, s778." Jch habe das Exemplar gesehen und
benützt.
Georg Benda, Erfinder des Genres in Deutschland, komponierte
den „Pygmalion" auch und ließ das „Monodrama" s780 in Leipzig
Jn einem Buche: .,I.,ron vu äe k'ourvidreZ", Lyon ikss, handelt ein
ganzer Abschnitt von Rousseaus dortigem Aufenthalte irro. Die Musik zu
„Pygmalion" wird ausdrücklich Coignet zugeschrieben, der noch bci Lebzeiten
seine Ansprüche geltend machtc, freilich ohne überall Glauben zu finden. Der
„berühmtc" Rousseau und der unberühmte chemalige „Oes^iuateur" — der Klang
diescr beidcn Namen war zu ungleich, die öffcntliche Meinung hielt es, wie
tblich, mit dem „Berühmten".
Trotz der vielen Tinte, die neuestens um das wiedererwachte Melo-
drama gestossen ist, hat sich bisher doch niemand die Mühe genommen,
eine Geschichte dieses Genres zu schreiben. Die als Zeilenmehrer sonst
so beliebten historischen Ausführungen unserer Musikkritiker sind gcrade
in dem einen Falle spärlich; kein Wunder, denn auch dic Kompendien
und Lexika schweigen sich dazu aus. Sooiel mir bekannt, hat einzig
Tappert im Kl. Journal vom ls. April einen einschlägigen, lehrreichen
Artikel beigesteuert. Entgegen der herrschenden Lehre, daß Rousseau und
Benda das Melodram erfunden hätten, wird darin das Vorrecht für
Coignct in Anspruch genommen. Aber auch dieser war nicht der erste
Melodramatiker, sondern — was stets übersehen wird — der alte Hel-
lene Archilochos, von dem wiederum die griechischen Tragiker lernten.
Dcnn es stcht fest, daß Aischylos, Sophokles und Eurypides ihre er-
habenen Bühnenwerke, soweit sie nicht gesungen wurden, also zum
großeren Teile, melodramatisch vortragen ließen.
Jnwieweit die Neuaufnahme des Melodramas am Ende des
s8. Jahrhunderts vom Muster der Griechen angeregt war, ist noch nicht
aufgehellt. Der vorher angeführte Artikel läßt die Vorläuser aus dem
Altertum beiseite und schildert die Entstehung der melodramatischen
Gattung folgendermaßen: „Rousseau veröffentlichte s773 seinen „Pyg-
malion", lyrische Szene oder Melodrama genannt. Die „Jdee" ist ohne
Zweifel sein geistiges Eigentum, die Ausführung nicht ganz. Anfäng-
lich wareu es seine Neider und Gegner, welche aussprengten, die Musik
rühre von einem Anderen her, dann stellte sich heraus, daß in der
That jemand geholfen hatte, ein gewisser Coignet aus Lyon. Er war
zuerst Musterzeichner, gründetc dann eine Tapisseriehandlung; als die
Vermögensoerhältnisse sich verschlechterten, machte er in Paris Gebrauch
von scinen musikalischen Fähigkeiten, bis der Tod' ihn s82s ereilte.
Rousseau lernte den Mann s770 in Lyon kennen und fand Gefallen an
einem musikalischen Versuche des Dilettanten: „lVlsäeciv cle I'amour".
Dem Wunschc, die Musik zum „Pygmalion" zu schreiben — zwei Stücke
hatte dcr Dichter selbst zustande gebracht —, genügte Coignet und so
entstand das erste Melodram.* Obgleich viele das nicht wissen, manche
es auch nicht glauben werden, ist es doch richtig. Jn Maltzahns „Bücher-
schatz" befindet sich als Nr. 2568 folgendes deutsche Textbuch: „Pyg-
malion", eine lyrische Handlung aus dem Französischen des Herrn I. I.
Rousseau mit Begleitung der Musik des Herrn Coignet übersetzt und mit
Tünzen vermehrt für die National-Schaubühne in Mannheim. Mann-
heim, bei E. F. Schwan, s778." Jch habe das Exemplar gesehen und
benützt.
Georg Benda, Erfinder des Genres in Deutschland, komponierte
den „Pygmalion" auch und ließ das „Monodrama" s780 in Leipzig
Jn einem Buche: .,I.,ron vu äe k'ourvidreZ", Lyon ikss, handelt ein
ganzer Abschnitt von Rousseaus dortigem Aufenthalte irro. Die Musik zu
„Pygmalion" wird ausdrücklich Coignet zugeschrieben, der noch bci Lebzeiten
seine Ansprüche geltend machtc, freilich ohne überall Glauben zu finden. Der
„berühmtc" Rousseau und der unberühmte chemalige „Oes^iuateur" — der Klang
diescr beidcn Namen war zu ungleich, die öffcntliche Meinung hielt es, wie
tblich, mit dem „Berühmten".