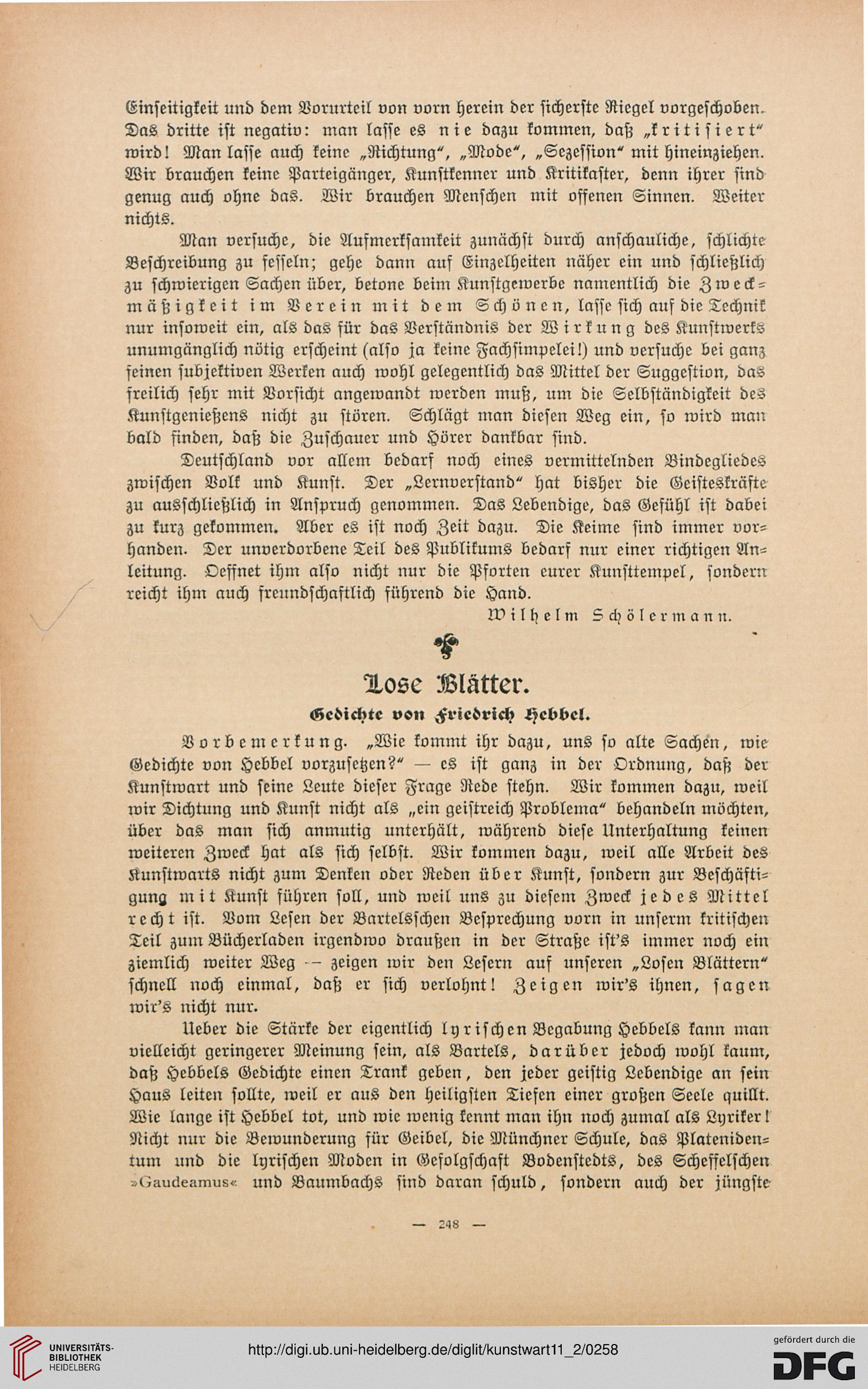Einseitigkeit und dem Vorurteil von vorn herein der sicherste Ricgel vorgeschoben.
Das dritte ist negativ: man lasse es nie dazu kommen, daß „kritisiert"
wird! Man lasse auch keine „Richtung", „Mode", „Sezession" mit hineinziehen.
Wir brauchen keine Parteigänger, Kunstkcnner und Kritikaster, dcnn ihrer sind
genug auch ohne das. Wir brauchen Menschen mit offenen Sinnen. Weiter
nichts.
Man versuche, die Aufmerksamkeit zunächst durch anschauliche, schlichte
Beschrcibung zu fesseln; gehe dann auf Einzelheiten näher ein und schließlich
zu schwierigen Sachen über, betone beim Kunstgewerbe namentlich die Zweck-
mäßigkeit im Vereinmit dem S ch ö n e n, lasse sich auf die Technik
nur insoweit ein, als das für das Verständnis der Wirkung des Kunstwerks
unumgänglich nötig erscheint (also ja keine Fachsimpelei!) und versuche bei ganz
seinen subjektiven Werken auch wohl gelegentlich das Mittel der Suggestion, das
sreilich sehr mit Vorsicht angewandt werden muß, um die Selbständigkeit des
Kunstgenießens nicht zu stören. Schlägt man diesen Weg ein, so wird man
bald finden, daß die Zuschauer und Hörer dankbar sind.
Deutschland vor allem bedarf noch eines vermittelnden Bindegliedes
zwischen Volk und Kunst. Der „Lernverstand" hat bisher die Geisteskräfte
zu ausschließlich in Anspruch genommen. Das Lebendige, das Gefühl ist dabei
zu kurz gekommen. Aber es ist noch Zeit dazu. Die Keime sind immer vor-
handen- Der unverdorbene Teil des Publikums bedarf nur einer richtigen An-
leitung. Oeffnet ihm also nicht nur die Pforten curer Kunsttempel, sondern
reicht ihm auch freundschaftlich sührend die tzand.
Nl i l h e l m S ch ö l e r m a n u.
O
Lose Wlätter.
Gedichtc von Ftie-rich Hebbel.
V o rb c m e rku n g. „Wie kommt ihr dazu, uns so alte Sachen, wie
Gedichte von Hebbel vorzusetzen?" — es ist ganz in der Ordnung, daß der
Kunstwart und seine Leute dieser Frage Rede stehn. Wir kommen dazu, weil
wir Dichtung und Kunst nicht als „ein geistreich Problema" behandeln möchten,
über das man sich anmutig unterhält, während diese Unterhaltung keinen
weiteren Zwcck hat als sich selbst. Wir kommen dazu, weil allc Arbeit des
Kunstwarts nicht zum Denken oder Reden über Kunst, sondern zur Beschäfti-
gung mit Kunst sühren soll, und weil uns zu diesem Zweck jedes Mittel
recht ist. Vom Lesen der Bartelsschen Besprechung vorn in unserm kritischen
Teil zuin Bücherladen irgendwo draußen in der Straße ist's immer noch ein
ziemlich weiter Weg - zeigen wir den Lesern auf unsercn „Losen Blättern"
schnell noch einmal, daß er sich verlohntl Zeigen wir's ihnen, sagen
wir's nicht nur.
Ueber die Stärke der eigentlich ly r isch en Begabung Hebbels kann man
vielleicht geringerer Meinung sein, als Bartels, darüber jedoch wohl kaum,
daß Hebbels Gedichte einen Trank geben, den jeder geistig Lebendige an sein
Haus leiten sollte, weil er aus den heiligsten Tiefen eincr großcn Seele quillt.
Wie lange ist Hebbel tot, und wie wenig kennt man ihn noch zumal als Lyriker!
Nicht nur die Bewunderung für Geibcl, die Münchner Schule, das Plateniden-
tum und die lyrischen Modcn in Gesolgschaft Bodenstcdts, des Scheffelschen
»Oauclesmus« und Baumbachs sind daran schuld, sondern auch der jüngste
248
Das dritte ist negativ: man lasse es nie dazu kommen, daß „kritisiert"
wird! Man lasse auch keine „Richtung", „Mode", „Sezession" mit hineinziehen.
Wir brauchen keine Parteigänger, Kunstkcnner und Kritikaster, dcnn ihrer sind
genug auch ohne das. Wir brauchen Menschen mit offenen Sinnen. Weiter
nichts.
Man versuche, die Aufmerksamkeit zunächst durch anschauliche, schlichte
Beschrcibung zu fesseln; gehe dann auf Einzelheiten näher ein und schließlich
zu schwierigen Sachen über, betone beim Kunstgewerbe namentlich die Zweck-
mäßigkeit im Vereinmit dem S ch ö n e n, lasse sich auf die Technik
nur insoweit ein, als das für das Verständnis der Wirkung des Kunstwerks
unumgänglich nötig erscheint (also ja keine Fachsimpelei!) und versuche bei ganz
seinen subjektiven Werken auch wohl gelegentlich das Mittel der Suggestion, das
sreilich sehr mit Vorsicht angewandt werden muß, um die Selbständigkeit des
Kunstgenießens nicht zu stören. Schlägt man diesen Weg ein, so wird man
bald finden, daß die Zuschauer und Hörer dankbar sind.
Deutschland vor allem bedarf noch eines vermittelnden Bindegliedes
zwischen Volk und Kunst. Der „Lernverstand" hat bisher die Geisteskräfte
zu ausschließlich in Anspruch genommen. Das Lebendige, das Gefühl ist dabei
zu kurz gekommen. Aber es ist noch Zeit dazu. Die Keime sind immer vor-
handen- Der unverdorbene Teil des Publikums bedarf nur einer richtigen An-
leitung. Oeffnet ihm also nicht nur die Pforten curer Kunsttempel, sondern
reicht ihm auch freundschaftlich sührend die tzand.
Nl i l h e l m S ch ö l e r m a n u.
O
Lose Wlätter.
Gedichtc von Ftie-rich Hebbel.
V o rb c m e rku n g. „Wie kommt ihr dazu, uns so alte Sachen, wie
Gedichte von Hebbel vorzusetzen?" — es ist ganz in der Ordnung, daß der
Kunstwart und seine Leute dieser Frage Rede stehn. Wir kommen dazu, weil
wir Dichtung und Kunst nicht als „ein geistreich Problema" behandeln möchten,
über das man sich anmutig unterhält, während diese Unterhaltung keinen
weiteren Zwcck hat als sich selbst. Wir kommen dazu, weil allc Arbeit des
Kunstwarts nicht zum Denken oder Reden über Kunst, sondern zur Beschäfti-
gung mit Kunst sühren soll, und weil uns zu diesem Zweck jedes Mittel
recht ist. Vom Lesen der Bartelsschen Besprechung vorn in unserm kritischen
Teil zuin Bücherladen irgendwo draußen in der Straße ist's immer noch ein
ziemlich weiter Weg - zeigen wir den Lesern auf unsercn „Losen Blättern"
schnell noch einmal, daß er sich verlohntl Zeigen wir's ihnen, sagen
wir's nicht nur.
Ueber die Stärke der eigentlich ly r isch en Begabung Hebbels kann man
vielleicht geringerer Meinung sein, als Bartels, darüber jedoch wohl kaum,
daß Hebbels Gedichte einen Trank geben, den jeder geistig Lebendige an sein
Haus leiten sollte, weil er aus den heiligsten Tiefen eincr großcn Seele quillt.
Wie lange ist Hebbel tot, und wie wenig kennt man ihn noch zumal als Lyriker!
Nicht nur die Bewunderung für Geibcl, die Münchner Schule, das Plateniden-
tum und die lyrischen Modcn in Gesolgschaft Bodenstcdts, des Scheffelschen
»Oauclesmus« und Baumbachs sind daran schuld, sondern auch der jüngste
248